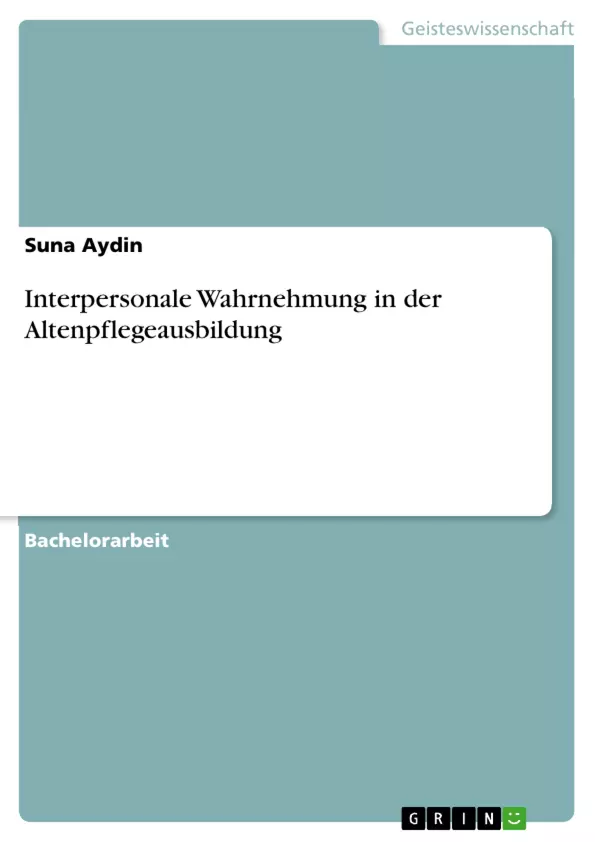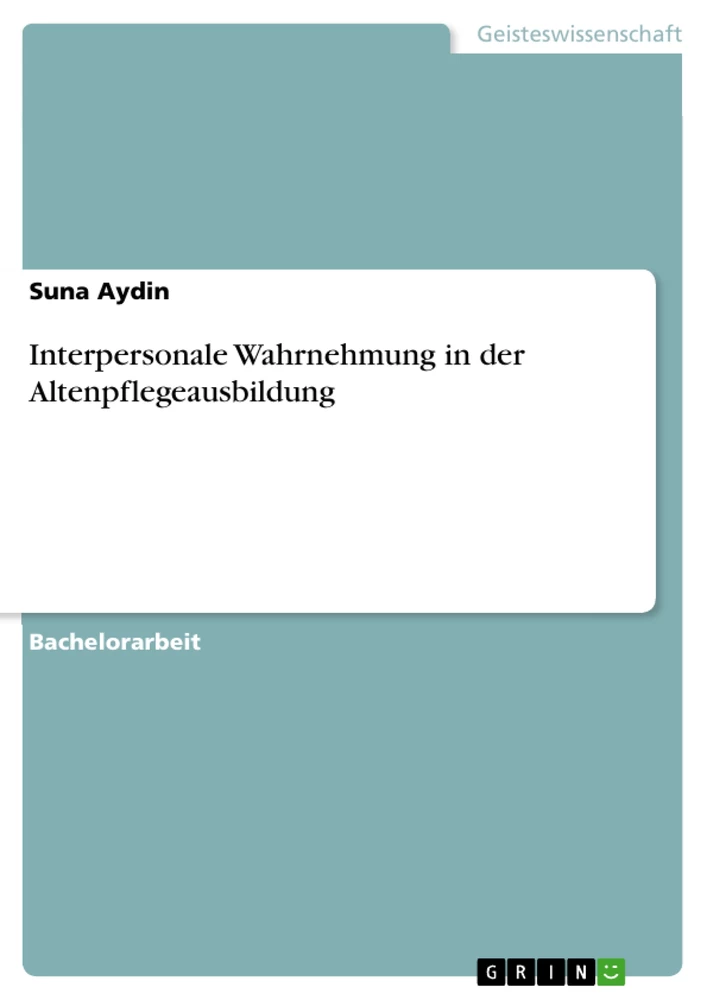
Interpersonale Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung
Bachelorarbeit, 2009
48 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
I Forschungsstand zur interpersonalen Wahrnehmung
2 Das Wesen der Personenwahrnehmung
2.1 Unterschiede in der Wahrnehmung von Personen und Objekten
2.2 Personenwahrnehmung als Fähigkeit?
3 Der Prozess der Eindrucksbildung
3.1 Algebraische Modelle der Eindrucksbildung
3.2 Implizite Persönlichkeitstheorien
3.3 Kategorisierung und Eindrucksbildung
3.4 Die Bedeutung der kognitiven Struktur des Wahrnehmenden
4 Einflussfaktoren auf die Personenwahrnehmung
4.1 Halo-Effekte
4.2 Reihenfolge – Effekte
4.3 Stimmungskongruenzeffekt
4.4 Negativitätstendenz
4.5 Sich selbst erfüllende Prophezeiungen
4.6 Attributionsverzerrungen
II Interpersonale Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung
1 Interpersonale Wahrnehmung in der Arbeit der AltenpflegerInnen
1.1 Welche Rolle spielt die interpersonale Wahrnehmung für den Beruf der Altenpflege?
1.2 Die Bedeutsamkeit der Forschungserkenntnisse zur interpersonalen Wahrnehmung – Fallbeispiele
2 Rezeption der Forschungsergebnisse zur interpersonalen Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung
2.1 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflege
2.2 Durchsicht der Lehrbücher
III Schlussbetrachtung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist interpersonale Wahrnehmung in der Pflege?
Es ist der Prozess, bei dem sich Pflegekräfte ein Bild von Heimbewohnern machen. Dieses Bild beeinflusst maßgeblich das Verhalten der Pflegekraft und die Qualität der Beziehung.
Welche Wahrnehmungsfehler gibt es im Pflegealltag?
Dazu gehören der Halo-Effekt (ein Merkmal überstrahlt alles andere), Reihenfolge-Effekte (der erste Eindruck zählt) und Attributionsverzerrungen (falsche Ursachenzuschreibung für Verhalten).
Was ist ein „Halo-Effekt“?
Ein Halo-Effekt tritt auf, wenn eine einzelne Eigenschaft einer Person (z.B. Freundlichkeit) so dominant wahrgenommen wird, dass sie die Beurteilung anderer Eigenschaften (z.B. Kompetenz) verfälscht.
Wird interpersonale Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung gelehrt?
Die Arbeit untersucht anhand der Ausbildungsverordnung und Lehrbüchern, ob und wie diese psychologischen Erkenntnisse vermittelt werden, um Pflegekräfte für Reflexion zu sensibilisieren.
Was sind „sich selbst erfüllende Prophezeiungen“?
Wenn eine Pflegekraft eine bestimmte Erwartung an einen Bewohner hat, verhält sie sich unbewusst so, dass der Bewohner dieses erwartete Verhalten schließlich tatsächlich zeigt.
Details
- Titel
- Interpersonale Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Sozialwissenschaft)
- Note
- 1,3
- Autor
- Suna Aydin (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V209386
- ISBN (eBook)
- 9783656370871
- ISBN (Buch)
- 9783656370970
- Dateigröße
- 639 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- interpersonale Wahrnehmung Personenwahrnehmung Altenpflege personenbezogene soziale Dienstleistungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Suna Aydin (Autor:in), 2009, Interpersonale Wahrnehmung in der Altenpflegeausbildung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/209386
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-