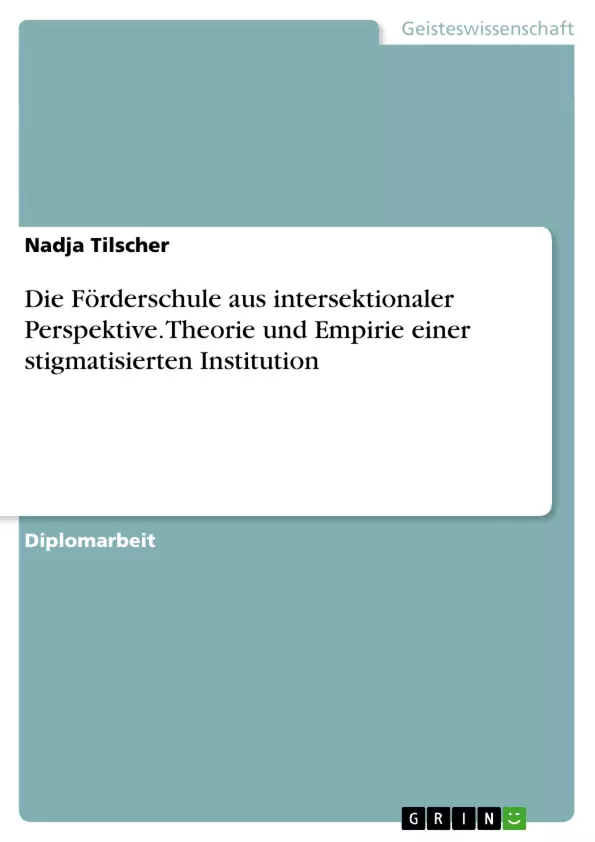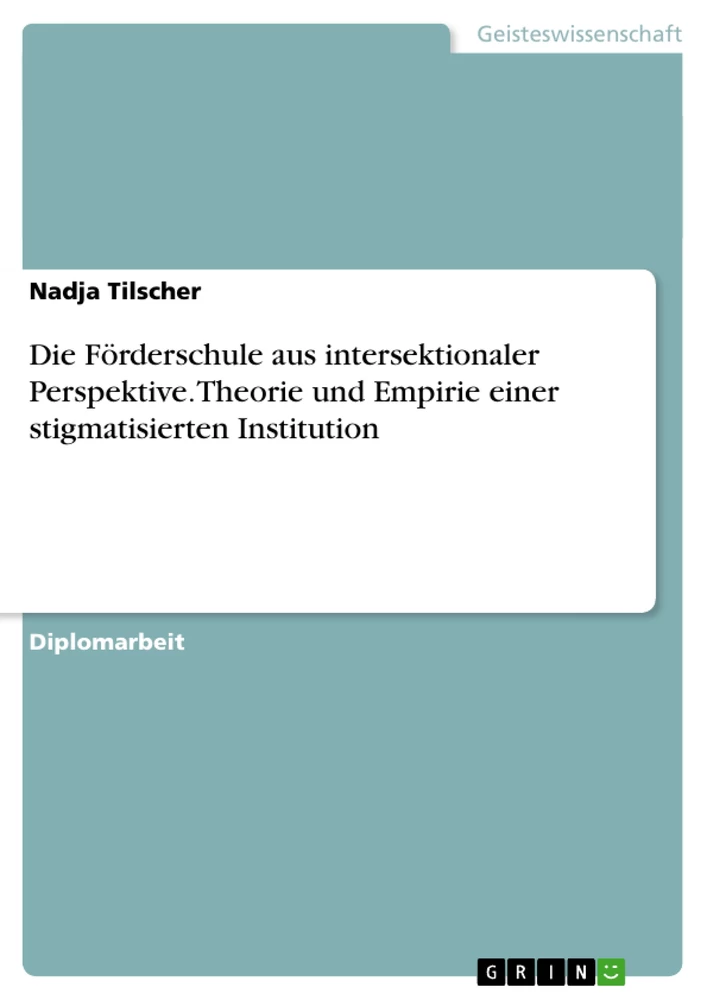
Die Förderschule aus intersektionaler Perspektive. Theorie und Empirie einer stigmatisierten Institution
Diplomarbeit, 2012
240 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
VORWORT
EINLEITUNG
1.1 Die Förderschule als stigmatisierte und stigmatisierende Institution - thematische Hinführung
1.2 Problemstellung
1.3 Operationalisierung der Fragestellung
1.4 Untersuchungsverlauf
2 THEORIE DER HEILPÄDAGOGIK UND DES FÖRDERSCHULSYSTEMS
2.1 Histographie der Heilpädagogik bis 1945
2.2 Die Etablierung des Förderschulwesens nach 1945 als deutscher Sonderweg im Lichte institutioneller Diskriminierung
2.3 Die gegenwärtige Situation der Beschulung behinderter Schüler
2.3.1 Was wird unter einer Behinderung verstanden?
2.3.2 Was wird heutzutage unter einer Förderschule verstanden?
2.3.2.1 Definition Förderschwerpunkt Lernbehinderung
2.3.2.2 Theoretische Konzeptionen von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
2.3.2.2.1 Die Pierre-Bourdieu-Schule
2.3.2.2.2 Die Albert-Schweitzer-Schule III
2.3.2.2.3 Die Heinrich-Hoffmann-Schule
2.3.3 Inklusive Beschulung in Deutschland
2.3.4 Beschulung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten im europäischem Raum
2.4 Die Empirie von Förderschulen
2.4.1 Hans Wocken
2.4.2 Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
2.4.3 Uwe Bittlingmayer, Jürgen Gerdes und Diana Sahrai
2.4.4 Lisa Pfahl
2.4.5 Bettina Bretländer
2.4.6 Resümee
3 THEORIE DES INTERSEKTIONALEN ANSATZES
3.1 Die methodologisch-theoretische Verortung des Intersektionalen Ansatzes
3.1.1 Resümee
3.2 Intersektionalitätsbezogene Schulforschung
3.2.1 Das Bildungssystem aus intersektionaler Perspektive
3.2.1.1 Die Förderschule aus intersektionaler Perspektive
3.2.1.2 Resümee
3.2.2 Studien zur Intersektionalität sozialer Unterscheidungen im Schulalltag
3.2.2.1 Martina Weber
3.2.2.2 Ann Phoenix
3.2.2.2.1 Resümee
4 EMPIRISCHE ERHEBUNG
4.1 Methodische und methodologische Vorbemerkungen
4.1.1 Fragestellung
4.1.2 Forschungsdesign
4.1.3 Methoden
4.1.3.1 Gruppeninterview
4.1.3.2 Leitfadeninterview
4.1.3.3 Teilnehmende Beobachtung
4.1.3.4 Collage
4.1.3.4.1 Grundsätzliches zum kreativen Gestalten mit Kindern
4.1.3.4.2 Interpretationsmöglichkeiten von Kinderzeichnungen und ihre Verwendung zur Beantwortung der Forschungsfrage
4.1.4 Feldzugang
4.1.5 Datenaufbereitung
4.2 Darstellung der Forschungsergebnisse
4.2.1 Grenzziehungen
4.2.1.1 Grenzziehungen über die Differenzierungskategorie Geschlecht
4.2.1.2 Grenzziehungen über die Differenzierungskategorie Alter
4.2.1.3 Grenzziehungen über die schulische Zugehörigkeit
4.2.2 Fremddiskriminierung, Binnendiskriminierung und Selbstabwertung
4.2.2.1 Fremddiskriminierung durch institutionelle Diskriminierung
4.2.2.2 Fremddiskriminierung von Schülern und Schülerinnen von anderen Schulzweigen
4.2.2.3 Binnendiskriminierung unter den Schülern und Schülerinnen
4.2.2.4 Selbstabwertung
4.2.3 Normalität im Schulalltag
4.2.3.1 Alterstypische Phänomene
4.3 Diskussion der Ergebnisse
4.3.1 Spannungsverhältnisse im Förderschulalltag
4.3.2 Der Umgang mit den Spannungsverhältnissen
4.3.3 Resümee
5 SCHLUSSFOLGERUNGEN
5.1 Möglichkeiten und Grenzen inklusiver Beschulung im Lichte politischer und gesellschaftlicher Implikationen
5.1.1 Möglichkeiten
5.1.2 Grenzen
5.1.2.1 Grenzen durch politischen Willen und soziale Distinktion
5.1.2.2 Grenzen durch die föderale Struktur
5.1.2.3 Grenzen durch die soziale und ethnische Struktur im Einzugsbereich der Schule
5.1.2.4 Grenzen durch Bedarfs-Standardisierungen und das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma
5.1.2.5 Grenzen durch ein utilitaristisches Menschenbild
5.1.2.6 Grenzen durch Vorurteile und Berührungsängste in der Gesellschaft
5.1.3 Inklusive Beschulung als Allheilmittel?
5.1.4 Resümee
ANHANG
Anlagenverzeichnis
Transkriptionsregeln
Teilnehmende Beobachtung 1
Anmerkungen/ Gedanken, die sich ergeben haben aus der ersten Teilnehmenden Beobachtung
Teilnehmende Beobachtung 2
Raumplan Klasse 5/6
Raumplan Klasse 8/9
Leitfaden Einzelinterviews
Brief für die SchülerInnen
Anschauungsbeispiele für Collagen für den Unterricht
Interview mit Julius
Interview mit Dorothy
Interview mit Sofie
Collage von Charlotta
Interview Lisa
Interview mit Jasmin
Interview mit Carmen
Collage von Michael
Interview mit Anton
Interview Carsten
Leitfaden für die beiden Gruppeninterviews
Gruppeninterview 1, Gedächtnisprotokoll
Subjektiv empfundene Atmosphäre während des Gruppeninterviews
Gruppeninterview 2
Leitfaden Amilia
Gedächtnisprotokoll Gespräch mit Amilia vor und nach dem Interview
Interview mit Amilia
QUELLENVERZEICHNIS
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Zeitschriftenbeiträge
Zusätzlich verwendete Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2-1: Bildungsbarometer Inklusion
Abbildung 2-2: Bewertung integrativer Beschulung seitens der körperbehinderten Schülerinnen
Abbildung 3-1: Mehrdimensionales Analysemodell
Abbildung 5-1: Integration als Addition eines sonderpädagogischen Reservats
Abbildung 0-1: Exemplarische Collage 1
Abbildung 0-2: Exemplarische Collage 2
Abbildung 0-3: Exemplarische Collage 3
Abbildung 0-4: Exemplarische Collage 4
Abbildung 0-5: Collage Julius
Abbildung 0-6: Collage Sofie
Abbildung 0-7: Collage Charlotta
Abbildung 0-8: Collage Lisa
Abbildung 0-9: Collage Jasmin
Abbildung 0-10: Collage Carmen
Abbildung 0-11: Collage Michael
Abbildung 0-12: Collage Anton
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Die vorliegende Diplomarbeit mit ihrer Schwerpunktsetzung basiert auf meiner Arbeit als Hilfskraft während meines Studiums, durch die ich unter anderem Einblicke in die Theorie zur Bildungsforschung im Kontext von sozialer Ungleichheit gewinnen konnte. Genauso liegt ihr meine Tätigkeit als Projektleiterin an der beforschten Förderschule zu Grunde. Sowohl im Rahmen der Theorie über die Institution, als auch innerhalb der Praxis der Förderschule, hat mich die Stigmatisierung selbiger und vor allem ihrer Schülerschaft erschüttert. Die Stigmatisierungserfahrungen und die damit assoziierte erschwerte adoleszente Identitätsarbeit der Förderschüler waren im Rahmen des Projekts, welches ich leitete, immer wieder zu spüren.
Daher ist es mir in dieser Diplomarbeit ein zentrales Anliegen, die Herrschaftsverhältnisse, die sich im Förderschulalltag widerspiegeln, aus intersektionaler Perspektive darzustellen, und dabei die subjektive Sicht der FörderschülerInnen zu integrieren und ihnen somit eine Stimme zu verleihen. Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle für das mir von den Schülern trotz vielerlei negativen Erfahrungen geschenkte Vertrauen, beispielsweise in Form von persönlichen Schilderungen ihrer Empfindungen, bedanken.
Darüber hinaus möchte ich mich zutiefst für die Möglichkeit überhaupt theoretisch und praktisch in das Forschungsfeld eintauchen zu können, und für die in diesem Zusammenhang geleistete Unterstützung und fruchtbaren Gespräche, bei den Mitarbeitern der sozialen Gruppenarbeit so- wie bei allen Lehrern und Angestellten der Pierre-Bourdieu-Schule (Name der Schule geändert), als auch besonders bei meinen beiden Korrektoren Uwe Bittlingmayer und Miriam Redlich, als auch Christine Riegel, bedanken. Des Weiteren möchte ich allen mir nahestehenden Personen, die mir mit Rat und Tat während der Zeit der Diplomarbeit zur Seite standen, meinen herzlichs- ten Dank aussprechen1
Einleitung
1.1 Die Förderschule1 als stigmatisierte und stigmatisierende Institution - the- matische Hinführung
Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung ist der Auffassung, dass es spätestens seit dem Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen am 26. März 2009 in Deutschland eine echte Wahlmöglichkeit bezüglich der Beschulung behinderter Kinder und Ju- gendlicher für Eltern und ihre behinderten Kinder geben muss. Denn nach Art. 24 der Konven- tion müssen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu ei- nem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterfüh- renden Schulen haben. (vgl. Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, 2011)
Kernargumentation des Diskurses ist, dass die Förderschule nicht zur Integration der von einer Behinderung betroffenen Subjekte beiträgt. Dies steht mit der wissenschaftlichen Forschung im Einklang, durch die nachgewiesen werden kann, dass in der Förderschule als Teil des Bildungs- systems direkte und indirekte institutionelle Diskriminierung an der Schülerschaft verübt wird. (Gomolla/Radtke, 2002)
Dabei wird die Selektion von Subjekten auf Förderschulen durch die Heilpädagogik dadurch legi- timiert, dass diese eine eingeschränkte Autonomie aufweisen und davon abgeleitet eine natürlich bedingte negativ abweichende Lern- und Leistungsfähigkeit. Ein solches Menschenbild mit einem entsprechendem biologisch begründeten Begabungs- und Intelligenzkonzept mit Höher- und Minderwertigkeitsvorstellungen, erlaubt eine Hierarchiebildung, die dem gesamten deutschen klassenspezifischen, monistisch dominierten Bildungssystem zugrunde liegt. Unter dieser Denkweise können alle Subjekte über konstruierte Differenzen ihren Ort zugewiesen bekommen. (vgl. Solga, 2005a und Vester 2005, in: Pfahl, 2008, S.42f., sowie Prengel, 2006, S.171)
Über die Differenzkategorie Körper hinaus wird über weitere konstruierte Differenzkategorien, mit denen Minderwertigkeitsvorstellungen verknüpft sind, selektiert. Dies trifft männliche Subjekte (Geschlecht), Subjekte mit einem Migrationshintergrund (Ethnie), Subjekte aus kinderreichen, armen und von Arbeitslosigkeit betroffenen Familien (Klasse). (vgl. Wocken, 2007, S.49 in: Demmer-Dieckmann/Textor, vgl. Thielen, 2011, Einleitung)
Des Weiteren muss die Institution, zumindest mit dem Förderschwerpunk Lernen, sich im Rahmen eines Forschungsprojekts der Bertelsmann Stiftung, in der sie unter Effizienzkriterien beforscht wurde, indem man sie marktwirtschaftlichen Kriterien unterzog, der Kritik aussetzen, sie sei unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten wenig ertragreich und stelle somit eine finanzielle Belastung dar. (vgl. Dr. Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung: „Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, wenig Perspektiven“)
Die Perspektive auf die Institution und ihre Adressaten von Seiten der Gesellschaft fügt sich in die benannten Diskriminierungsprozesse auf strukturell-institutioneller Ebene ein und wird möglicherweise hierdurch hervorgerufen. (vgl. Seemann, Gew Weser-Ems, S.30) Sie ist gekennzeichnet von Negativzuschreibungen, Pauschalisierungen, Etikettierungen und Stigmatisierungen oder schlicht Interesselosigkeit und Unwissen sowie massiven Berührungsängsten mit der Institution und den Adressaten. (vgl. Bittlingmayer, Gerdes, Sahrai, 2011, S.1, in: Widmeier/Nonnenmacher sowie vgl. Mediathek Bpb „Was wissen Sie über Förderschulen“)
Die Diskriminierung behindert die Förderschüler in ihren Handlungsmöglichkeiten und in der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins. Inklusion, sprich Teilhabe an der Gesellschaft, wie es auch das oben erläuterte Kernargument des Diskurses im Rahmen der Einschätzung des Behindertenbeauftragten besagt, wird somit verhindert. (vgl. Bittlingmayer/Gerdes/Sahrai, 2011, S.5, in: Widmeier/Nonnenmacher, vgl. Merten, 2008, S.55, vgl. Winkler, 2008, S.69, vgl. Thiersch in Henschel/ Krüger/ Schmitt/ Stange, 2008, S.30, vgl. Kessl/ Otto/ Treptow in Münchmeier/ Otto/ Rabe- Kleberg, 2002, S.73, vgl. Thole/ Ahmed/ Höblich, 2007, S.162, vgl. 12. Kin-der- und Jugendbericht, 2005, S.433, vgl. Powell/Pfahl, 2008, S.5, vgl. Lücking/Reichenbach, 2009, S.29 sowie vgl. Rauschenbach, 1995, S.352)
Wirtschaft, Staat und Forschung erachten zusammengefasst die Förderschule somit als teuer, ineffizient, humankapital-hemmend und Subjekte diskriminierend. Von Seiten der Gesellschaft möglicherweise durch eben genannte Kriterien hervorgerufen: eine Schule, die kein Interesse weckt, von der man nichts, oder von der man auf jeden Fall nichts Gutes weiß. Dies lässt die Institution, inklusive ihren Schulalltag, nicht unberührt.
1.2 Problemstellung
Das Forschungsproblem spiegelt sich entsprechend in der spezifischen Fragestellung wider, wie sich der Förderschulalltag unter den benannten Diskriminierungsprozessen tatsächlich darstellt. Ziel ist daraus abzuleiten, ob es möglich wäre, Herrschaftsverhältnisse, die sich in dem Stigmati- sieren von Subjekten und ganzen Institutionen zeigen, im Rahmen von inklusiver Beschulung aufzulösen.
1.3 Operationalisierung der Fragestellung
Die inhaltliche und methodische Klärung der Forschungsfrage umfasst die nun folgenden Über- legungen:
Es stellt sich zunächst die Frage, was die Funktion dieser Diskriminierungsprozesse ist und wie sich die Herrschaftsverhältnisse etablieren konnten. Dafür ist eine theoretische Auseinanderset- zung des historischen Zustandekommens der Förderschule von Bedeutung. Darunter fällt auch die spezifisch deutsche Bildung von von einer Behinderung betroffener Subjekte nach dem Zwei- ten Weltkrieg. Um die institutionellen Diskriminierung aufzuschlüsseln, werden auch immer wie- der die Forschungserkenntnisse von Gomolla, Radke und Pierre Bourdieu einfließen. Bourdieus Perspektiven weisen darüber hinaus Parallelen zum Intersektionalen Ansatz auf, der als strategi- scher Forschungsblick und Analyseperspektive zur Anwendung kommen soll. (vgl. Pierre Bour- dieus Habitustheorie 1976)
Der Intersektionale Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er komplexe Herrschaftsstrukturen, durch die Ungleichheitsstrukturen möglicherweise immer wieder generiert und stabilisiert werden, erfassen und analysieren kann. Auf Grundlage der Fragestellung, wie sich der Förderschulalltag unter den benannten Spannungsverhältnissen darstellt, und ob die Herrschaftsstrukturen, über die die Individuen diskriminiert werden, sich im Rahmen einer inklusiven Beschulung auflösen würden, ist er die bestmögliche theoretische und methodische Grundlage.
Er wird daher in seinen theoretischen Dimensionen und seinem methodologischen Vorgehen plastisch dargestellt, um sein Potential bei dieser Fragestellung aufzuzeigen und zu begründen. Durch empirische Datengewinnung an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in einem eher ländlich geprägten Bereich Baden-Württembergs soll die Forschungsfrage, die bis dato auf Basis der Theorie und eines tendenziell empiriefernen Diskurs beantwortet wurde, mit eigenen empirischen Daten und empirischem Material von anderen Forschungsprojekten an Förderschulen unterfüttert und kontrastiert werden. Wie stellt sich der Alltag unter Diskriminierungsprozessen tatsächlich dar?
Wie vollziehen sich im Alltag einer Förderschule die Wahrheitsetablierung durch Wahrheit und Wirklichkeit konstituierende Prozesse, wie Differenzbildungen, Zuschreibungen, Ein- und Aus- grenzungs- als auch Abwertungsprozesse? Was ist deren Funktion für die alltägliche soziale Ord- nung und für das soziale Zusammenleben der Subjekte? Ziel ist, empirisch zu rekonstruieren, wie in diesen sozialen Kontexten „(…)welche Unterscheidungen wie verwendet und relevant gesetzt werden sowie welche privilegierenden oder benachteiligten Effekte dies nach sich zieht.“ (Scherr, 2006, S.2015)
Mit den Methoden leitfadengesteuerter Einzel- und Gruppeninterviews und dem Anfertigen von Collagen durch die Schüler unter der Fragestellung „Wie erlebst du den Alltag an der PierreBourdieu-Schule?“ sollen die oben benannten Prozesse, die den Alltag kennzeichnen mögen, durch die Selbstbeschreibungen der SchülerInnen erfasst werden. Darüber hinaus soll der Alltag durch die Datensammlung über Broschüren und dem Auftritt der Schule im Rahmen ihrer Homepage betrachtet werden. Auch wird der Alltag durch teilnehmende Beobachtung, beispielsweise in Form der Unterrichtsbeobachtung, näher untersucht.
1.4 Untersuchungsverlauf
Entsprechend zeichnet sich die Diplomarbeit durch folgenden Untersuchungsverlauf aus:
Überblick:
Die Punkte 2-3 stellen den theoretischen Teil der Diplomarbeit dar. Punkt 4 den empirischen Teil, inklusive der Diskussion der Ergebnisse, und Punkt 5 entsprechende Schlussfolgerungen im Kontext der Fragestellung, ob inklusive Beschulung Herrschaftsverhältnisse, die sich in dem Stigmatisieren von Subjekten und ganzen Institutionen zeigen, aufzulösen im Stande wäre. Da- nach folgt der Anhang.
Präziser Untersuchungsverlauf:
Theorieteil 2-3:
Zunächst erfolgt unter Punkt 2.1 eine historische Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der Förderschule und der in ihr angewandten Disziplin der Heilpädagogik.
Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen Sonderweg in der Weiterentwicklung der Bildung behinderter Subjekte eingeschlagen, der stark mit der ihr vorgeworfenen institutionellen Diskriminierung verwoben ist. Daher wird die Etablierung des Förderschulwesens nach dem Zweiten Weltkrieg unter Punkt 2.2 gesondert bearbeitet.
2.3 stellt die heutige Situation der Förderschule und das aktuelle Verständnis von Behinderung in Deutschland unter der Zuhilfenahme von theoretischen Konzepten von Förderschulen dar. Des Weiteren wird aufgezeigt, was inklusive Beschulung kennzeichnet und wie sie bis dato in Deutschland umgesetzt wird. Dies ist zwingend notwendig um die Forschungsfrage zu beantwor- ten, ob Herrschaftsstrukturen, über die die Individuen diskriminiert werden, sich im Rahmen ei- ner inklusiven Beschulung auflösen würden. Im Anschluss wird der Frage nachgegangen, wie im europäischen Raum die Beschulung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten verläuft.
Sodann unter Punkt 2.4 wird der bisherige Forschungsstand zur Qualität der Beschulung an Förderschulen mit Hilfe empirischer Studien, die an Förderschulen erfolgt sind, dargelegt.
Anschließend geht es, da die Förderschule aus einer intersektionalen Perspektive beleuchtet werden soll, in Punkt 3.1 um die theoretische und methodische Darstellung des Intersektionalen Ansatzes. Es soll die Stärke für das Forschungsvorhaben - sprich das Potential dieser Perspektive im Schulkontext - deutlich gemacht werden.
Punkt 3.2 wird eine Darstellung intersektionaler Schulforschung umfassen. Dazu werden unter Punkt 3.2.1 zu einem besseren Verständnis die theoretischen Überlegungen zu Theorie und Methodologie des Intersektionalen Ansatzes am Beispiel einer intersektionalen Perspektive auf das selektive Bildungssystems und der Förderschule im Lichte der institutionellen Diskriminierung, die sich aus Punkt 2.2 ableitet, erläutert. Punkt 3.2.2 hat das Ziel aufzuzeigen, wie intersektionale Studien im Kontext der Schule gestaltet werden können.
Insgesamt wird so der aktuelle Forschungsstand unter diesem Punkt in der Verwendung des Ansatzes im Schulkontext ersichtlich werden.
Empirischer Teil:
Punkt 4 umfasst die eigene empirische Datenerhebung:
Punkt 4.1 wird methodische und methodologische Vorüberlegungen umfassen.
Hierunter fallen mit Punkt 4.1.1 die Fragestellung, mit Punkt 4.1.2 das Forschungsdesign, mit Punkt 4.1.3 die gewählten Methoden, mit Punkt 4.1.4 mein Feldzugang zu einer Förderschule im eher ländlich geprägten Bereich Baden-Württembergs, sowie mit Punkt 4.1.5 die Datenaufberei- tung.
Punkt 4.2 konzentriert sich auf die Auswertung des empirischen Materials. Hierunter fallen die Unterpunkte 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3, das heißt Grenzziehungen, Fremddiskriminierung und Selbstabwertung sowie Herstellung von Normalität, die je eigene Unterpunkte enthalten.
Anschließen folgt in Punkt 4.3 die Diskussion der Ergebnisse aus Punkt 4.2, unter Bezugnahme auf die empirischen Daten zur Förderschule aus Punkt 2.4 sowie zur Theorie aus Punkt 1 und 2.
Schlussfolgerungen:
Punkt 5 wird schlussendlich die Frage diskutieren, ob eine inklusive Beschulung sich weniger diskriminierend auf die FörderschülerInnen auswirken könnte, beziehungsweise ob Herrschaftsverhältnisse, die sich in dem Stigmatisieren von Subjekten und ganzen Institutionen zeigen, im Rahmen von inklusiver Beschulung aufzulösen wären.
Anhang:
Im Anhang befindet sich das gewonnene Material. Dieses wird im Anhang genauer erläutert.2
2 Theorie der Heilpädagogik und des Förderschulsystems
Ziel der folgenden Punkte 2 - 2.3 ist die Annäherung an die eingangs gestellte Frage, wie sich der Förderschulalltag unter benannten Diskriminierungsprozessen darstellt. Darüber hinaus des Weiteren an die Frage, ob es möglich wäre, Herrschaftsverhältnisse, die sich in dem Stigmatisieren von Subjekten und der Institution Förderschule zeigen, im Rahmen von inklusiver Beschulung aufzulösen, so dass es dadurch zu einer Veränderung auf struktureller Ebene käme.
Dazu ist es nötig nachvollziehbar zu machen, wie und warum sich die Förderschule, die, wie aus der Einleitung hervorgehen mag, nicht förderlich scheint, als Teil eines diskriminierenden, da Herrschaftsstrukturen in sich tragenden, Bildungssystems etabliert hat. Schließlich greift „die Postulierung inklusiver Paradigmen (...) dann zu kurz, wenn die Gründe für die Einführung der Hierarchie und Trennung nicht geklärt sind (…).“ (Thiessen, 2011, Kapitel 4)
Dafür ist zunächst erstens unter Punkt 2.1 eine historische Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der Förderschule und der in ihr angewandten Disziplin der Heilpädagogik von großer Relevanz. Dabei wird aufgrund des genannten Schwerpunkts nicht darauf eingegangen, was sich inhaltlich unter der Bildung vollzog.
Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen Sonderweg in der Weiterentwicklung der Beschulung behinderter Subjekte eingeschlagen, der stark mit der ihr vorgeworfenen institutionellen Diskriminierung verwoben ist. Daher wird zweitens die Etablierung des Förderschulwesens nach dem Zweiten Weltkrieg unter Punkt 2.2 gesondert bearbeitet.
Im Anschluss wird drittens das heutige Verständnis von Behinderung definiert. Des Weiteren wird die Förderschule in ihrer heutigen Form als Institution unter Punkt 2.3 unter der Zuhilfenahme von theoretischen Konzeptionen von Förderschulen dargestellt und zu der Art der Beschulung behinderter Kinder in anderen Ländern abgegrenzt.
2.1 Histographie der Heilpädagogik bis 1945
Die Anfänge der Institutionalisierung der Heilpädagogik als dem Spezialgebiet der Pädagogik, welches sich mit der Erziehung und Förderung behinderter Subjekte befasst, werden auf das 18. Jahrhundert datiert. (vgl. Bleidick/ Ellger-Rüttgardt 2008, S.17)
Theorie der Heilpädagogik und des Förderschulsystems
Zunächst gibt es jedoch einen kurzen Überblick über den Umgang mit Behinderten vor dieser Zeit, ohne den eine Histographie der Disziplin unvollkommen wäre, denn die Zeit davor bildet den Nährboden für ihr spezifisches Gedeihen. Die Darstellung wird sodann in die Entstehungsgeschichte und die Etablierung der Disziplin übergehen:
Im Altertum wurden behinderte Neugeborene oftmals getötet. Im Mittelalter kam es im Rahmen der christlichen Almosen- und Sozialfürsorge zur Pflege und Fürsorge von Schwachen, jedoch abseits der Gemeinschaft in Klöstern und Armenhäusern. Zur Zeit der Hexenprozesse, geprägt von der christlichen Auffassung, dass Behinderte vom Dämon besessen sind, wurden Behinderte ausgemerzt, um den in ihnen vermuteten Dämon zu vernichten. (vgl. Häßler/ Häßler, 2005, S.31- 33 sowie Möckel, 2007, S.44 sowie Opp/Kulig/ Puhr, 2005, S.13f.)
Das Zeitalter der Aufklärung brachte ein Umdenken mit sich, da der Aberglaube einem For- schungsinteresse wich. Zudem war diese Zeit geprägt von einem immensen Machbarkeits- glauben, gekoppelt an die Vorstellung, die Selbstbestimmung und die Vernunft des Menschen über Erziehung fördern zu können. Entsprechend kam es zu Errungenschaften und Beweisen zur Bildsamkeit Behinderter zu dieser Zeit. (vgl. Opp/Kulig/Puhr, 2005, S.16) So fand 1763 der erste Unterricht taubstummer Schüler durch Abbé de l’Epée statt. (vgl. Bleidick/ Ellger- Rüttgardt, 2008, S.17) Dieser war jedoch mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden.(vgl. Möckel, 2007, S.31)
1785 wurde die erste Blindenschule durch Valentin Haüy eröffnet. Um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert vollzog Jean Itard einen Erziehungsversuch eines geistig behinderten Jungen. (vgl. Bleidick/ Ellger-Rüttgardt, 2008, S.17).
Es entstanden private Taubstummen- und Blindeninstitutionen. Die Subjekte, deren Erzieher die finanziellen Mittel nicht aufbringen konnten, oder die ihre Förderung nicht forcierten, und denen sich auch sonst niemand annahm, waren von Fürsorge und Bildung ausgeschlossen. (vgl. Möckel, 2007, S.32f.) Es entbehrte zu diesem Zeitpunkt noch einer ausformulierten Theorie der Heilpädagogik. (vgl. a.a.O., 2007, S.61)
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts herrschte, hervorgerufen durch den pädagogischen Optimismus im Rahmen des Zeitalters der Aufklärung, in fast allen deutschen Staaten die allgemeine Schulpflicht. (Opp/ Kulig/ Puhr, 2005, S.16)
Diese war jedoch vom Staat nur eingeschränkt durchsetzbar, aufgrund eines nicht flächende- ckenden Schulsystems. Sie galt auch nur bedingt für gehörlose, blinde, geistig und körperbehin- derte Kinder, und wenn dann nur in Institutionen abseits der Regelschule. (vgl. Möckel, 2007, S.232) Einzelne Pädagogen suchten weiter nach Methoden zur Bildung der Subjekte, die vom Unterricht ausgeschlossen und bestenfalls in Sondereinrichtungen beschult wurden.
1809 übernahm Wilhelm von Humboldt die Leitung der neu geschaffenen Sektion für Kultus und Unterricht. Er forcierte das Ziel eines von Standesgrenzen unabhängigen Bildungssystems. Das Berliner Blinden- und Taubstummeninstitut fielen unter die Obhut des Erziehungsministeriums und wurden von Humboldt gefördert.
Die hier forcierte Taubstummen-und Blindenbildung, und der Aufbau von entsprechenden heil- pädagogischen Institutionen für sie, wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiter vo- rangetrieben. Die institutionelle Entwicklung der Bildung geistig Behinderter wurde hingegen wie zuvor an die Kirche und motivierte Einzelpersonen delegiert. (vgl. Ellger- Rüttgardt in Opp/Theunissen, 2009, S.21) Gründe hierfür waren die Einschätzung, man habe es mit einem Mangel an seelischem Vermögen und einer geistigen Auffassung wie bei einem Tier zu tun, und Erziehung und Bildung seien zum Misserfolg verdammt. Im Rahmen dieser Auffassung wurden die Betroffenen zu einfachen Tätigkeiten abgerichtet. (vgl. Möckel, 2007, S.96-100)
Mit den in der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Wandlungsprozessen, im Rahmen der Industrialisierung, die zu Armut, Vernachlässigung und Verwahrlosung führten, entstanden so genannte Rettungshäuser (als Anstalten zur Besserung und Erziehung verwahrloster Kinder). Sie stellten die Antwort des Protestantismus auf die Pauperismusfrage (die Frage nach der Lösung der sozialen Ausnahmesituation) dar. (vgl. Ellger- Rüttgardt in Opp/Theunissen, 2009, S.21)
Durch Pfarrer Karl Haldenwang wurde 1838 beispielsweise eine „Rettungsanstalt für schwachsinnige Kinder“ in Wildberg gegründet. (vgl. Häßler/ Häßler, 2005, S.54)
Aus ähnlichen Motiven, und ebenso auf Initiative einzelner Persönlichkeiten hin, entstanden zeitgleich Erziehungsanstalten für krüppelhafte Kinder, welche aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu Körperbehinderten wurden. (vgl. Ellger- Rüttgardt in Opp/Theunissen, 2009, S.22)
Durch das Engagement in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert von Lehrern, aber auch Pfarrern und manchen Medizinern (vgl. Mühl in Fröhlich, 1991, S.128), entstand der Wille behinderte Kinder zu bilden.
Dennoch wurde der Bildung dieser Kinder nicht so viel Wert beigemessen, dass die Machthaber sich gewillt sahen, die finanziellen Mittel zur integrativen Beschulung3 aufzubringen. Behinderte Kinder wurden bestenfalls überwiegend in privaten Erziehungsanstalten beschult, die sich abseits des Regelschulsystems weiterentwickelten. Zudem wurde argumentiert, dass die übergroßen Klassen ohne zur Verfügung stehende Hilfsmittel und ohne eine entsprechende Qualifikation der Lehrkraft unzureichende Möglichkeit des individuellen Eingehens auf den Einzelnen böten.
Diese Haltung bildete den Grundstein dafür, dass sich die Heilpädagogik mit ihren einzelnen Schwerpunktsetzungen nach Behinderungsart in Theorie und Praxis (in Form der exklusiven Be- schulung) als eigenständige Disziplin weiter ausbildete und zwar unabhängig von der allgemeinen Pädagogik.
Unter diesen Voraussetzungen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bildung Blinder und Gehörloser weiter forciert. 1911 beispielsweise durch die rechtlich festgeschriebene Schulpflicht Blinder und Gehörloser.
Geistig Behinderte waren weiterhin von der Unterstützung der privaten Wohlfahrt abhängig, dies überwiegend in den für sie errichteten „Idiotenanstalten“. In diesen Anstalten wurden mit Geistesschwäche behaftete Kinder und Erwachsene zur Pflege untergebracht, möglichst gebildet und zu nützlicher Beschäftigung angehalten. (vgl. Opp/Theunissen, 2009, S.22)
Ab 1880 entstanden so genannte Hilfsschulen für die Kinder, die im Rahmen der Einführung der allgemeinen Schulpflicht gegen Ende des 18. Jahrhunderts als schulschwach eingestuft wurden (vgl. a.a.O., Opp/Theunissen, 2009, S.23):
„Schwachbefähigte Kinder, d.h. Kinder, welche Spuren des Schwachsinns in sich solchem Grade tragen, dass ihnen nach mindestens zweijährigem Besuche der Volksschule ein Fortschreiten mit geistig gesunden Kindern nicht möglich ist, müssen in besonderen Schulen überwiesen werden (Hilfsschulen). Ausgeschlossen von diesen Schulen bleiben diejenigen Kinder, welche wegen zu großer körperlicher oder geistiger Belastung, oder wegen unzureichender häuslicher Erziehung und Pflege einer besonderen Anstaltserziehung bedürftig sind.“ (Bericht 1898, 26 in Kottmann, 2006, S.22)
Zunächst wurden also Kinder mit Spuren des Schwachsinns verwiesen. Mit der Zeit wandelte sich die Hilfsschule in ein Sammelbecken für Kinder mit verschiedenen Arten des Schulversa- gens, die dort qualifiziert und diszipliniert wurden. Die Transformation und ihre Legitimation basierten auf einer Interessenallianz von Staat, Volksschullehrerschaft und Hilfsschullehrern. Diese wollte die Volksschule von „(ökonomischem) Ballast“ befreien. Als Ballast empfand man die Kinder, die aufgrund der Einführung der Schulpflicht nun auch zwangsweise zum Schülerkli- entel gehörten, aber nicht die erwarteten Bildungsvoraussetzungen besaßen. (vgl. Opp/Kuhlig/Puhr, 2005, S.20, vgl. Ellger-Rüttgardt in Opp/Theunissen, 2009, S.23) Aufgrund ihres Standes und/oder einer Behinderung wurden sie als nicht würdig angesehen am Volks- schulunterricht teilzunehmen. Die Ungleichheitsverhältnisse, die sich durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in der Volksschule abbildeten, abzumildern und die Kinder in der Volksschule zu unterstützen, sollte nicht Ziel sein. Die Machthaber zogen es vor, diese zu segre- gieren. Dies kann als Grundstein für die heutigen Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen, Sprache und/oder emotionale und soziale Entwicklung - in Baden-Württemberg Förderschule genannt - aufgefasst werden. (vgl. Einleitung, vgl. Punkt 5 empirische Daten zur Förderschule)
Frieda Buchholz (eine deutsche Hilfsschullehrerin, Heilpädagogin und Reformerin der Hilfsschulpädagogik) sah schon damals die Hilfsschulen als Notlösung an, die im Falle einer Veränderung der Regelschule hinfällig wären. (vgl. Opp/ Theunissen, 2009, S.24) Stötzner (ein einflussreicher Hilfsschullehrer) stellte die Hilfsschule nicht in Frage, gab aber kritisch zu bedenken, dass die Hilfsschule hart, abstoßend und niederdrückend klänge und Nachhilfeschule ein adäquaterer Begriff wäre. (vgl. Stötzner, 1864, S.10)
Das 20. Jahrhundert zeichnete sich zur Zeit der Weimarer Republik durch einen Reichtum an aus dem Boden sprießenden Erziehungs- und Bildungsanstalten aus. Diese waren vielfältig in ihren Ausrichtungen und Zielen. So gab es psychoanalytische und individualpsychologische Schulver- suche, Lande rziehungsheime und anthroposophische Erziehung. Insgesamt zeichnete sich diese Zeit durch pädagogische Reformbewegungen aus, die in der Praxis zu einer Kreuzung von spezi- eller und allgemeiner Pädagogik führte. (vgl. Ellger-Rüttgardt in Opp/ Theunissen, 2009, S.23)
Die Heilpädagogik als Disziplin war zu dieser Zeit allerdings noch in der Phase ihrer Implementierung - die erste Professur für Heilpädagogik wurde 1931 durch Heinrich Hanselmann in Zürich übernommen. (a.a.O. S.24)
Durch die Ausbreitung des nationalsozialistischen Gedankenguts (von dem schon Spuren in der Haltung gegenüber als nicht passgenau eingeschätzten Subjekten im 19. Jahrhundert zu finden sind), geknüpft an die Erbbiologie, Rassentheorie und den Sozialdarwinismus, wurden die Fort- schritte, was die Bildsamkeit von von einer Behinderung betroffener Subjekten betraf und die zur Zeit von Humboldts aufkeimende Überzeugung der Gleichheit aller Menschen, zunichte ge- macht. Der rassische Wert und die Brauchbarkeit bestimmten nun in der Gänze den Wert des Menschen, im Kontrast zum Weimarer Wohlfahrtsstaat, indem die spezielle und allgemeine Pä- dagogik kurzzeitig teils zusammenliefen.
Zunächst stand zu Kriegsbeginn die Brauchbarkeit im Vordergrund. Gehörlose und Blinde sowie Körperbehinderte hatten einen eigenen Bann in der Hitlerjugend. In den späteren Kriegsjahren 12 kam es zur Sterilisation und Euthanasie, basierend auf dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.7.1933, welches ein halbes Jahr später in Kraft trat.
Die Hilfsschule diente sodann als Schule zur Ausmerzung kranker Erbgänge. Wer auf diesen Schulen zu unbrauchbar wurde, kam in das Euthanasieprogramm:
Im Auftrag Hitlers wurde ein Vernichtungsprogramm ins „Leben“ gerufen. Ab Oktober 1939 gab es in diesem Kontext eine Meldepflicht für diejenigen behinderten Kinder, die nicht in Anstaltspflege lebten, an den „Reichsausschuss für wissenschaftliche Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden“ mit dem Ziel, ihre Ermordung vollziehen zu können. Dies jedoch geschah unter Geheimhaltung, um nicht mit anderen Ländern in Konflikt zu geraten.
Der Verein der Sonderpädagogen, 1898 gegründet, wurde gleichgeschaltet und in den nationalso- zialistischen Lehrerverbund überführt (NSLB). (vgl. Ellen-Rüttgardt in Opp/Theunissen, 2009, S.24-27)
2.2 Die Etablierung des Förderschulwesens nach 1945 als deutscher Sonderweg
im Lichte institutioneller Diskriminierung In diesem Unterpunkt wird es speziell noch einmal darum gehen, deutlich zu machen, wie sich das Fördersystem nach dem Zweiten Weltkrieg weiter etabliert hat.
Nach 1945 begann der Wiederaufbau in ähnlichen Strukturen wie in der Vorkriegszeit: „Kinder mit geistigen, körperlichen und sittlichen Ausfallerscheinungen und Schwächen, die aber noch bildungs- und erziehungsfähig sind, werden besonderen Schulen und Heimen zugewiesen (Hilfsschulen, Sonderschulen für Schwererziehbare, Blinde, Taubstumme, Krüppel usw.).“ (Schulgesetz für Groß-Berlin vom 26. Juni 1948, in: Froese, 1969, S.108).
Nach Speck ergab sich dieses eigenständige Förderschulsystem „konsequenterweise aus dem herrschenden Selektionsprinzip, wohl aber auch aus dem typisch deutschen Prinzip der organisatorischen Gründlichkeit und administrativen Praktikabilität.“ (Speck, 1987, S.15)
Das Anknüpfen an die Traditionen der Vorkriegszeit (und das galt für die darauffolgende Teilung Deutschlands für beide Staaten) mit dem Ausbau des Sonderschulwesens empfand man als eine Art Wiedergutmachung gegenüber den Untaten des Dritten Reiches. Dies ist jedoch im Nach- hinein als kontraproduktiv einzuschätzen; andere Staaten waren in der Kriegsepoche in der Aus- einandersetzung mit dem Thema Bildung und der (Weiter-)Entwicklung des Bildungssystems weiter vorangeschritten und zwischenzeitlich auf dem Wege der Normalisierung. (Ellger- Rüttgardt in Opp/ Theunissen, 2009, S.27) Das Normalisierungsprinzip wurde in den 1950er
Jahren als die zentrale Maxime im Umgang mit erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung entwickelt. In eine Kurzform gebracht, besagt die Normalisierungsformel, dass das Leben von (erwachsenen) Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in allen Phasen so normal wie möglich zu gestalten ist. (vgl. Röh, 2009, S.69-71)
Der Anspruch einer Gleichstellung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten, die sich auch in einer integrativen Beschulung gezeigt hätte, fehlte in Deutschland - das Bildungssystem fußte nach wie vor auf Selektion.
Entsprechend wurde in den folgenden Jahrzehnten das Förderschulwesen in der BRD und der DDR rasant qualitativ und quantitativ ausgebaut und eine ideelle und schulorganisatorische Abgrenzung zur Regelschule fokussiert. (Bleidig/ Ellger-Rüttgard, 2008, S.118)
13 Sonderschulformen waren im „Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens“ von 1960 vorgesehen, die Mittel für spätere Resozialisierungsmaßnahmen einsparen sollten. (vgl. Gomolla/Radtke, 2007, S.198)
Es waren die Blindenschule, Sehbehindertenschule, Gehörlosenschule, Schwerhörigen-schule, Sprachheilschule, Körperbehindertenschule, Krankenschule und Hausunterricht, Hilfsschule, Beobachtungsschule, Erziehungsschwierigenschule, Schule im Jugendstrafvollzug, Sonderberufsschule sowie der Heilpädagogische Lebenskreis.
Defizite wurden als relativ zeitstabil und durch bestimmte Entwicklungsbedingungen, die negative Entwicklungsprozesse hervorrufen, gedacht. So kam man zu der Auffassung, dass die Förderung an dem vorliegenden De fizit ansetzen sollte, und es durch nachträgliche, förderliche Entwicklungsbedingungen zu kompensieren wäre. Dies erfolgte unter dem Terminus „special education“. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.54f.)
Die Förderung erfolgte in Kleingruppen, in denen ausgewählte Themenbereiche, die keine allzu großen kognitiven Lernanforderungen erforderten, bearbeitet werden sollten.
Noch 1980 finden sich ähnliche Perspektiven in der ICIDH wieder, die sich an ein lineares medizinisches Modell anlehnt. In der ICIDH wurde Behinderung verstanden als das Resultat von einer ursächlichen medizinischen Schädigung, die sich dann zu einer personalen Schädigung auswächst und schlussendlich in einer sozialen Benachteiligung mündet.
Durch praktische Erfahrungen und empirische Untersuchungen war man theoretisch aber schon vorher zu Erkenntnissen über die Komplexität von Entwicklungsprozessen gekommen. Dem- nach wurde schon vorher Behinderung als das Ergebnis von komplexen Wechselspielen zwi- schen dem Gesundheitsproblem personenbezogener Faktoren und externen Faktoren, das heißt die Umstände, unter denen das Individuum lebt, in unterschiedlicher Gewichtung aufgefasst. Kausale Zusammenhänge zwischen Defiziten und Entwicklungsbedingungen/-prozessen für ganze Gruppen von Behinderten erwiesen sich im Einzelfall als völlig unzureichend, und folglich auch Interventions- und Förderprogramme, die für eine ganze Gruppe von Menschen galten. Ziel sollte sein, individuumszentriert zu schauen, wo sich der Lernort mit dem höchstmöglichen Potential einer zugeschnittenen Förderung befindet. Diese Art der Erziehung nennt sich „special needs education“. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.54f)
So wurde 1973 in der postulierten Empfehlung des deutschen Bildungsrates Differenzierung und Separierung als Sackgasse angesehen und als Ziel die gemeinsame Beschulung gefordert. (vgl. Arnold/Graumann/ Rakhkochkine, 2008, S.75)
Der Warnock-Report von 1978 untermauerte dies. Er forderte die Änderung von Konzepten, die auf spezielle Erziehungsbedürfnisse an Anlehnung an die jeweilige Behinderung zugeschnitten sind, hin zu grundsätzliche Erziehungszielen für alle Kinder, unabhängig von ihren Behinderun- gen. Dazu zählten die Förderung der Unabhängigkeit der Kinder sowie eine Haltung ihnen ge- genüber, die geprägt ist von Freude und Verständnis für sie. Dies beeinflusste die deutsche De- batte.
Doch erst 2001 wurden all diese Überlegungen und Argumente, wie eine Behinderung zu fassen ist, mit der Einführung der ICF von Seiten der WHO fixiert und die defizitorientierte Sichtweisen der ICIDH ad acta gelegt. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.54f)
Zusammenfassend zeigt sich also, dass die Entwicklung des Förderschulwesens nach 1945 auf dem schon vorher herrschenden Selektionsprinzip (basierend auf biologisch begründeten Bega- bungs- und Intelligenzkonzepten mit Höher- und Minderwertigkeitsvorstellungen) im deutschen Bildungssystem fußte. Empirische Untersuchungen, gestützt vom Warnock-Report und 2001 durch die ICF fixiert, ermöglichten eine komplexere Perspektive auf Menschen mit einer Behin- derung. Eine Erziehung, die sich an ihren spezifischen Fähigkeiten und ihrer Person orientiert (vgl. Konzepte in nächstem Punkt), ist nun gegeben. Dies steht einseitigen Zuschreibungen und Minderwertigkeitsvorstellungen entgegen. Dennoch besteht dieses selektierende Bildungssystem nach wie vor und ermöglicht institutionelle Diskriminierungsprozesse. Kinder werden immer noch auf Förderschulen verwiesen und nicht landesweit inklusiv beschult, was eine institutions- bezogene Sichtweise generiert und der geforderten individuumsbezogenen Perspektive entgegen- steht.
Welche Prozesse verhindern, dass die institutionelle Diskriminierung von behinderten Subjekten trotz vielfach positiv angestellten Überlegungen kein Ende erfahren hat?
Diese Überlegungen kreuzen sich mit den theoretischen Überlegungen des Intersektionalen An- satzes. Die Frage kann optimal mit Hilfe des Intersektionalen Ansatz unter Punkt 2.2 weiter auf- geschlüsselt werden. Im folgenden Punkt werden die aktuellen Überlegungen zur Individuums- zentrierung an Förderschulen weiter aufgegriffen und die gegenwärtige Situation dargestellt.
2.3 Die gegenwärtige Situation der Beschulung behinderter Schüler
Unter Punkt 2.3.1 wird der Frage nachgegangen, was heute unter einer Behinderung verstanden wird.
Unter Punkt 2.3.2, was eine Förderschule heutzutage mit ihren verschiedenen Fachrichtungen als Institution kennzeichnet.
Unter Punkt 2.3.2.1 soll, da die zu untersuchende Schule eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist, ein besonderes Augenmerk darauf gesetzt werden, was diesen Förderschwerpunkt ausmacht.
Die Fragen 2.3.2 und 2.3.2.1 werden in 2.3.2.2 anhand von theoretischen Konzeptionen, Schulprofilen, Präambeln und Zielsetzungen von den Homepages zweier Förderschulen sowie der beforschten Förderschule weiter aufgeschlüsselt.
Punkt 2.3.3 wird kurz den theoretischen Rahmen spannen, welches Gedankengut mit Inklusiver Beschulung einhergeht und wie Inklusive Beschulung in Deutschland bisher überhaupt umgesetzt wird. Dies ist notwendig, um einen Vergleich zu der Beschulung an Förderschulen überhaupt ziehen zu können, und die Forschungsfrage, ob Herrschaftsstrukturen, über die die Individuen diskriminiert werden, sich im Rahmen einer inklusiven Beschulung auflösen würden, zu beant- worten.
Unter Punkt 2.3.4 wird die Frage beantwortet, wie im europäischen Raum die Beschulung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten verläuft.
2.3.1 Was wird unter einer Behinderung verstanden?
Wann ist ein Subjekt per gesetzlicher Definition als behindert eingestuft?
Nach dem Sozialgesetzbuch IX in § 2 Absatz 1 sind Menschen behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“
Eine Schwerbehinderung liegt laut Absatz 2 vor, „wenn ein Grad der Behinderung von wenigs- tens 50 vorliegt und die Subjekte ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Be- schäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 (Abschluss von Versorgungsverträgen) rechtmäßig im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuch IX haben.“ (Marburger, 2008, S.45f.)
Gleiches gilt für einen Grad der Behinderung von wenigstens 30, wenn infolge der Behinderung ohne die Gleichstellung ein geeigneter Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangt oder behalten werden kann.
Die UN-Konvention postuliert in Artikel 1, dass behindert der- oder diejenige ist, wer langfristig seelisch, körperlich oder geistig oder von den Sinnen her beeinträchtigt ist. Diese Beeinträchtigungen in Wechselwirkung mit Barrieren auf der strukturellen und der Repräsentationsebene (vgl. Punkt 3.1) können sich zu einer Einschränkung der Teilhabe an der Gesellschaft subsumieren. (vgl. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2010)
Feststellen lässt sich hier, dass eine langfristige Beeinträchtigung bestehen muss.
Die UN-Konvention berücksichtigt die von gesellschaftlicher Seite möglicherweise gesetzten Barrieren, die die Teilhabe an der Gesellschaft einschränken.
Nun gibt es ja für diese Subjekte, denen eine Beeinträchtigung attestiert wird - die jedoch wie im Rahmen der ICF im vorherigen Kapitel erfasst, individuell als eine Beeinträchtigung empfunden wird oder auch nicht -, die Beschulung auf der Förderschule. (vgl. Thiessen, 2011, Kapitel 2) Mit welchem Ziel wird dies heutzutage begründet? Daran schließt sich die nächste Frage an.
2.3.2 Was wird heutzutage unter einer Förderschule verstanden?
Wie wird begründet, dass es diese Institution gibt?
Wie wird begründet, dass Subjekte mit einer Behinderung auf einer eigens für sie eingerichteten Institution beschult werden?
Nach Lücking und Reichenbach soll „eine Förderschule - auch Sonderschule, Förderzentrum oder Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt genannt- (...) den Schülern mit Beein- trächtigungen in Form von körperlich, geistiger und seelischer Behinderung und sozialen Beein- trächtigungen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbständiger Lebensgestaltung ermöglichen.“ (Lücking/Reichenbach, 2009, S.27)
Begründet wird die separierte Beschulung mit dem Argument, dass Regelschulen die spezifische Förderung, nach denen die Förderschulen ausgerichtet sind, wie Sehen, Hören, körperliche und motorische Entwicklung, Sprache, geistige Entwicklung, Lernen, emotionale und soziale Ent- wicklung und übergreifende Förderung, nicht immer leisten können. (Lücking/Reichenbach, 2009, S.27-29)
Die Begründung liegt also in der individuellen Hilfe, die von Regelschulen nicht immer geleistet werden kann, und die zudem eine höchstmögliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbstständige Lebensgestaltung ermöglichen soll. Dies steht völlig konträr zu meiner eingangs geschilderten Einschätzung des Behindertenbeauftragten, die ja besagt, dass eine Integration durch Förderschulen verhindert wird.
2.3.2.1 Definition Förderschwerpunkt Lernbehinderung
Was genau ist mit dem Förderschwerpunkt Lernen assoziiert?
Das Kultusportal des Landes Baden-Württembergs postuliert: „Die Förderschule (ehemals: Schule für Lernbehinderte) ist eine Schule, an der Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Unterrichtsund Förderangebot erhalten.“ (Kultusportal des Landes Baden-Württembergs)
Ein Vergleich mit der vorherigen Definition zeigt folgendes auf:
In der hiesigen Definition wird nicht erwähnt, dass die Regelschule spezifische Förderung nicht bieten kann, wie bei Lücking und Reichenbach, aber es findet sich das Argument der individuellen Hilfen, hier in Form von differenziertem Unterricht wieder. Warum der nötig ist, wird mit lang andauernden Lernproblemen begründet, statt mit einer direkten Kopplung an die Ursache (vgl. ICIDH, Punkt 1.2). Zu den Ursachen, warum es zu einem Förderbedarf kommt, geben sie nämlich zu bedenken, dass diese sehr vielfältig und unterschiedlich sein können. Organisch bedingte Entwicklungsverzögerungen, entwicklungshemmende soziale Umfeldbedingungen oder schwierige Schulbiografien. (vgl. ICF, Punkt 1.2)
Über die Definition hinaus wird auf der Homepage des Kultusportals des Landes Baden- Württemberg weiter erläutert, dass Ziel der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sei, dem Individuum einen an ihm orientierten Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu fokussieren, solle versucht werden, tragfähige Beziehungen zwischen Schülern, Lehrern und außerschulischen Partnern (und potentiellen Arbeitgebern) im Rahmen der Persön- lichkeitsbildung der Schüler zu entwickeln. Das ist deckungsgleich mit der Definition von Lü- cking und Reichenbach. Auch hier wird gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Eingliederung anvisiert, darüber hinaus jedoch auch noch explizit die selbstständige Lebensführung. Darüber hinaus, im Vergleich zu der Definition von Lücking und Reichenbach, stellt die Home- page des Kultusportals zum Thema Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen weiter heraus, solle durch den Unterricht, durch das Schulleben und durch die Subjekte selber die För- derung eines Selbstwertgefühls und die Entwicklung einer realistischen Selbstbildung anvisiert werden. Zur Unterstützung dieses Ziels, damit sich die FörderschülerInnen als erfolgreich erle- ben und dem schulischen Lernen Sinn beimessen können, werde der fachliche und kultur- technische Lerninhalt des Unterricht verwendungs- und lebensbezogen ausgerichtet.
Eine enge Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Kooperationspartnern, Fachdiensten und ehrenamtlichen Helfern aus außerschulischen Erfahrungsfeldern sei an Förderschulen vorge- sehen.
(vgl. Kultusportal des Landes Baden-Württembergs, vgl. Lücking/Reichenbach, 2009, S.27-29)
2.3.2.2 Theoretische Konzeptionen von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob die Theorie über Sinn und Zweck der Förderschulen (mit dem Förderschwerpunkt Lernen) aus Punkt 2.2, 2.3.2 und 2.3.2.1 mit der Theorie über die Praxis, wie sie von Förderschulen auf ihren Homepages im Rahmen von Konzepten, Schulprofilen und Präambeln beschrieben werden, übereinstimmt.
Da auch das Konzept der beforschten Schule herangezogen wird, können zeitgleich an der Pier- re-Bourdieu-Schule bereits Normen, Werte, Regeln und Umgangsweisen aufgeschlüsselt werden.
Die Pierre-Bourdieu-Schule ist, wie bereits benannt, eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Alle Vergleichsschulen werden den gleichen Schwerpunkt haben, um sie besser zueinander in Bezug setzen zu können.
2.3.2.2.1 Die Pierre-Bourdieu-Schule
Auf der Homepage der Pierre-Bourdieu-Schule (Name der Schule verändert) gibt es einen eignen Link, mit dem Titel: „Schulisches Konzept“. Darunter fallen folgende vier Oberpunkte:
1. Der junge Mensch im Mittelpunkt
2. Netzwerk von Unterricht und Kooperation
3. Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung
4. Schulcurriculum, Abschlüsse und Evaluation
Unter Punkt 1 fällt die übergeordnete Aufgabe, für die sich die Schule verantwortlich fühlt, näm- lich die SchülerInnen auf ihr privates und gesellschaftliches Leben vorzubereiten. Dies soll durch eine wertschätzende, respektvolle, unterstützende und begleitende Erziehung und den Erwerb von handlungssozialen und -kulturellen Kompetenzen erfolgen, die in individuellen und lebensre- levanten Lernangeboten erworben werden können. Schlussendlich sollen so bestmöglich selbst- bewusste, selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten heranreifen.
Unter Punkt 2 wird erläutert, dass die pädagogische Arbeit im Rahmen des Unterrichts, aber auch darüber hinaus, in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern erfolgt. Als Vorteile werden ge- nannt: die Vorbereitung auf das Berufsleben und/oder die mögliche Rückschulung sowie die Umsetzung von individuellem, kompetenzorientiertem, lebensbedeutsamem und sozialem Ler- nen. Hierzu ist eine kreisförmige Abbildung hinzugefügt, die in ihrer Mitte die SchülerInnen im Fokus hat, die umgeben sind von drei Kreisen. Im ersten die Schüler umgebenden Kreis finden sich Förderkurse, Arbeitsgemeinschaften, Handlungsfelder, Montessoripädagogik in der Unter- stufe sowie offene Unterrichtsformen. Darüber hinaus sind in den darauf folgenden Kreisen die soziale Gruppenarbeit verortet, der Hort, die Heilpädagogik, der Förderverein, das Gesundheits- amt oder auch der Jugendsachbearbeiter der Polizei.
Unter Punkt 3 wird, unter Berufung auf das heterogene SchülerInnenklientel, was das Leistungsvermögen und die sozialen Handlungs- und Selbststeuerungskompetenzen anbelangt und dem Verweis auf die förderliche Verzahnung mit externen Partnern, das individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitungskonzept erläutert, welches in der Schule zur Anwendung kommt. Zentral ist hierbei eine kooperative Diagnostik (wer mit wem kooperiert wird nicht erläutert, aber es handelt sich wohl um die externen Partner), um den Lern- und Entwicklungsstand der SchülerInnen zu erfassen, damit passgenaue Angebote für die FörderschülerInnen maßgeschneidert werden können. Die Förderangebote werden immer wieder auf ihre Wirkung hin reflektiert und dokumentiert sowie halbjährlich mit den Eltern besprochen.
Unter Punkt 4 wird Bezug auf den Unterricht genommen, dessen Inhalt auf dem des Schulcurriculums basiert. Dies wiederum unterliegt den Vorgaben des Bildungsplanes für Förderschulen in Baden-Württemberg.
Seit 2005/06 wird dieses Schulcurriculum auch evaluiert und gegebenenfalls Verbesserungen an ihm vorgenommen. Als besonders wichtig wird das Schulcurriculum auch herausgestellt, weil dadurch die Bildungsinhalte klar vorgegeben sind, die an der Förderschule erlernt werden sollen, und die bei erfolgreichem Erwerb eine Rückschulung ermöglichen können oder eine Orientierung bieten, ob der/die SchülerIn für andere Übergänge qualifiziert ist.
(Hier erfolgt keine Quellenangabe aufgrund des Datenschutzes)4
2.3.2.2.2 Die Albert-Schweitzer-Schule III
Die Albert-Schweitzer-Schule III liegt im Nordwesten Freiburgs. Im Rahmen ihrer eigenen Darstellung beschreibt sie sich als Schule, die von SchülerInnen aus vielen Nationen besucht wird. Eine Darstellung eines eigenen Konzepts findet sich auf der Homepage jedoch nicht. Jedoch wird ihr Leitbild, welches im Februar 2010 zusammen mit Lehrern, Schülersprechern, Mitarbeitern und Eltern optimiert wurde, mit folgendem Inhalt dargestellt:
Ziel ist es, an der Albert-Schweitzer-Schule III ein Schulklima zu schaffen, welches erfolgreiches Lernen im kognitiven und sozialen Bereich ermöglicht, unter Zurhilfenahme von klaren Struktu- ren und Regeln. Wie auch bei der Pierre-Bourdieu-Schule wird eine individuelle Förderung anvi- siert, die die Vielfalt der Schulgemeinschaft und den Spaß am Lernen berücksichtigen soll, wie auch die Stärkung der SchülerInnen in ihrer aktiven Teilhabe an der Gesellschaft. Die Kooperati- on mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten ist für die Umsetzung der Ziele nötig, um schluss- endlich die SchülerInnen nicht nur abschluss-, sondern auch anschlussfähig zu machen - über berufliche Perspektiven hinaus.5
2.3.2.2.3 Die Heinrich-Hoffmann-Schule
Die Heinrich-Hoffmann-Schule befindet sich in Riegel, 26 Kilometer nördlich von Freiburg, im Jugendhilfezentrum St. Anton. Die Förderschule ist nur ein Baustein der Schule - daneben gibt es noch eine Grundschule, die konzipiert ist für Schüler mit Schulfrust, und die - so wird es be- schrieben - von verschiedenen Auffälligkeiten betroffen sind, und gemeinsam klassenübergrei- fend unterrichtet werden, sowie eine Hauptschule und intensivpädagogische Klassen.
Die Förderschule setzt sich folgende Ziele:
Sie möchte die persönlichen Ressourcen der SchülerInnen erkennen, stärken und einsetzen. Die Heinrich-Hoffmann-Schule setzt sich zum Ziel, Entwicklungsdefizite ausgleichen zu können. Soziale Kompetenzen sollen entwickelt, eingeübt und gefestigt werden. Die Schüler sollen Wis- sen und Handlungsstrategien zur Bewältigung des Alltags erwerben, auch um ihre komplexe Umwelt differenzierter wahrnehmen und erfassen zu können. Bestmöglich werden Kontakte zu Personen, Gruppen und Einrichtungen außerhalb der Schule geknüpft, zum Beispiel um berufs- relevante Schlüsselqualifikationen im schulischen Kontext einzuüben und somit Zugänge zur Ar- beits- und Berufswelt zu finden.
Resümee
Ein Vergleich der drei Schulen zeigt, in Abgleich mit dessen was vom Kultusportal BW und Lü- cking/Reichenbach postuliert wird, Überschneidungen in vier Zielen. 1.) Eine individuumsze- ntrierte Perspektive auf die Schüler; 2.) die Teilhabe an der Gesellschaft mit entsprechenden Handlungskompetenzen ermöglichen; 3.) die Kooperation mit Eltern/ außerschulischen Partnern und potentiellen Arbeitgebern, was zu dem letzten Ziel 4.) der Vorbereitung auf das Berufsleben überleitet.
Darüber hinaus gibt es individuelle Unterschiede. So betont die Alber-Schweitzer-Schule III ihr internationales Schülerklientel und dass es an der Schule klare Regeln und Strukturen gibt. Die Pierre-Bourdieu-Schule nimmt das Ziel der Rückschulung mit auf und möchte das Selbstbe- wusstsein ihrer Schülerinnen fördern, indem sie unter anderem eine wertschätzende, respektvolle und unterstützende Erziehung praktiziert. Das könnte sich auf den Förderschulalltag auswirken. Die Heinrich-Hoffmann-Schule visiert an, Entwicklungsdefizite auszugleichen und individuelle Ressourcen zu berücksichtigen.
2.3.3 Inklusive Beschulung in Deutschland
Wie grenzt sich nun Inklusive Beschulung von der Beschulung an Förderschulen ab? Was kennzeichnet Inklusive Beschulung? Was ist das Ziel von Inklusiver Beschulung? Diese Fragen müssen für einen differenzierten Diskursüber ihre Möglichkeiten und Grenzen im Schlussteil beantwortet werden.
Inklusive Beschulung kennzeichnet folgende Haltung:
Inklusive Beschulung bedeutet das Willkommen Heißen von Heterogenität, welche als normale, reguläre Gegebenheit angesehen wird. Es gibt eine Schülergesamtheit, die viele Bedürfnisse teilt und die die gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse bildet. Alle Schüler haben dar-über hinaus aber auch noch individuelle Bedürfnisse, ohne das darauf mit Zuschreibungen reagiert wird und auf die genauso eingegangen wird. Es geht nicht darum, diese trennenden individuellen Eigenschaften mit den vielen gemeinsamen Bedürfnissen zu vereinen. Insofern stellt die Inklusive Beschulung eine Weiterentwicklung der integrativen Beschulung (vgl. Fußnote 3)dar, da sie zudem auch noch eine emanzipatorische und bürgerrechtliche Orientierung hat mit der inklusiven Gesellschaft als Vision. (vgl. Knauer, 2008, Hinz in Schnell/ Sander, 2004)
Bis eine Nicht-Aussonderung in Schulen und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen den Regelfall darstellt, die keine verschiedenen Pädagogiken mehr braucht, müsste theoretisch jedoch von Integrationspädagogik gesprochen werden. Mit der geschilderten Vision vor Augen und um eine Stringenz zu bewahren, wird hier jedoch dennoch immer von inklusiver Pädagogik, Inklusi- on und Inklusiver Beschulung als Ziel gesprochen. Auch wenn es nötig ist, bis dahin zunächst erstmal behinderte SchülerInnen zunächst einmal überhaupt zu integrieren statt auszusondern. (vgl. Eberwein, 1995, S.38)
Wie kann man sich Inklusive Beschulung aktuell konkret vorstellen?
Eine Inklusive Beschulung setzt folgende Rahmenbedingungen voraus:
Die Anzahl der Kinder in einer Klasse ist auf 22-24 Schüler ausgerichtet, von denen zwei bis vier Kinder einen Förderbedarf haben. Dieser wird von Sonderpädagogen und gegebenenfalls zusätzlichen Hilfskräften abgedeckt.
Die Anzahl der Stunden und die Förderung von einer zusätzlichen Kraft leitet sich aus den Vorgaben ab, wie viele extra Stunden einem Kind mit Förderbedarf an der Förderschule zustehen. Es gibt aber auch je nach Bundesland andere Handhabungen, wie dass jedes Kind, welchem ein Förderbedarf zugesprochen wird, eine pauschale Anzahl an zusätzlichen „Lehrerstunden“ erhält. Diese können dann je nach Bedarf flexibel eingesetzt werden.
Die finanziellen Mittel hierfür, sollen aus den Geldern, die bis dato in die „Exklusion“ investiert wurden, gestellt werden und darüber hinaus auch für die Fortbildungsmaßnahmen für die Pädagogen und ähnlichem zur Verfügung stehen.
Diese Art der Beschulung bringt auch eine andere Form des Unterrichts mit sich, wie die Absprache zwischen den Lehrern und Teamwork, eine differenziertere Ausrichtung des Unterrichts, der in der Lage ist, alle Schüler anzusprechen. Dazu gehören unterschiedliche Methoden des Vermittelns des Unterrichtsstoffs, divergente Lernziele, vielfältige Präsentationsweisen und eine an das Individuum ausgerichtete Bewertung. (vgl. Preuss-Lausitz, 2001, S. 217)
Wie sieht die momentane Entwicklung der Inklusiven Beschulung in der BRD aus?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-1: Bildungsbarometer Inklusion
Quelle: Sozialverband Deutschland, http://www.sovd.de/1565.0.html, 2011
Es wird ersichtlich, dass es Unterschiede in den Integrationsbemühungen der Länder gibt. Diese divergierten 2009 zwischen mindestens 40% Inklusiver Beschulung in Schleswig-Holstein und Berlin und knappen 10% in Niedersachsen. Der teils mangelnde Wille zur Inklusiven Beschulung spiegelt sich nicht nur in den in der Abbildung dargestellten Zahlen wieder, sondern auch in den gesetzlichen Neuregelungen, die teilweise gar nicht mal angedacht werden, auch unter der Argumentation die Behindertenkonvention sei Auslegungssache. Hierunter fällt zum Beispiel der in vielen Landesschulgesetzen festgeschriebene Vorbehalt, dass eine Regelschule ein Kind mit einer Behinderung nicht annehmen muss, wenn besonders geschulte Lehrkräfte fehlen oder die Räumlichkeiten für Fördermaßnahmen fehlen und ähnliches.
So wird sich in einigen Ländern mit der Thematik befasst, aber dies unter dem Wunsch alles beim alten zu belassen, trotz der Erkenntnisse der Wissenschaftler, dass die Förderschule nicht förder- lich ist. (vgl. Sozialverband Deutschland, 2004-2011, vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.2.2 sowie die Empi- rie von Förderschulen unter 2.4, vgl. Anja Heinrich, Landtagsabgeordnete der CDU Brandenburg sowie Gordon Hoffmann, bildungspolitischer Sprecher der CDU Landtagsfraktion Brandenburg im Gespräch: http://www.ee-fernsehen.de/archiv/Inklusive_Beschulung-1971.html)
2.3.4 Beschulung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten im europäischem Raum
Jetzt soll die Frage beantwortet werden, wie im europäischen Raum die Beschulung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten verläuft.
Im europäischen Vergleich lassen sich drei Möglichkeiten der Art der Förderung von von einer Behinderung betroffenen Subjekten feststellen:
Es gibt Länder mit einem Einheitssystem, sprich mit inklusiver Beschulung. Hierunter fallen Griechenland, Island, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien sowie Zypern.
Darüber hinaus finden sich Länder, in denen integrative Förderpädagogik stattfindet, das heißt in Abhängigkeit zum Ausmaß des Unterstützungsbedarfes entsprechend voll- oder teilintegrativ. Zu den Ländern zählen: Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Slowakei, Slowenien und Tschechien.
Und zu guter Letzt gibt es Länder, die die Förderung in separaten Institutionen festlegen und wo gesetzlich separiert wird, wie in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und auch der Schweiz.
Erfreulicherweise scheut man nicht davor zurück, die verschiedenen Arbeitsweisen - auch wenn sie in verschiedenen strukturellen Begebenheiten sich abspielen mögen - füreinander fruchtbar zu machen. So gibt es die „european agency“, die genau dies als Vorsatz hat. (http://www.european-agency.org/country-information/germany/general-information)
Zu bedenken ist jedoch immer, dass damit nicht geklärt ist, was sich tatsächlich konkret unter diesen Subsumierungen (voll-, teilintegrativ oder im Rahmen einer segregativen Organisations- form) vor Ort abspielt - was letztendlich dann erst über die Qualität entscheidet. Ein Etiketten- wechsel, im Sinne eines rhetorischen Fortschritts ohne die Umsetzung des mit diesem Etikett assoziierten Inhalts, ist selbstverständlich kein Fortschritt. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.56-58) So ist in Deutschland beispielsweise Sonderschulbedürftigkeit durch sonderpäda- gogischen Förderbedarf (der sich nicht mehr an das medizinische Modell anlehnt) ersetzt wor- den. Allerdings hat sich auch hier im Alltag etabliert, dass der Förderbedarf mit einer Eigenschaft des Kindes gleichgesetzt wird, wenn zum Beispiel von Lernhilfekindern gesprochen wird. Somit kommt es trotz geänderter Terminologie zu Perspektiven und Praktiken, die sich an das medizi- nische Modell anlehnen. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.54f.)
Hingegen ist die Veränderung der Terminologie von Lernbehinderung hin zu Beeinträchtigung im (schulischen) Lernen, auf Empfehlung der Kultusministerkonferenz in den Schulen der Bun- desrepublik Deutschland seit 1994 festgeschrieben, positiv zu bewerten. Eine individualisierende Perspektive zu Gunsten einer Perspektive, die kontextuelle Aspekte, die zu einer Lernstörung geführt haben, mitberücksichtigt, verhindert eine Verknüpfung an eine spezifische Förderung auf Förderschulen. (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2006, S.20f.)
2.4 Die Empirie von Förderschulen
Leider gibt es explizit zum selben Forschungsdesign wie es meiner Diplomarbeit zugrunde liegt, welches auf die empirische Datengewinnung an der Förderschule aus intersektionaler Perspektive abzielt, auf Basis meiner Recherche keinerlei Untersuchungen. Dies stellt sich auch unabhängig vom Förderschwerpunkt in dieser Art und Weise dar. Das heißt ich befinde mich auf neuem Terrain.
Das wiederum bietet den Vorteil von möglicherweise neuen Erkenntnissen aufgrund des innovativen Vorgehens.
Ziel dieses Abschnitts wird es sein, die in diesem Forschungsfeld schon getätigten Anstrengungen und entsprechenden Errungenschaften in Form von empirischen Daten und daraus resultierenden theoretischen Erkenntnissen darzustellen. Diese können dann bei der Datenerhebung von großem Nutzen sein. So schult das theoretische Hintergrundwissen die Wahrnehmung für Phänomene wie Handlungsroutinen, Einstellungen von Lehrern, Schülern und Eltern, in der Schule vorherrschende Normen und Werte, Identitätskonstruktionen, Strukturen und vielem mehr. Mit Hilfe des bereits vorhandenen theoretischen Hintergrundwissens können die eigenen empirischen Daten besser interpretiert werden und in Kontrast zu bereits vorhandenen empirischen Erkenntnissen gesetzt werden. (Kelle/Kluge, 1999, S.108)
Die Untersuchungen, die ich ausgewählt habe, setzen sich mit vier verschiedenen Problematiken, die mit der Förderschule einhergehen, auseinander.
Es handelt sich erstens um Hans Wockens empirische Rundreise durch Schulen für „optimale Förderung“, bei der die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Kontext sozialer Ungleichheit untersucht wurde.
Zweitens um die Studie der Bertelsmann Stiftung, die die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen unter Effizienzkriterien beforschte.
Drittens um Uwe Bittlingmayers, Jürgen Gerdes und Diana Sahrais empirische Befunde aus der begleitenden Evaluationsforschung des Vorbild-Projekts, als auch aus der ungleichheitsorientierten Bildungsforschung, um aufzuzeigen, dass FörderschülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen sehr wohl eine relevante Zielgruppe für politische Bildung darstellen.
Viertens um Lisa Pfahls Untersuchung, die der Frage nachging, wie sich die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf das berufsbiographisches Handeln ihrer Absolventen auswirkt und ob Job-Coaching die prekäre Situation für die Subjekte und damit verbundene Identitätsbedrohungen beheben oder zumindest mindern kann.
Sowie fünftens um die Untersuchung Bettina Bretländers: Sie beforschte die Fragestellungen, wie der Lebensalltag körperbehinderter Mädchen/junger Frauen aussieht und wie ihre Identitätsarbeit dadurch geprägt ist.
Alle Untersuchungen stehen in engem Zusammenhang zu meinen Fragestellungen. Das heißt der Fragestellung nach den Diskriminierungsprozessen, der die Förderschule unterlegen ist (beson- ders Wocken, Bittlingmayer, Sahrai und Gerdes), der Fragestellung, wie der Alltag durch die För- derschülerInnen erlebt wird und sich in ihren Beschreibungen über die Schule zeigt (besonders Bittlingmayer, Sahrai und Gerdes, Pfahl, Bretländer) und der Fragestellung, ob integrati- ve/inklusive Beschulungförderlicher wäre (besonders Bertelsmann Stiftung, Pfahls und Bretlän- ders Untersuchung).6
Die ausgewählten Untersuchungen, die unter ausführlicher Recherche die wenigen waren, die zu Rate gezogen werden konnten, sind, bis auf die Untersuchung Bretländers, auf die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ausgerichtet. Das ist auffällig und wird in Punkt 2.1.6 in den zusammenfassenden Überlegungen Berücksichtigung finden.
Dennoch spiegeln die Untersuchungen zusammengenommen eine Breite an Möglichkeiten wider, sich mit dem deutschen Bildungssystem und einhergehenden Problemen, die sich im Förderschulkontext darstellen, auseinanderzusetzen.
2.4.1 Hans Wocken
Hans Wocken hat seine Studie, aufgrund der von vielen Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen auf ihren Homepages postulierten optimalen Förderung, die es dort zu bieten gäbe, der Fragestellung gewidmet, ob diese denn so überhaupt existent sei. (Wocken in DemmerDieckmann/Textor, 2007, S.35)
Zur Basis hat die Beantwortung der Fragestellung die empirischen Daten aus folgenden Forschungsprojekten:
Lauf HH (Lernausgangslage an Förderschulen) - 1999 an allen Förderschulen der Jahrgangsstufe 7 in Hamburg durchgeführt.
Lauf B (Lernausgangslage an Förderschulen in Brandenburg) - 2004 in Jahrgangsstufe 7 in Bran- denburg in Form einer repräsentativen, kriteriengeleiteten Stichprobe durchgeführt. Als empirische Vergleichbasis dient LAU 5 (Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung), ein in allen Jahrgangsstufen 5 an allgemeinbildenden Schulen Hamburgs durchgeführtes Evaluations- projekt.
Sowie das Forschungsprojekt Kess.if (KESS in Förderschulen) - 2005 in Jahrgangsstufe 7 an allen Förderschulen in Hamburg durchgeführt. Hier dient als empirische Vergleichsbasis KESS 4 - ein Grundschulprojekt. (a.a.O. S.36f.)
Des Weiteren bezieht Wocken die Ergebnisse Haeberlins (Haeberlin 1989, 390; Haeberlin u.a. 1999) und Tents (Tent u.a. 1991a, 329; Tent u.a. 1991b) mit ein, die bereits in ihren Forschungen herauskristallisiert haben, dass schulleistungsschwache Schüler an Regelschulen besser abschneiden als an Förderschulen.
Wocken folgert zunächst, dass wenn behauptet wird, die Förderschule fördere optimal, sie eine Schule sein sollte, die ihr Klientel nicht nach Kriterien bestimmt, wie Klasse, Rasse und/oder Geschlecht (vgl. Punkt 2 Intersektionaler Ansatz). (Wocken in Demmer-Dieckmann/Textor, 2007, S.37f.)
Daher untersucht er zunächst diese Fragestellung. Seine Argumentation unterstreicht er mit den Paragraphen aus den Schulgesetzen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg, die genau dieses postulieren. Darüber hinaus mit Art. 3, Absatz 2 des Grundgesetzes, der eine Gleichberechtigung der Geschlechter vorsieht. Des Weiteren mit Art. 3, Absatz 3 des Grundgesetzes, der postuliert, dass niemand wegen „ (..) seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf.“
Des Weiteren Art. 7, Absatz 4 des Grundgesetzes, wonach Ziel der Errichtung von Schulen nicht sein sollte, Schüler nach Besitzverhältnissen der Eltern zu separieren. (vgl. a.a.O. S.37,39,41,44)
Er kommt zu dem Ergebnis, dass an den untersuchten Förderschulen eine Überrepräsentanz von Jungen herrscht. In Brandenburg beispielsweise 63,2% Jungen, zu 36,8% Mädchen.
Des Weiteren finden sich an den untersuchten Förderschulen übermäßig viele Kinder mit Migrationshintergrund. Wocken stellte beispielsweise fest, dass in Hamburger Förderschulen nur 50% der Schüler „fast immer deutsch sprechen“ - an Gymnasien hingegen 80%.
An Förderschulen befinden sich darüber hinaus viele Kinder mit vielen Geschwistern, nämlich im Durchschnitt 2,7. Zum Vergleich haben Gymnasiasten im Schnitt 1,2 Geschwister. Die sozi- 28
alkulturelle Lage ist außerdem gekennzeichnet von höherem Fernsehkonsum. So schauen 30% der Förderschüler in Hamburg und Brandenburg über drei Stunden Fernsehen am Tag. Bei den Gymnasiasten hingegen nur 3%. Auch der Bücherbestand divergiert. Von den Eltern der unter- suchten Förderschüler haben nur 10% 200 Bücher und mehr, bei Gymnasiasten sind es 60%.
Auf den untersuchten Förderschulen sind überproportional viele Kinder aus Familien, die von Erwerbslosigkeit gekennzeichnet sind. 28% der Väter der Hamburger Förderschüler sind arbeitslos. 80% sind Arbeiter. Bei der Frage nach dem Verdienst pro Jahr gehören 27% der Förderschulfamilien zur untersten Erwerbsgruppe von unter 20.000 Euro im Jahr. Gesamtgesellschaftlich sind es hingegen nur 12%, die ein so geringes Einkommen haben.
Wocken merkt kritisch an, dass nun nicht daraus zu folgern wäre, dass die Förderschule diese Ungleichheiten hervorgerufen hat. Hier leuchten allerdings die strukturellen Mängel des gesamten Bildungssystems massiv auf. (vgl. Punkt 1.2 und 2.2)
Zu der Fragestellung, ob die Förderschule optimal fördert, stellt er zunächst einleitend fest, dass sodann eine Leistungssteigerung proportional zur Länge des Schulbesuchs zu vermuten wäre. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wie folgende empirische Erkenntnis aufgezeigt: „Je länger die Schüler eine Förderschule besuchen, desto schlechter sind ihre orthographischen Leistungen.“ (Wocken, 2007, S.50). Gleiches gilt für den Intelligenzquotient der Schüler. Auch dieser fällt line- ar ab, proportional zur Länge der Verweildauer und entsprechender Förderung auf der Förder- schule. (vgl. Wocken, 2007, S.52) (vgl. eigene Forschungsergebnisse Gruppeninterview 2, indem genau diese Problematik die Schüler selber ansprechen, nämlich die, dass sie hinter den anderen Schülern auf den anderen Schulzweigen abfallen: 00:04:08-6 00:04:46-3, 00:05:46-00 - 00:06:04-9). Der Zusammenhang zwischen schlechterer Rechtschreibung proportional zur Verweildauer in der Förderschule ist durch den Zusammenhang von Intelligenzquotient proportional zur Ver- weildauer auf der Schule aufzuschlüsseln. Die Schüler, die frühzeitig auf die Förderschule über- wiesen wurden und dort entsprechend lange verbleiben, weisen eine ungünstigere intellektuelle Ausstattung auf, sind also von vorneherein schwächer als die, die dort später und/oder kürzer hin verwiesen werden. Daher sind auch ihre Rechtschreibleistungen schlechter als die Recht- schreibleistungen derer, die dort kürzer gefördert werden und mit einem höheren Intelligenzquo- tienten dorthin überwiesen wurden.
Bei dem Vergleich zwischen dem IQ-Wert bei Eintritt in die Förderschule und Austritt aus selbiger lässt sich eine Stagnation des ursprünglichen Werts feststellen, auch bei langem Aufenthalt in der Förderschule.
[...]
1 In dieser Diplomarbeit werden die Termini Sonderschule, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, Förderzent- rum und Förderschule als inhaltlich identisch aufgefasst. (vgl. Lücking/ Reichenbach, 2009, S.27-29) Die Begriffe Förderschule und sonderpädagogischer Förderbedarf werden jedoch hier präferiert, weil sie von der Semantik her ein weniger ausgrenzendes Potential haben als Sonderschule (aussondern) und weil sonderpädagogischer Förderbedarf nicht an eine Förderschule gebunden ist. (vgl. Boban/Hinz in Opp/Theunissen, 2009, S.54f, Kul- tusministerkonferenz, 1994, S.2) Die Förderschulen haben unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die auch was ihre Bezeichnung angeht nach Ländern divergieren. In Baden-Württemberg wird beispielsweise unter „ Förderschule “ eine Schule für lang andauernde Lernprobleme und Entwicklungsverzögerungen verstanden. (vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg, vgl. Kul- tusministerkonferenz, 1994, S.2, vgl. Punkt 2.3.) Hier besteht meiner Einschätzung nach eine große Gefahr eines Sammelbeckens für nicht passgenaue Subjekte, die aufgrund sozialer Ungleichheit unter dem unspezifischen Vorwand „lern behindert“, auf die Förderschule für lang andauernde Lernprobleme und Entwicklungsverzögerungen verwiesen werden (vgl. Einleitung, Hilfsschule in Punkt 2.1., Mechanismen der institutionellen Diskriminierung in Punkt 3.2.) Die zu beforschende Schule befindet sich in Baden-Württemberg und ist eine solche Förderschule - entsprechend wird ein etwas größeres Augenmerk auf dieser Schulform liegen. Dennoch sollen alle Förderschulen, egal mit welchem Schwerpunkt, Berücksichtigung finden, da die Institution als Ganzes stigmatisiert wird und alle Subjekte, egal mit welcher Behinderung, stigmatisiert werden. Der Begriff Förderschule wäre sodann zweimal besetzt. Das heißt ich werde also, um Verwirrungen von vorneherein auszuschließen, mit den Begrifflichkeiten Förderschule (alle Sonderschulformen) und Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Förderschule Baden-Württemberg) arbeiten.
2 Die Heilpädagogik ist das Spezialgebiet der Pädagogik, welches sich mit der Erziehung und Förderung behinderter Subjekte befasst.lHier synonym gebraucht zu den Termen „Sonderpädagogik“ oder „Pädagogik der Behinderten“, die jedoch Schwächen mit sich bringen: Sonderpädagogik - Problematik aussondern, Pädagogik der Behinderten - Problem Fokus auf organische Ursache sowie Generalisierung bzw. keine Differenzierung nach Art der Behinderung. (vgl. Haeberlin, 2005, S.18-20)
3 Integrative Beschulung bedeutet in der Pädagogik das Einbinden von Menschen mit Behinderungen in den Schulunterricht von Nichtbehinderten. (vgl. Knauer, 2008)
4 Albert- Schweitzer -Schule III, 2011
5 Heinrich Hoffmann Schule, 2011
6 Zu der Frage ob inklusive Beschulung förderlicher wäre, vgl. auch Punkt 2.3.3 und Kapitel 5.
Details
- Titel
- Die Förderschule aus intersektionaler Perspektive. Theorie und Empirie einer stigmatisierten Institution
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Institut für Soziologie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Nadja Tilscher (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 240
- Katalognummer
- V209436
- ISBN (eBook)
- 9783656371212
- ISBN (Buch)
- 9783656371441
- Dateigröße
- 1745 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Inklusion Förderschule Intersektionaler Ansatz UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen institutionelle Diskriminierung Diskriminierung Pierre Bourdieu
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 45,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Nadja Tilscher (Autor:in), 2012, Die Förderschule aus intersektionaler Perspektive. Theorie und Empirie einer stigmatisierten Institution, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/209436
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-