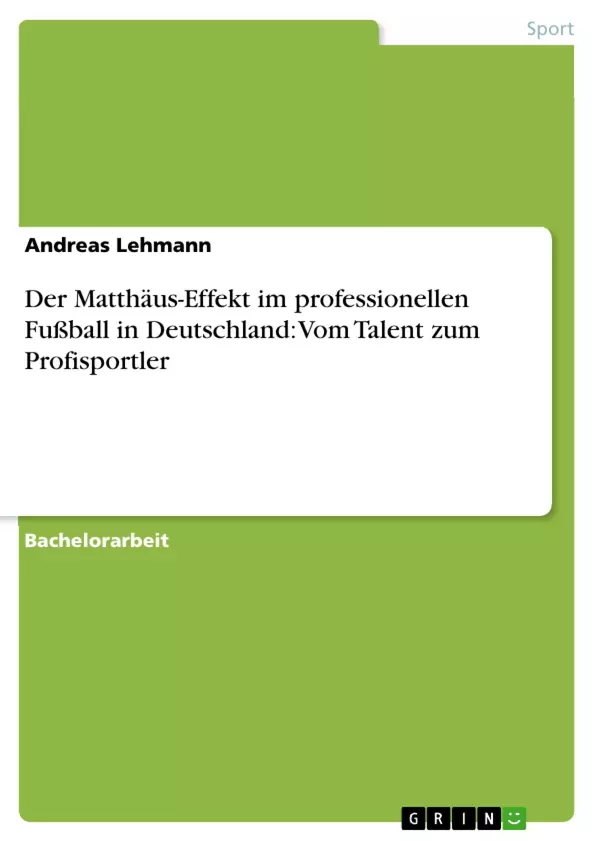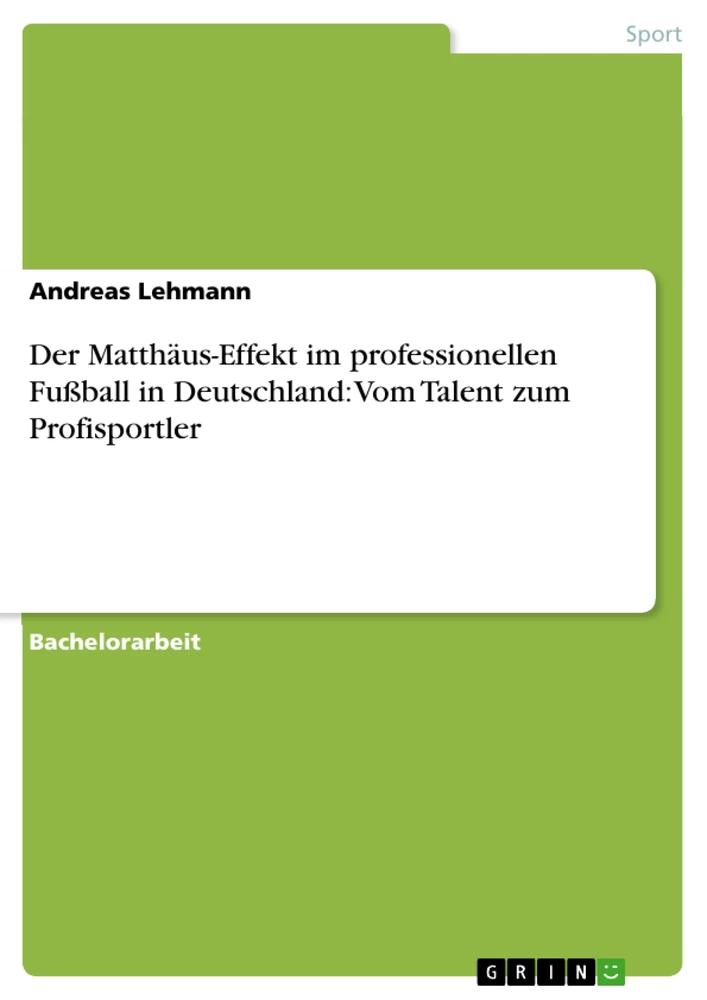
Der Matthäus-Effekt im professionellen Fußball in Deutschland: Vom Talent zum Profisportler
Bachelorarbeit, 2011
52 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Matthäus-Effekt
2.1 Der Matthäus-Effekt in der Technologie
2.2 Der Matthäus-Effekt in der Wirtschaft
2.3 Der Matthäus-Effekt in der Politik
2.4 Der Matthäus-Effekt in Organisationen
3. Der Relativalterseffekt
3.1 Allgemeine Grundlagen
3.2 Faktoren und Mechanismen des Relativalterseffekts
3.3 Determinanten des Relativalterseffekts
3.4 Auswirkungen des Relativalterseffekts
4. Karriere in Organisationen
4.1 Relative Leistungsturniere
4.2 Probleme von Leistungsturnieren
4.3 Anreizwirkungen von Leistungsturnieren
5. Selektionskriterien im Sport
5.1 Ausbildungskonzept des Deutschen Fußball-Bundes
5.2 Talentselektion des Deutschen Fußball-Bundes
6. Hypothesen für das Auftreten des Relativalterseffekts
6.1 Der Relativalterseffekt im professionellen Fußball in Deutschland
6.2 Unterschiede des Relativalterseffekts in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga
6.3 Unterschiede der Feldspieler in Größe und Gewicht
7. Empirischer Teil
7.1 Beschreibung des Datensatzes
7.2 Beschreibung der Methodik
7.3 Auswertung des Datensatzes
7.3.1 Der Relativalterseffekt in der Bundesliga
7.3.2 Unterschiede zwischen den Bundesligen
7.3.3 Körperliche Unterschiede nach Positionen
7.3.3.1 Anforderungsprofile der Mannschaftsteile
7.3.3.2 Größenunterschiede nach Positionen
7.3.3.3 Gewichtsunterschiede nach Positionen
8. Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Details
- Titel
- Der Matthäus-Effekt im professionellen Fußball in Deutschland: Vom Talent zum Profisportler
- Hochschule
- Universität Augsburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Andreas Lehmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V209554
- ISBN (eBook)
- 9783656374923
- ISBN (Buch)
- 9783656375692
- Dateigröße
- 1306 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Relativalterseffekt Profi-Fußball Bundesliga Sportökonomie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- Andreas Lehmann (Autor:in), 2011, Der Matthäus-Effekt im professionellen Fußball in Deutschland: Vom Talent zum Profisportler, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/209554
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-