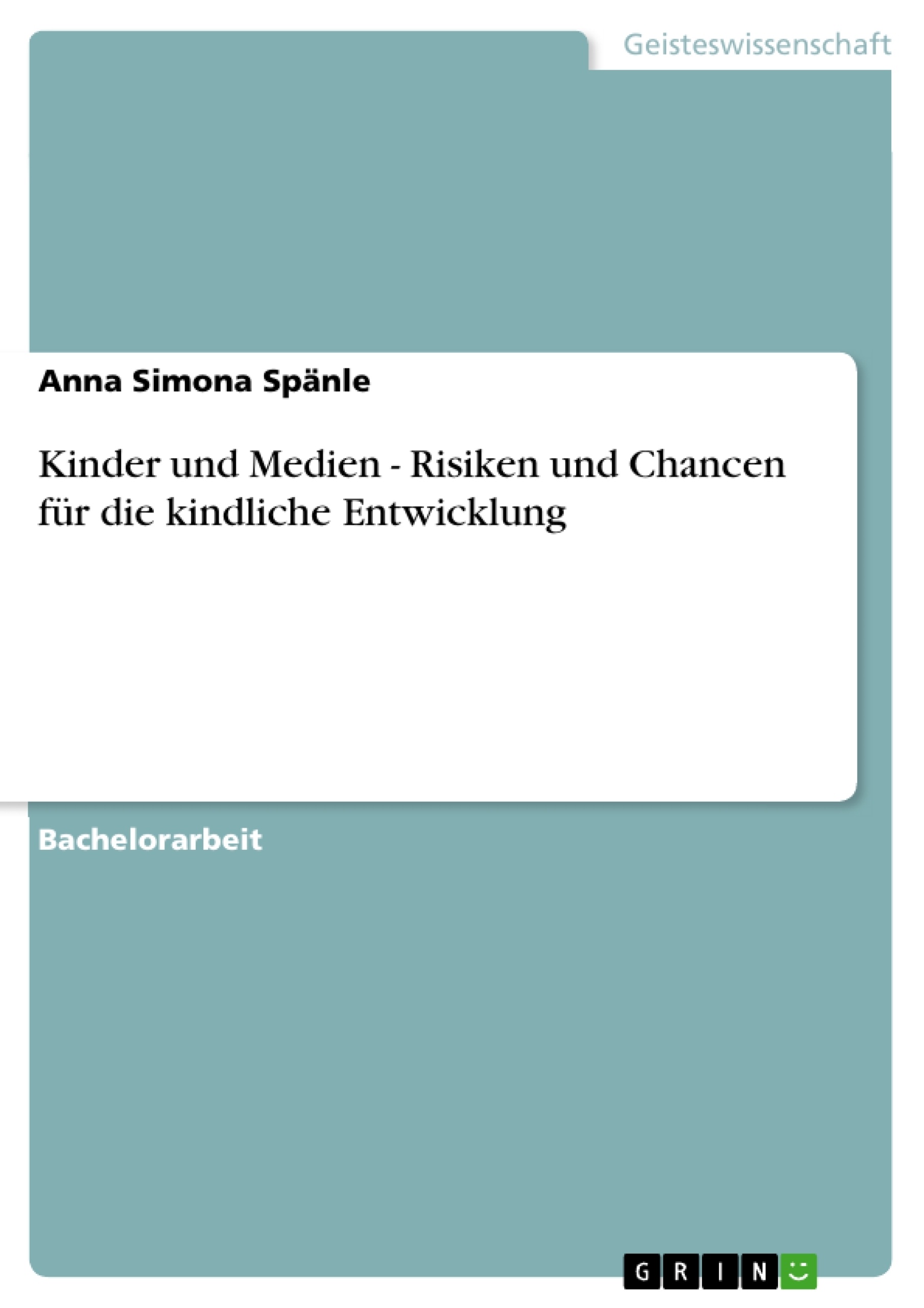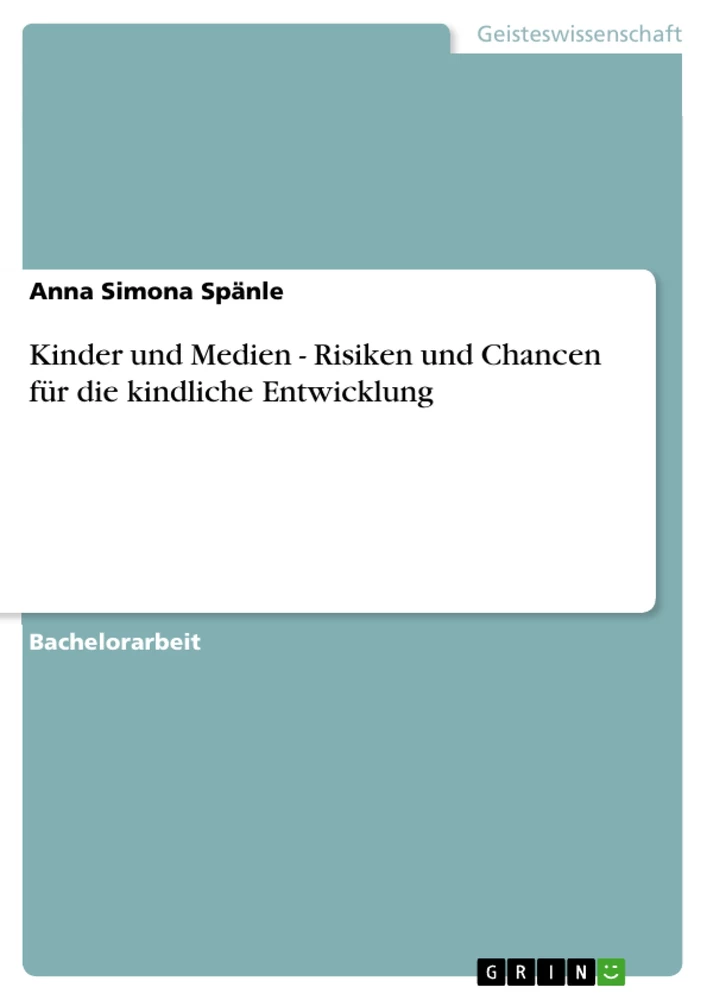
Kinder und Medien - Risiken und Chancen für die kindliche Entwicklung
Bachelorarbeit, 2011
49 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Zur Aktualität und Relevanz des Themas
1.1 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
2 Exkurs: Begriffserklärung
3 Die KIM-Studie
3.1 Welche Medien gibt es?
3.2 Medienausstattung und Medienbesitz
3.3 Welche Medien werden am häufigsten genutzt?
3.4 Medienbindung
4 Aktueller Stand der Kinder- und Jugendmedienforschung
4.1 Forschungslücken
5 Medienwirkungsforschung
5.1 DerForschungsgegenstand'Medienwirkung'
5.2 Beispiele für Medienwirkungen und aktueller Forschungsstand
6 Gefahren vonMedien
6.1 Gewalt in den Medien
6.1.1 Gewalt im Internet und am Computer
6.1.2 Gewalt im Fernsehen
6.2 Mediensucht
6.2.1 Computer- und Internetsucht
6.2.2 Femsehsucht
7 Chancen von Medien
7.1 Bildungsfemsehen,ein Definitionsversuch
7.1.1 FLIMMO-Kinderbefragung
7.1.2 FLIMMO-Kinderbefragung zum Thema Informations- und Wissenssendungen
7.2 Computer- und Videospiele
7.3 Profitieren vom Internet
8 Auswirkungen von Medien auf die Entwicklung
8.1Die kognitive Entwicklung
8.2 Die emotionale Entwicklung
8.3 Die moralische Entwicklung
8.4 Die körperliche Entwicklung
9 Jugendmedienschutz
9.1 FSK - Freiwillige Kontrolle der Filmwirtschaft
9.1.1 Wie werden die FSK-Freigaben festgelegt?
9.2 USK - Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
9.2.1 Wie entstehen Alterskennzeichnungen bei der USK?
9.3 PEGI - Pan European Game Information
9.4 Jugendmedienschutz im Internet
10 Schlussbetrachtung
10.1 Perspektive
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Medien den Alltag von Kindern heute?
Elektronische Medien sind zu einer starken Konkurrenz für klassische Erziehungsinstanzen geworden und vermitteln Weltanschauungen, Bildung und Unterhaltung.
Was ist die KIM-Studie?
Die KIM-Studie (Kinder, Internet, Medien) untersucht regelmäßig die Medienausstattung, den Medienbesitz und das Nutzungsverhalten von Kindern.
Welche Gefahren gehen von Medien aus?
Die Arbeit thematisiert insbesondere Gewaltinhalte im Fernsehen und Internet sowie das Risiko der Mediensucht (Computer-, Internet- und Fernsehsucht).
Bieten Medien auch Bildungschancen?
Ja, Bildungsfernsehen, Informationssendungen sowie Lernpotenziale des Internets und bestimmter Computerspiele werden als Chancen für die Entwicklung aufgeführt.
Wie funktioniert der Jugendmedienschutz in Deutschland?
Die Arbeit erläutert die Rollen der FSK (Film), USK (Software/Spiele) und PEGI sowie den Jugendmedienschutz im Internet.
Welche Entwicklungsbereiche werden durch Medien beeinflusst?
Medien haben Auswirkungen auf die kognitive, emotionale, moralische und körperliche Entwicklung von Kindern.
Details
- Titel
- Kinder und Medien - Risiken und Chancen für die kindliche Entwicklung
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Veranstaltung
- Soziale Arbeit
- Note
- 2,0
- Autor
- Anna Simona Spänle (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V210722
- ISBN (eBook)
- 9783656418740
- ISBN (Buch)
- 9783656419020
- Dateigröße
- 708 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kinder medien risiken chancen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- Anna Simona Spänle (Autor:in), 2011, Kinder und Medien - Risiken und Chancen für die kindliche Entwicklung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/210722
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-