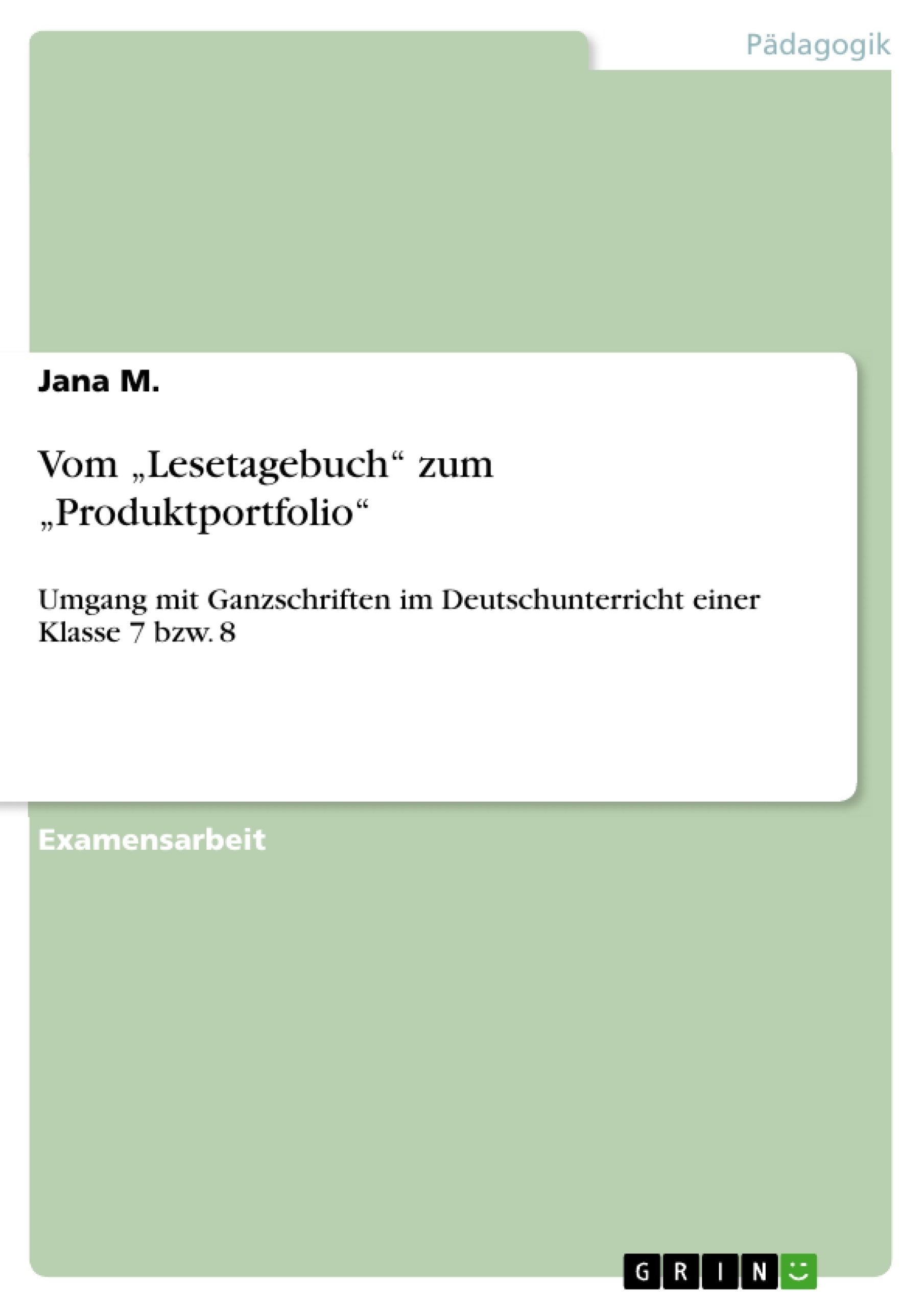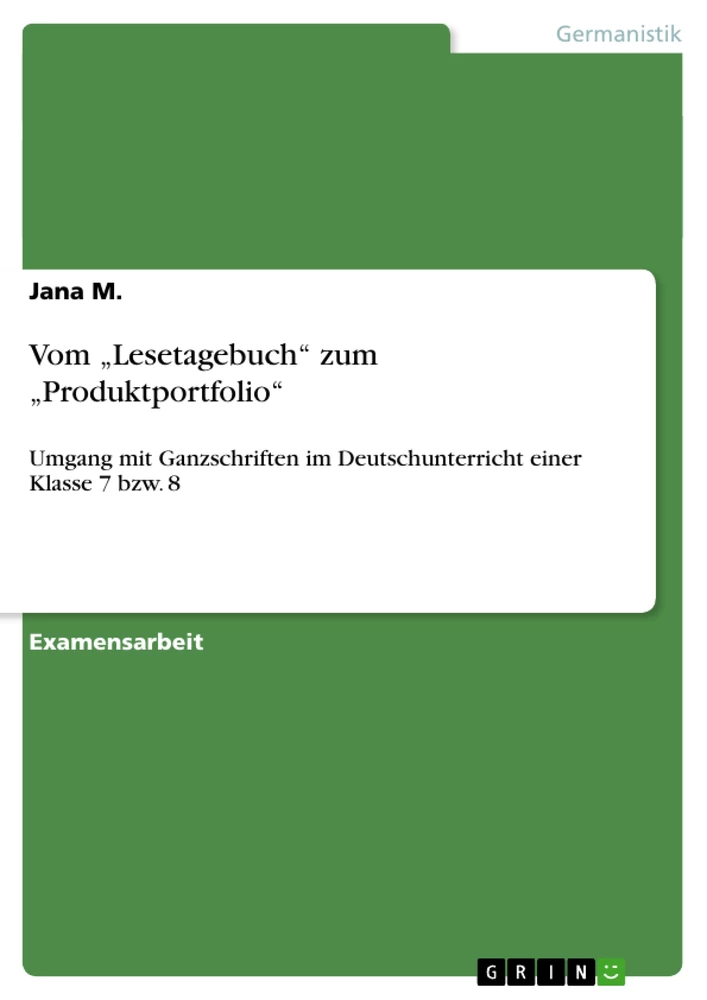
Vom „Lesetagebuch“ zum „Produktportfolio“
Examensarbeit, 2008
48 Seiten, Note: 1,7
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung des Problems
- 2.1 Problembezogene Lerngruppenbeschreibung
- 2.2 Darstellung der Ausgangslage und Benennung des Problems
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1. Die Methode des Lesetagebuchs
- 3.1.1 Geschichtliche Entwicklung der Methode des Lesetagebuchs
- 3.1.2 Definition der unterschiedlichen Formen des Lesetagebuchs
- 3.1.3 Begründete Entscheidung für die Wahl einer Form des Lesetagebuchs
- 3.2 Zum Begriff der Motivation und seine Bedeutung für die Arbeit mit Lesetagebüchern
- 3.3 Leistungsbewertung in Form von Lesetagebüchern
- 3.1. Die Methode des Lesetagebuchs
- 4. Praktische Umsetzung
- 4.1 Konzeptionelle Überlegungen zur geplanten Durchführung
- 4.2 Durchführung des Unterrichtsvorhabens
- 4.2.1 Unterrichtsverlauf
- 4.2.2 Dokumentation der Durchführung anhand exemplarischer Schülertexte
- 5. Evaluation und Reflexion
- 6. Perspektiven für die Weiterarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Methode des Lesetagebuchs, genauer des Prozessportfolios, als begleitende Maßnahme beim Lesen von Ganzschriften im Deutschunterricht der Klassen 7 und 8. Ziel ist es, die Wirksamkeit dieser Methode hinsichtlich der Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenzen sowie der Steigerung der Schülermotivation zu überprüfen. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen des Lesetagebuchs, die Rolle der Motivation im Lernprozess und die Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Kontext dieser Methode.
- Wirksamkeit des Lesetagebuchs (Prozessportfolio) zur Verbesserung von Lese- und Schreibkompetenzen
- Motivationssteigerung durch individuelle und kreative Auseinandersetzung mit dem Text
- Alternative Leistungsbewertung durch das Lesetagebuch
- Vergleich verschiedener Formen des Lesetagebuchs
- Analyse der Schülerreaktionen und -ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Problem der sinkenden Lese- und Schreibkompetenzen bei Schülern und stellt die Forschungsfrage nach der Eignung des Lesetagebuchs zur Verbesserung dieser Kompetenzen und zur Steigerung der Motivation. Die Arbeit gliedert sich in die Darstellung des Problems, die theoretischen Grundlagen, die praktische Umsetzung, Evaluation und Reflexion sowie Perspektiven für die Weiterarbeit.
2. Darstellung des Problems: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe (Klasse 8a) und deren spezifische Herausforderungen. Es benennt das Problem der geringen Motivation der Schüler beim Lesen des Dramas "Wilhelm Tell" und die Heterogenität der Lesekompetenzen. Die vorherige positive Erfahrung mit dem Lesetagebuch beim Lesen von "Krabat" motiviert die Autorin zur erneuten Anwendung der Methode, diesmal in einer modifizierten Form, angepasst an die spezifischen Herausforderungen des Dramas.
3. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Lesetagebuchs, differenziert zwischen verschiedenen Formen (Tagebuch, Portfolio, Arbeitsjournal) und begründet die Wahl einer kombinierten Form aus Tagebuch und Prozessportfolio für die Unterrichtsreihe zu "Wilhelm Tell". Es werden außerdem theoretische Grundlagen zur Motivation und Leistungsbewertung im Kontext des Lesetagebuchs erörtert. Die Autorin diskutiert die Bedeutung der intrinsischen und extrinsischen Motivation und die Herausforderungen der Leistungsbewertung bei einer so offenen Methode.
4. Praktische Umsetzung: Das Kapitel beschreibt die konzeptionellen Überlegungen zur praktischen Umsetzung des Unterrichtsvorhabens. Es wird der Ablauf der Unterrichtsstunden in drei Phasen (Einstieg, Erarbeitung, Evaluation) skizziert, und exemplarische Schülerarbeiten werden analysiert. Die Autorin schildert die Schülerreaktionen auf die Methode, die Herausforderungen bei der Benotung und die verschiedenen Formen der Schülerbearbeitung (deskriptiv-dokumentarisch, imaginativ-identifikatorisch, kommunikativ-metakognitiv).
5. Evaluation und Reflexion: Dieses Kapitel wertet die Ergebnisse der Unterrichtsreihe aus. Es wird festgestellt, dass das Prozessportfolio zu einem besseren Textverständnis und einer Steigerung der Motivation geführt hat. Die Autorin reflektiert die Schwierigkeiten bei der Bewertung der Schülerarbeiten und das Spannungsverhältnis zwischen individueller Ausdrucksform und objektiver Bewertung.
6. Perspektiven für die Weiterarbeit: In diesem Kapitel werden Schlussfolgerungen gezogen und Perspektiven für die zukünftige Anwendung der Methode aufgezeigt. Die Autorin betont die Bedeutung des Lesetagebuchs als Lektürebegleiter und empfiehlt, auf eine explizite Leistungsbewertung zu verzichten, um die Schüler in ihrer individuellen Auseinandersetzung mit dem Text nicht zu behindern.
Schlüsselwörter
Lesetagebuch, Prozessportfolio, Motivation, Lese- und Schreibkompetenz, Leistungsbewertung, Ganzschrift, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Wilhelm Tell, Otfried Preußler, Krabat, Drama, Jugendroman, Textverständnis, Schülertexte, Kooperatives Lernen, Binnendifferenzierung.
Häufig gestellte Fragen zum Lesetagebuch im Deutschunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Lesetagebuchs, genauer des Prozessportfolios, als Methode zur Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenzen sowie der Motivation von Schülern der Klassen 7 und 8 beim Lesen von Ganzschriften. Im Fokus steht der Einsatz dieser Methode beim Lesen von "Wilhelm Tell" und ein Vergleich mit vorherigen Erfahrungen mit "Krabat".
Welche Methode wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Lesetagebuch, genauer gesagt eine Kombination aus Tagebuch und Prozessportfolio. Es werden verschiedene Formen des Lesetagebuchs differenziert und die Vor- und Nachteile diskutiert. Die Wahl der konkreten Methode wird begründet.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Hauptziele sind die Überprüfung der Wirksamkeit des Lesetagebuchs zur Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenzen und die Untersuchung seiner Wirkung auf die Schülermotivation. Es wird analysiert, ob das Lesetagebuch zu einem besseren Textverständnis führt und ob es die Schüler zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Text anregt.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Lesetagebuchs, untersucht verschiedene Formen (Tagebuch, Portfolio, Arbeitsjournal) und diskutiert die Bedeutung von intrinsischer und extrinsischer Motivation im Lernprozess. Zusätzlich werden theoretische Aspekte der Leistungsbewertung im Kontext des Lesetagebuchs erörtert.
Wie wurde die Methode in der Praxis umgesetzt?
Die praktische Umsetzung wird in drei Phasen (Einstieg, Erarbeitung, Evaluation) beschrieben. Der Ablauf der Unterrichtsstunden wird skizziert, und exemplarische Schülerarbeiten werden analysiert, um verschiedene Bearbeitungsformen (deskriptiv-dokumentarisch, imaginativ-identifikatorisch, kommunikativ-metakognitiv) aufzuzeigen. Die Schülerreaktionen und die Herausforderungen bei der Benotung werden ebenfalls thematisiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Evaluation zeigt, dass das Prozessportfolio zu einem besseren Textverständnis und einer Steigerung der Motivation geführt hat. Die Schwierigkeiten bei der Bewertung der Schülerarbeiten und das Spannungsverhältnis zwischen individueller Ausdrucksform und objektiver Bewertung werden reflektiert.
Welche Schlussfolgerungen und Perspektiven werden aufgezeigt?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Bedeutung des Lesetagebuchs als Lektürebegleiter und empfiehlt, auf eine explizite Leistungsbewertung zu verzichten, um die Schüler in ihrer individuellen Auseinandersetzung mit dem Text nicht zu behindern. Es werden Perspektiven für die zukünftige Anwendung der Methode aufgezeigt.
Welche Lerngruppe wurde untersucht?
Die Studie wurde mit einer Klasse 8a durchgeführt, deren spezifische Herausforderungen und die Heterogenität der Lesekompetenzen beschrieben werden. Die geringe Motivation beim Lesen von "Wilhelm Tell" stellte einen Ausgangspunkt der Untersuchung dar.
Welche Texte wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ganzschriften "Wilhelm Tell" und "Krabat". Die Erfahrungen mit "Krabat" dienen als Vergleichsgrundlage für die Untersuchung mit "Wilhelm Tell".
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lesetagebuch, Prozessportfolio, Motivation, Lese- und Schreibkompetenz, Leistungsbewertung, Ganzschrift, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Wilhelm Tell, Otfried Preußler, Krabat, Drama, Jugendroman, Textverständnis, Schülertexte, Kooperatives Lernen, Binnendifferenzierung.
Details
- Titel
- Vom „Lesetagebuch“ zum „Produktportfolio“
- Untertitel
- Umgang mit Ganzschriften im Deutschunterricht einer Klasse 7 bzw. 8
- Note
- 1,7
- Autor
- Jana M. (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V213211
- ISBN (eBook)
- 9783656502753
- ISBN (Buch)
- 9783656504146
- Dateigröße
- 10634 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- lesetagebuch produktportfolio umgang ganzschriften deutschunterricht klasse
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Jana M. (Autor:in), 2008, Vom „Lesetagebuch“ zum „Produktportfolio“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/213211
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-