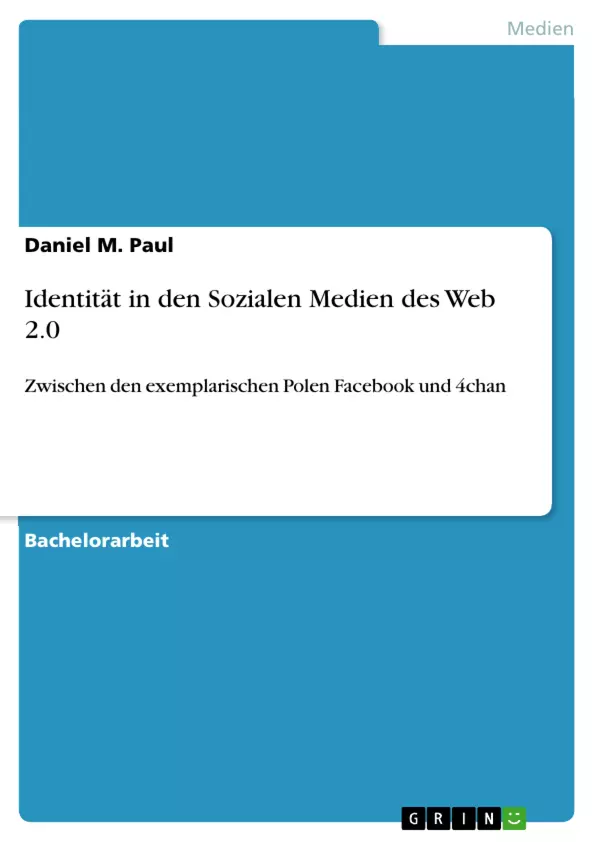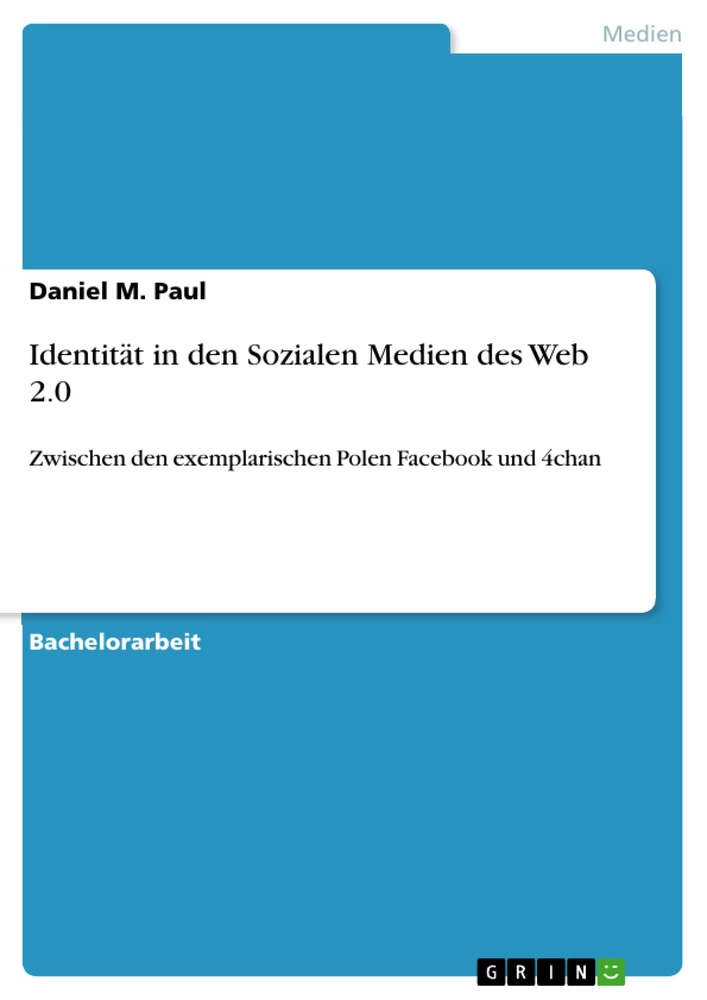
Identität in den Sozialen Medien des Web 2.0
Bachelorarbeit, 2012
26 Seiten, Note: 1,0
Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Der Anfang des Internets: Die Möglichkeit multipler Identitäten
- Facebook: eine Beschreibung
- 4chan: eine Beschreibung
- Performativität in den Sozialen Medien am Leitbild Facebook
- Virtueller Raum
- Virtuelle Körper
- Virtuelle Interaktion
- Performativität anhand des Imageboards 4chan
- Virtueller Raum
- Virtuelle Körper
- Virtuelle Interaktion
- Pluralisierung der Identitätsangebote
- Das verhandelbare Ich und Selbstinszenierungspraktiken
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert das Phänomen der Identität in den Sozialen Medien des Web 2.0, indem sie die exemplarischen Plattformen Facebook und 4chan kontrastiert. Die Arbeit untersucht die Performativität und Selbstinszenierungspraktiken in diesen virtuellen Räumen und beleuchtet die Pluralisierung von Identitätsangeboten im Kontext des Internets.
- Performativität in den Sozialen Medien
- Virtuelle Selbstinszenierung
- Identitätskonstruktionen im Web 2.0
- Pluralisierung von Identitätsangeboten
- Facebook und 4chan als kontrastierende Beispiele
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Entwicklung des Internets und die Möglichkeit, multiple Identitäten im virtuellen Raum zu konstruieren. Es stellt fest, dass das Internet anfänglich eine Plattform für die Exploration von alternativen Identitäten bot, während sich im Web 2.0 die Tendenz zur singulären Identität durchsetzt, die mit der »realen« Identität des Nutzers übereinstimmt. Das zweite Kapitel beschreibt Facebook als ein soziales Netzwerk, das die Profilierung unter dem Klarnamen fördert und die Vernetzung mit Freunden und Familie ermöglicht. Die Interaktionen auf Facebook dienen der Kommunikation, Distinktion und Identitätskonstruktion. Die erfassten User-Daten werden jedoch auch ökonomisch verwertet. Das dritte Kapitel stellt 4chan als das größte englischsprachige Imageboard der Welt vor, das im Gegensatz zu Facebook völlige Anonymität bietet. Die Benutzer profilieren sich ausschließlich durch ihre Postings, die in Form von Bildern und Kommentaren erfolgen. 4chan bietet keine Sicherheit vor verstörenden Inhalten und ist nicht auf ökonomische Verwertung ausgerichtet. Das vierte Kapitel untersucht die Performativität in den virtuellen Räumen von Facebook, wobei die verschiedenen Kommunikationsformen, wie Chat, Messages, Gruppen und Neuigkeiten, hinsichtlich ihres Grades an Performativität analysiert werden. Das fünfte Kapitel betrachtet die Performativität auf 4chan, wobei der Fokus auf dem /b/-Board liegt. Es wird festgestellt, dass dem virtuellen Raum, den Threads, ein hoher Grad an Performativität zukommt, der jedoch in den seltensten Fällen der Konstitution eines virtuellen Selbst dient. Das sechste Kapitel behandelt die Pluralisierung der Identitätsangebote im 21. Jahrhundert, die durch das Internet und die Massenmedien gefördert wird. Es wird argumentiert, dass das Internet die Monopolisierung der Medien untergräbt und die Pluralisierung von Identitätsangeboten fördert. Das siebte Kapitel untersucht das verhandelbare Ich und die Selbstinszenierungspraktiken im Web 2.0. Es wird festgestellt, dass die eigene Identität im Zuge einer dialogischen Situation entsteht und der Verhandlung bedarf. Die Selbstinszenierungspraktiken im Web 2.0 werden durch Ordnungskriterien simplifiziert und messbar gemacht, was zu einer Ökonomie des Sozialen führt. Das achte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und stellt fest, dass der moderne Mensch in einem ständigen Prozess der Profilierung steht, der sich sowohl auf die Arbeitswelt als auch auf die private Sphäre auswirkt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Identität, soziale Medien, Web 2.0, Performativität, Selbstinszenierung, Facebook, 4chan, Pluralisierung, Identitätsangebote, virtueller Raum, virtuelle Körper, virtuelle Interaktion.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Online-Identität seit Beginn des Internets verändert?
Früher bot das Internet Raum für multiple, oft anonyme Identitäten. Im Web 2.0 (z.B. Facebook) herrscht eine Tendenz zur singulären Identität vor, die eng mit der realen Person verknüpft ist.
Was unterscheidet die Identitätskonstruktion auf Facebook von 4chan?
Facebook basiert auf Klarnamen und Selbstdarstellung für ein bekanntes Umfeld. 4chan hingegen ermöglicht völlige Anonymität, bei der Identität nur flüchtig durch einzelne Postings entsteht.
Was bedeutet "Performativität" in den sozialen Medien?
Performativität bedeutet, dass Identität nicht einfach "da" ist, sondern durch Handlungen (Posts, Likes, Kommentare) im virtuellen Raum aktiv hergestellt und verhandelt werden muss.
Warum ist Anonymität auf 4chan so zentral?
Anonymität befreit den Nutzer von sozialen Erwartungen und ökonomischer Verwertung seiner Daten, führt aber auch zu einer radikaleren und oft unkontrollierten Kommunikation.
Was versteht man unter der "Ökonomie des Sozialen"?
Durch Plattformen wie Facebook werden soziale Interaktionen messbar (Likes, Follower). Das "Ich" wird zu einer Marke, die ständig optimiert und präsentiert wird, um sozialen Erfolg zu erzielen.
Details
- Titel
- Identität in den Sozialen Medien des Web 2.0
- Untertitel
- Zwischen den exemplarischen Polen Facebook und 4chan
- Hochschule
- Universität Wien (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft)
- Veranstaltung
- Medientheorie
- Note
- 1,0
- Autor
- Daniel M. Paul (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 26
- Katalognummer
- V213446
- ISBN (eBook)
- 9783656417385
- ISBN (Buch)
- 9783656417699
- Dateigröße
- 614 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- identität sozialen medien zwischen polen facebook
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Daniel M. Paul (Autor:in), 2012, Identität in den Sozialen Medien des Web 2.0, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/213446
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-