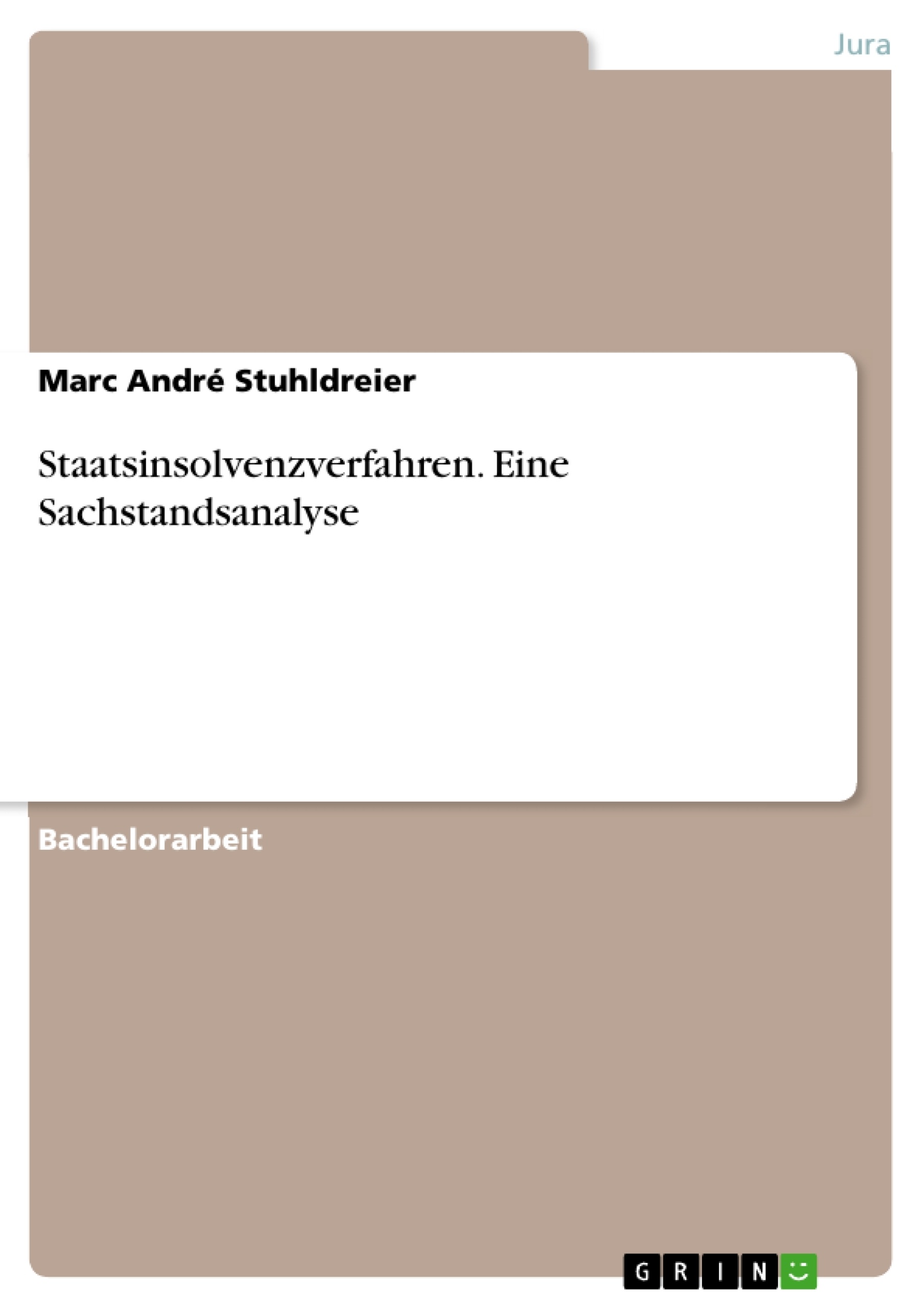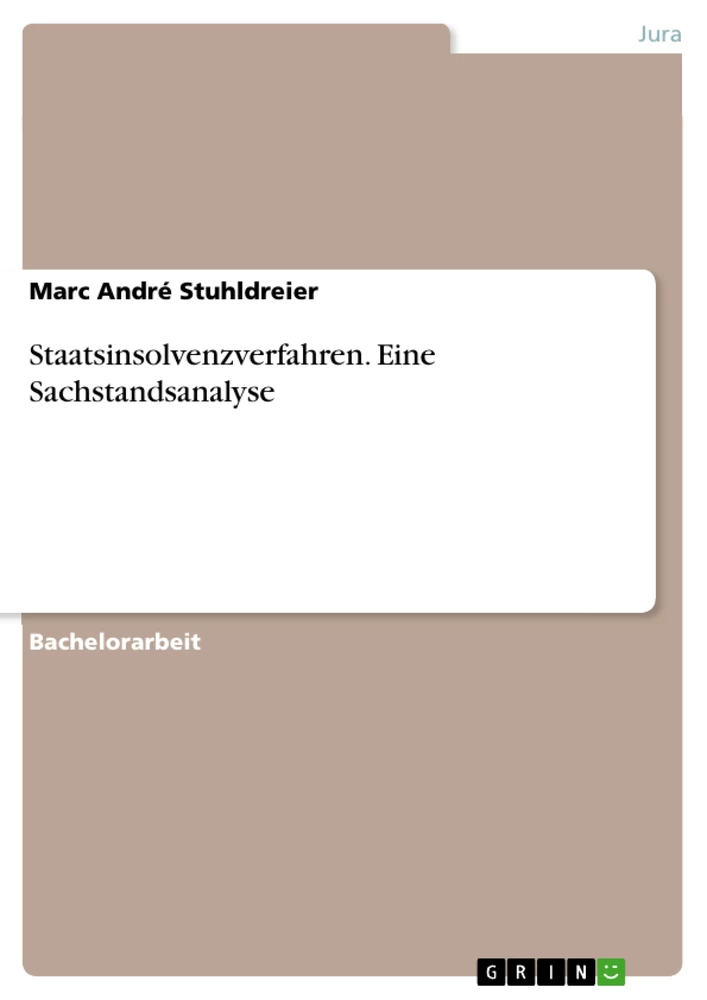
Staatsinsolvenzverfahren. Eine Sachstandsanalyse
Bachelorarbeit, 2013
97 Seiten, Note: 1,7
Jura - Europarecht, Völkerrecht, Internationales Privatrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Staatsverschuldung
2.1 Staatsschulden
2.2 Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit, Staatsbankrott
2.2.1 Überschuldung
2.2.2 Zahlungsunfähigkeit
2.2.3 Staatsbankrott
3 Insolvenzverfahren auf nationaler Ebene (Rechtssystem der BRD)
3.1 Insolvenzgründe
3.1.1 Zahlungsunfähigkeit
3.1.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit
3.1.3 Überschuldung
3.2 Zweck und Maßnahmen des Insolvenzverfahrens
3.3 Das Insolvenzverfahren
3.3.1 Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens
3.3.2 Unterschiede zwischen der Insolvenz von Unternehmen und der Verbraucherinsolvenz (Privatinsolvenz)
4 Übertragbarkeit nationaler Elemente des Insolvenzrechts auf die Staateninsolvenz
4.1 Das Planverfahren gemäß dem Chapter 11 Verfahren des US Bankruptcy Code
4.2 Die Restrukturierung von Gebietskörperschaften anhand des Chapter 9 des US Bankruptcy Code
4.3 Weitere nationale Regeln, die als Vorbild für Staateninsolvenzverfahren dienen könnten
5 Insolvenzverfahren für Staaten – Der Sachstand
5.1 Gründefür die Notwendigkeit eines Insolvenzmechanismus für Staaten
5.1.1 Allgemeine Gründe
5.1.2 Besonderes Erfordernis einer Insolvenzverfahrensordnung für Staaten in der Europäischen Währungsunion
5.2 Forderungen eines Staateninsolvenzverfahrens und Diskussionen zu diesem Thema in Politik und Wirtschaft
5.2.1 Die Diskussion auf globaler Ebene
5.2.2 Diskussionen zu einem Staateninsolvenzverfahren auf europarechtlicher Ebene
5.2.3 Die Haltung der Bundesrepublik Deutschland in der Diskussion um Staateninsolvenzverfahren
5.3 Rechtliche Machbarkeit
5.4 Probleme und Nachteile von Staateninsolvenzverfahren
5.5 Vorteile eines strukturierten Insolvenzverfahrens für Staaten
5.6 Der IWF Vorschlag eines Staateninsolvenzverfahrens von 2001/2002
5.7 Zwischenfazit
6 Die mögliche Ausgestaltung eines Verfahrensablaufs
6.1 Grundsätze des Verfahrens
6.2 Schaffung einer unabhängigen gerichtsähnlichen Kontrollinstanz
6.2.1 Aufgaben und Befugnisse des SDT
6.2.2 Möglichkeiten der Ansiedlung des SDT
6.2.3 Der BRUEGEL-Vorschlag des ECRM
6.3 Mögliche Ausgestaltung des Grundkonzepts eines Verfahrens
6.3.1 Einleitung des Verfahrens
6.3.2 Verhandlungsablauf
6.4 An das Verfahren anschließende Maßnahmen
6.4.1 Überwachung der Umsetzung
6.4.2 Finanzhilfen im Anschluss an das Verfahren
7 Etablierungsmöglichkeiten
7.1 Die Etablierung eines globalen Staateninsolvenzmechanismus
7.2 Ein Staateninsolvenzmechanismus für die Europäische Union
8 Alternative Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit staatlichen Schuldenkrisen
8.1 Pariser und Londoner Clubs
8.2 Bretton Woods System
8.2.1 Brady Bonds
8.2.2 HIPC-Initiativen und MDRI
8.3 Collective Action Clauses
8.4 EU-Mechanismen zum Umgang mit Staatsschuldenkrisen
8.4.1 Die europäischen Rettungsmechanisme EFSM und EFSF
8.4.2 Der European Stability Mechanism (ESM)
8.4.3 Weitere Krisenlösungs- bzw. Krisenvorbeugemechanismen auf europarechtlicher Ebene in der Diskussion
9 Fazit
Literaturverzeichnis
Monographien
Sammelbandbeiträge
Zeitschriftenaufsätze
Offizielle Quellen
Fachlexika
Web-Quellenverzeichnis
Eidesstattliche Versicherung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Die vorliegende Bachelorarbeit zum Thema „Staatsinsolvenzverfahren – Eine Sachstandsanalyse“ wird einen Überblick über die politische Diskussion der Schaffung eines Insolvenzverfahrens speziell für souveräne Schuldner bieten. Das Thema der Staatsinsolvenz bzw. Staateninsolvenz ist insbesondere auf Grund der aus der letzten Wirtschaftskrise entsprungenen aktuellen Staatsschuldenkrise in den Fokus politischer Diskussionen gerückt. Es handelt sich hierbei jedoch keineswegs um einen neuen Themenbereich. So kamen erste Forderungen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. In der Folge ging man jedoch davon aus, dass Staatspleiten auf anderen Wegen vermieden werden könnten; ein möglicher Staatsbankrott wurde schlichtweg geleugnet. Während auf nationalen Ebenen das Insolvenzrecht für juristische und natürliche Personen stetig weiterentwickelt wurde, stellten Insolvenzfälle auf staatlicher Ebene immer wieder Schocksituationen dar, welche nur durch Ad-hoc-Maßnahmen, mehr oder minder effektiv, gelöst werden konnten. Dies geschah vor allem durch gläubigergesteuerte Verhandlungen, insbesondere durch den Londoner und den Pariser Club. Solche Lösungen waren jedoch in den wenigsten Fällen fair, weder den Bürgern des Schuldnerlandes gegenüber, noch im Sinne der Gleichbehandlung der Gläubiger. Des Weiteren führte eine Veränderung der internationalen Kapitalmärkte dazu, dass es kaum mehr möglich ist, ihm Rahmen dieser Clubs eine effektive Lösung für staatliche Insolvenzfälle zu finden. Weitere Besonderheiten ergeben sich vor allem auch im Rahmen der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union im Ganzen, insbesondere auf Grund der Souveränitätsbeschränkungen der Mitgliedstaaten.
In der folgenden Thesis soll dargelegt werden, weshalb ein Insolvenzverfahren für Staaten dringend benötigt wird und weshalb bisherige Krisenlösungsmechanismen, ob nun international oder speziell auf EU-rechtlicher Ebene, nicht ausreichend erscheinen. Des Weiteren sollen auch Ausgestaltungs- und Etablierungsmöglichkeiten eines solchen Verfahrens vorgestellt sowie Vorteile und Probleme analysiert werden.
2 Staatsverschuldung
2.1 Staatsschulden
Wie jede wirtschaftlich tätige natürliche oder juristische Person hat ein Staat Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen entzieht der Staat durch Steuern und Gebühren (neben anderen Einnahmemöglichkeiten) dem wirtschaftlichen Kreislauf.[1] Ein Staat hat demgegenüber aber auch Ausgaben, welche er zur Wahrnehmung seiner Hoheitlichen Aufgaben tätigen muss.[2] Solche Staatsausgaben werden für Lohn- und Gehaltszahlungen an beim Staat beschäftigte Personen, für Unternehmenssubventionen sowie für Transferzahlungen an private Haushalte verwendet. Des Weiteren werden Staatsausgaben für Einkäufe bei Unternehmen, vor allem für Rüstungsgüter verwendet.[3] Obwohl gerade diese Kosten oft sehr hoch sind, insbesondere bei hochverschuldeten Ländern wie Griechenland,[4] hält schon Adam Smith solche Ausgaben für „moralisch gerechtfertigt“[5], da Handel treibende Völker vom Staat geschützt werden müssen.[6]
Sind die Staatsausgaben nun aber höher als die Staatseinnahmen, so muss sich ein Staat logischerweise verschulden. Hierzu hat ein Staat zum einen die Möglichkeit einer Kreditaufnahme im privaten Bankensektor und finanziert sich somit über die bereitgestellten Gelder der privaten Haushalte. Zum anderen kann ein Staat sich aber auch über Staatsanleihen international, also im Ausland verschulden.
2.2 Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit, Staatsbankrott
Bei der Befassung mit Staatsschulden und der Insolvenz von Staaten stößt man immer wieder auf verschiedene Begriffe, welche zur Bestimmung einer Staateninsolvenz verwendet werden. Es geht also um bestimmte Begebenheiten, welche auf das Vorliegen eines Insolvenzfalles hindeuten. Die Frage, wann genau ein Insolvenzfall vorliegt ist jedoch nicht abschließend geklärt. Im Folgenden möchte ich kurz die möglichen Ansätze vorstellen. Dies wären die Überschuldung von Staaten, sowie die möglicherweise daraus folgende Zahlungsunfähigkeit, was dann gegebenenfalls in einem Staatsbankrott enden kann.
2.2.1 Überschuldung
Obwohl die Verschuldung von Staaten ein notwendiges Instrument ist, um hoheitliche Aufgaben zu erfüllen, gibt es offiziell keine Grenzen für Staatsschulden bzw. die Höhe der Neuverschuldung. Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften wird dieser Themenbereich „äußerst kontrovers und stellenweise ideologieorientiert und polemisch“ diskutiert.[7] Für die Mitglieder der Europäischen Union gibt es spezielle Regelungen zur Staatsverschuldung, welche als Maastricht-Kriterien bekannt sind. Diese besagen, dass die Schuldenquote maximal 60% des BIP und die jährliche Neuverschuldung im Haushaltsdefizit maximal 3% betragen dürfen. Obwohl europarechtlich vorgeschrieben, werden diese Werte jedoch von kaum einem Euroland eingehalten.[8]
Festzuhalten ist, dass sich kaum ein Euroland an die Maastricht-Kriterien hält, allerdings ist zu beachten, dass bei weitem nicht jedes Euroland überschuldet ist. Es gilt also herauszufinden, wann ein Staat zu hohe Schulden hat. Im nationalen Recht liegt eine Überschuldung vor, wenn gem. § 19 Abs. 2 S.1 InsO das Vermögen eines Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Ermittelt wird dies durch eine Überschuldungsbilanz, in welcher Aktiva und Passiva verglichen werden.[9] Dieser Vergleich bietet sich für Staaten jedoch nicht an, da das Vermögen eines Staates nicht so einfach ermittelt werden kann bzw. nicht unbedingt wirtschaftlich verwertbar ist. Es kann bei Staatsschulden also nicht einfach von einer Überschuldung gesprochen werden, sondern es muss der Punkt gefunden werden, an dem die Schuldentragfähigkeit eines Staates nicht mehr gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn die Schulden außer Verhältnis zu den Rückzahlungsmöglichkeiten stehen.[10] Es geht also um einen Vergleich der Zahlungsverpflichtungen des Schuldners und seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.[11] Es kann also keine festen Richtwerte geben, sondern das Vorliegen einer Überschuldung muss für jeden Schuldner individuell ermittelt werden.
2.2.2 Zahlungsunfähigkeit
Die Zahlungsunfähigkeit ist der Hauptgrund für die Eröffnung von Insolvenzverfahren auf nationaler Ebene. Ein Schuldner gilt gem. § 17 Abs. 2 S. 1 InsO als zahlungsunfähig, wenn er den fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.[12]
Auf die Zahlungsunfähigkeit wird in Kapitel 3.1.1 genauer einzugehen sein. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass die Zahlungsunfähigkeit im Bereich der Staatsschulden kein geeignetes Mittel zur Ermittlung des Vorliegens eines Insolvenzfalls ist. Zahlungsunfähigkeit wird gewöhnlich schon bei Einstellung der Rückzahlung eines Schuldners angenommen. Gerade bei Souveränen aber kann diese Zahlungseinstellung auch politisch motiviert sein und somit nichts über die Tragfähigkeit der Schulden des Staates aussagen.
2.2.3 Staatsbankrott
Im Zuge der Staateninsolvenz fällt häufig der Begriff des Staatsbankrotts. Dieser ist nicht mit dem (privatrechtlichen) Bankrott nach deutschem Recht vergleichbar. Nach nationalem Recht ist der Bankrott gem. § 283 StGB eine Insolvenzstraftat, bei welcher Gläubiger durch Handlungen eines Schuldners fahrlässig oder vorsätzlich benachteiligt werden.[13] Der Staatsbankrott wird dagegen als Begriff für die Zahlungseinstellung eines Staates verwendet. Diese kann ökonomisch bedingt sein, da ein Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen. Andererseits kann sie auch politisch bedingt sein, wenn ein Staat die Zahlung verweigert (sogenannte Repudiation). Grandt definiert den Staatsbankrott, „…als die förmliche Erklärung einer Regierung, fällige Forderungen nicht mehr oder nur noch teilweise erfüllen zu können, oder die faktische Einstellung fälliger Zahlungen.“[14]
Für die Insolvenz bzw. ein Insolvenzverfahren für Staaten ist zu beachten, dass nur der ökonomisch bedingte Staatsbankrott von Bedeutung ist. Sollte ein Staat nämlich seine Zahlungen verweigern, dürfte es schwer werden, wenn nicht gar unmöglich sein, dass die Gläubiger ihre Ansprüche geltend machen können.
3 Insolvenzverfahren auf nationaler Ebene (Rechtssystem der BRD)
3.1 Insolvenzgründe
Im deutschen Insolvenzrecht gibt es drei hauptsächliche Begründungen, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Dies sind die Zahlungsunfähigkeit, die drohende Zahlungsunfähigkeit sowie die Überschuldung, welche im Folgenden kurz aus nationalrechtlicher Sicht erläutert werden.
3.1.1 Zahlungsunfähigkeit
§ 17 Abs. 2 S. 1 InsO definiert, dass Zahlungsunfähigkeit vorliegt, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Gemäß Satz 2 ist dies in der Regel anzunehmen, wenn ein Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Allerdings muss die Zahlungseinstellung auf einen objektiven Mangel zurückzuführen sein.[15] Es kommt also darauf an, ob ein Schuldner unfähig ist, und nicht unwillig, seine Schulden zu begleichen.[16]
Eine Zahlungsunfähigkeit muss nicht wesentlich sein, sie muss jedoch von einer bloßen Zahlungsstockung abgegrenzt werden. In der Regel ist von einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sobald mindestens 10 Prozent der Schulden nicht beglichen werden können.[17]
3.1.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit
Ein Schuldner droht dann zahlungsunfähig zu werden, wenn er gem. § 18 Abs. 2 InsO voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Es geht hierbei um aktuelle sowie künftige Verbindlichkeiten, welche wahrscheinlich zu erwarten sind.[18] Als Liquidität des Schuldners werden ebenfalls die gegenwärtigen sowie die bis zum Stichtag verfügbar werdenden Zahlungsmittel betrachtet.[19]
Es geht bei diesem Insolvenzgrund vornehmlich darum, eine unnötige Herunterwirtschaftung eines Unternehmens bis zur tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit zu verhindern.[20]
3.1.3 Überschuldung
Wie in Kapitel 2.2.1 bereits erwähnt, liegt eine Überschuldung im nationalen Recht gem. § 19 Abs. 2 S. 1 InsO dann vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Die Überschuldung wurde als Insolvenzgrund etabliert, um zu verhindern, dass die Insolvenz einer nicht überlebensfähigen Gesellschaft bis zur Zahlungsunfähigkeit hinausgezögert wird.[21]
3.2 Zweck und Maßnahmen des Insolvenzverfahrens
Ein Insolvenzverfahren wird eröffnet, wenn einer oder mehrere der in Kapitel 3.1 genannten Insolvenzgründe vorliegen. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung ist also sehr wahrscheinlich bzw. sicher, dass der Schuldner seine Gläubiger nicht mehr in vollem Umfang befriedigen kann.
Das Ziel des Insolvenzverfahrens ist die Verhinderung eines „Wettlaufs der Gläubiger“, welches dadurch erreicht wird, dass die Gläubiger gemeinschaftlich befriedigt werden.[22] Ohne eine solche gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger, die sogenannte Gesamtvollstreckung, würden diese versuchen, ihre Rechte individuell, ggf. im Rahmen der Zwangsvollstreckung gem. §§ 704 ff. ZPO durchzusetzen. In diesem Falle wären aber alle verspäteten Gläubiger benachteiligt. Stattdessen wird im Zuge der Gleichberechtigung jeder Gläubiger einer Gläubigergruppe anteilsmäßig, gleich viel bekommen. Das heißt, jeder Gläubiger erhält einen Anteil der Insolvenzmasse in Höhe der prozentualen Höhe seiner Forderung an den gesamten Forderungen aller Gläubiger.[23] Im Zuge eines Insolvenzverfahrens werden Gläubiger gemäß der Art ihrer Forderungen in unterschiedliche Gläubigergruppen eingeteilt. Eine Gleichbehandlung für Gläubiger existiert während eines Insolvenzverfahrens nur innerhalb der einzelnen Gläubigergruppen.[24]
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist jedoch nicht der Schuldner selbst für die Befriedigung der Gläubiger zuständig. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlangt gem. § 80 Abs. 1 InsO ein Insolvenzverwalter die Verwaltungs- und Verfügungsmacht über die Insolvenzmasse. Der Schuldner verliert also die Verwaltungs- und Verfügungsmacht, nicht aber seine Prozess- und Geschäftsfähigkeit. Des Weiteren obliegen dem Insolvenzschuldner diverse Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber dem Verwalter und dem Gericht.[25]
3.3 Das Insolvenzverfahren
Im Folgenden ist zum besseren Verständnis kurz auf den Ablauf nationaler Insolvenzverfahren einzugehen. In 3.3.1 wird hierzu ein Überblick über das Regelinsolvenzverfahren gegeben, welches üblicherweise bei der Insolvenz von Unternehmen, selbständigen Personen, sowie ehemals selbständigen Personen Anwendung findet. Im Anschluss werden dann Abweichungen und Unterschiede des Verbraucher- bzw. Privatinsolvenzverfahrens im Gegensatz zur Regelinsolvenz aufgezeigt.
3.3.1 Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens
Grundsätzlich wird ein Insolvenzverfahren gem. § 13 Abs. 1 InsO nur auf Grund eines schriftlichen Antrags, der vom Schuldner, oder von einem Gläubiger gestellt werden kann, eröffnet. Ist ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt, prüft das Gericht, ob dieser zulässig ist und ob die Kosten des Verfahrens durch die Insolvenzmasse des Schuldners gedeckt werden können.[26] Gemäß § 26 InsO wird ein solcher Antrag abgewiesen, sofern die Verfahrenskosten durch die vorhandene Insolvenzmasse nicht gedeckt werden können.
Während der Zeit, in welcher die Zulässigkeit geprüft wird, läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Das bedeutet, dass das Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen anordnen kann, um nachteilige Eingriffe in die Insolvenzmasse zu verhindern.[27] Solche Maßnahmen regelt § 21 InsO. Dies kann zum Beispiel die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters gem. § 21 Abs. 2 Nr. 1 InsO sein.
Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, wird das Insolvenzverfahren eröffnet und gem. § 27 I InsO ein (endgültiger) Insolvenzverwalter ernannt. Des Weiteren werden mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Berichtstermin und ein Prüfungstermin bestimmt.[28] Beim Berichtstermin wird entschieden, ob es Möglichkeiten gibt, das Unternehmen des Schuldners ganz, oder zumindest teilweise zu erhalten, oder ob das Vermögen liquidiert wird.[29] Es geht hierbei somit um die Ausarbeitung eines Insolvenzplans sowie die Art der Gläubigerbefriedigung. Im Prüfungstermin werden alle gegen den Schuldner angemeldeten Forderungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 InsO geprüft. Wird einer angemeldeten Forderung nicht widersprochen, so gilt sie als festgestellt. Sollte einer Forderung widersprochen werden, so muss vor Gericht die Gültigkeit dieser Forderung überprüft werden.[30]
Im nächsten Schritt wird die Insolvenzmasse, also das Vermögen des Schuldners, sofern von den Gläubigern nichts anderes im Insolvenzplan vereinbart wurde, vom Insolvenzverwalter liquidiert. Anschließend wird die Masse quotal an alle Gläubiger mit festgestellten Forderungen ausgezahlt. Es wird jedoch ein Teil der Masse für ausstehende Gerichtsentscheidungen über die Gültigkeit einiger Forderungen, denen widersprochen wurde, einbehalten.[31]
Sobald die Verteilung der Insolvenzmasse beendet ist, folgt gem. § 196 InsO eine Schlussverteilung, sowie gem. § 197 InsO ein Schlusstermin, welche beide durch das Insolvenzgericht bestimmt werden. Dem folgt die Aufhebung des Insolvenzverfahrens.[32] Gem. § 201 Abs. 1 InsO können die Insolvenzgläubiger ihre restlichen Forderungen nach der Aufhebung des Verfahrens wieder uneingeschränkt geltend machen.
3.3.2 Unterschiede zwischen der Insolvenz von Unternehmen und der Verbraucherinsolvenz (Privatinsolvenz)
Im Gegensatz zur Regelinsolvenz wird ein Verbraucherinsolvenzverfahren nur eröffnet, sofern ein Schuldner den Versuch einer außergerichtlichen Schuldbereinigung mit seinen Gläubigern unternommen hat.[33] Zu beachten ist hierbei, dass es keinen Mehrheitsentscheid gibt. Sollte nur ein Gläubiger nicht zustimmen oder die Zwangsvollstreckung betreiben, ist der außergerichtliche Schuldbereinigungsversuch gem. § 305a InsO gescheitert.[34]
Nach dem Scheitern der außergerichtlichen Schuldbereinigung hat das Gericht die Möglichkeit, das Verbraucherinsolvenzverfahren zu eröffnen oder eine gerichtliche Schuldbereinigung anzustreben.[35] Gemäß § 309 Abs. 1 S. 1 InsO reicht es bei der gerichtlichen Schuldbereinigung aus, wenn die Mehrheit der Gläubiger zustimmt, sofern ihre Forderungen mehr als die Hälfte der Gesamtforderung umfassen.
Sofern kein gerichtliches Schuldbereinigungsverfahren stattgefunden hat bzw. ein solches gescheitert ist, ist der (bereits vorliegende) Insolvenzantrag zu prüfen. Sollte dieser Antrag zulässig sein, folgt die Eröffnung eines vereinfachten Insolvenzverfahrens.[36] Die Besonderheiten des vereinfachten Insolvenzverfahrens sind, dass es im Gegensatz zur Regelinsolvenz keinen Berichtstermin gibt und das Verfahren somit zum Großteil schriftlich durchgeführt werden kann. Des Weiteren sind die Gläubiger für die Verwertung ihrer Pfandrechte und Absonderungsrechte gem. § 313 Abs. 3 InsO selbst verantwortlich. Das Verfahren wird von einem vom Insolvenzgericht ernannten Treuhänder durchgeführt, welcher gem. § 313 Abs. 1 InsO die Aufgaben des Insolvenzverwalters - mit einigen Ausnahmen - übernimmt.[37] Nach Beendigung des Verfahrens ist auch bei der Verbraucherinsolvenz § 201 Ab s. 1 InsO anzuwenden, die Gläubiger können also auch hier ihre Ansprüche nach Abschluss des Verfahrens wieder uneingeschränkt geltend machen.
Der Sinn und Zweck einer Insolvenz ist jedoch, die Gläubiger gleichberechtigt zu befriedigen und dem Schuldner aus der Krise zu helfen (§ 1 InsO). Hier liegt auch der wesentliche Unterschied zwischen der Insolvenz von Unternehmen und der Insolvenz von Privatpersonen. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens werden Gesellschaften grundsätzlich aufgelöst (§ 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG, §60 Abs. 1 Nr. 4 GmbH Gesetz, § 728Abs. 1I 1 BGB, § 131 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Sollte die Gläubigerversammlung sich nicht für eine Fortführung der Gesellschaft entscheiden, wird diese liquidiert und gelöscht.[38]
Bei der Insolvenz von Privatpersonen besteht die Möglichkeit einer Restrukturierung. Die Restschuldbefreiung erfordert einen Eigenantrag des Schuldners und stellt einen Verfahrensabschnitt dar, der sich an das Insolvenzverfahren anschließt.[39] Der Schuldner hat die Auflage, während einer Dauer von 6 Jahren seine Einkünfte oberhalb der Pfändungsgrenze an seine Gläubiger abzutreten.[40] Sollte sich der Schuldner während dieser Wohlverhaltensperiode redlich verhalten, so wird ihm kraft Gesetzes der Rest seiner Schuld erlassen.[41]
Diese Unterscheidung ist auch im Hinblick auf die Insolvenz von Staaten von Bedeutung. Da Staaten genau wie Privatpersonen nicht einfach liquidiert und aufgelöst werden können, sollten die Überlegungen zum Thema der Staateninsolvenz Anknüpfung an das Insolvenzverfahren von natürlichen Personen finden.
4 Übertragbarkeit nationaler Elemente des Insolvenzrechts auf die Staateninsolvenz
Da es sich um die gleiche Materie handelt, könnte es sinnvoll sein, sich bei der Staateninsolvenz an den Verfahren des nationalen Insolvenzrechts zu orientieren. Es ist jedoch nicht möglich, diese Verfahren deckungsgleich auf die Staateninsolvenz zu übertragen. Vielmehr ist es nötig, die bereits vorhandenen Aspekte nationaler Verfahren herauszufiltern, welche auch für die Insolvenz von Staaten geeignet sind. An diesen Aspekten gilt es sich in der Folgearbeit zu orientieren und diese in einen Rahmen zu bringen, der auch bei einer Staateninsolvenz auf Souveräne anwendbar ist. Es geht bei dieser Übertragbarkeit also lediglich um Grundstrukturen und Erfahrungen, welche bei der Ausarbeitung eines Insolvenzverfahrens auf Staatenebene nützlich sein können.[42]
Wie zuvor bereits erläutert, ist es nicht möglich, einen Staat wie ein Unternehmen einfach zu liquidieren und aufzulösen. Da die Weiterexistenz eines Souveräns gewährleistet sein muss, besteht dementsprechend keine Möglichkeit, sich an dem deutschen Regelinsolvenzverfahren zu orientieren. Eher wäre denkbar, eine Anlehnung an die Privatinsolvenz zu finden, da hier von Bedeutung ist, den Schuldner wirtschaftlich wieder handlungsfähig zu machen. Ein geeignetes Instrument dafür stellt bei der Insolvenz von Privatpersonen die Restschuldbefreiung dar. Es ist fraglich, ob eine solche auch auf Staatenebene erreichbar wäre. Jedoch ist die Möglichkeit des Vertrauensverlusts der Gläubiger durch eine solche Restschuldbefreiung wohl sehr hoch und dies könnte sich auf die Gewährung neuer Gelder für einen (ehemaligen) Schuldnerstaat negativ auswirken.
Abgesehen von der Restschuldbefreiung gibt es in Deutschland das sogenannte Planverfahren gem. §§ 217 ff. InsO, welches zum Ziel hat, den Schuldner wirtschaftlich zu restrukturieren. Dieses Verfahren entstand nach dem Vorbild des US-amerikanischen Chapter 11 Proceeding, also dem Chapter 11 des US Bankruptcy Code.[43] Das Gesetz beinhaltet ein Planverfahren zur Restrukturierung von Schuldnern. Auf Grundlage des Chapter 11-Verfahrens ist in den USA auch das sogenannte Chapter 9-Verfahren entstanden, das die Restrukturierung von „municipalities“ (also territorialen und hoheitlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts) regelt, sich also mit der Insolvenz von Gebietskörperschaften befasst.[44] Etwas Ähnliches gibt es im deutschen Recht derzeit nicht, da in Deutschland § 12 InsO solche Insolvenzverfahren gegenüber dem Vermögen des Bundes, der Länder oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die gemäß Landesrecht von einer Insolvenz ausgeschlossen werden, als unzulässig erklärt.
Im Folgenden wird kurz das Planverfahren nach dem Chapter 11 des US Bankruptcy Code und das Chapter 9-Verfahren vorgestellt sowie die Übertragbarkeit einzelner Aspekte auf ein Insolvenzverfahren für Souveräne erläutert.
4.1 Das Planverfahren gemäß dem Chapter 11 Verfahren des US Bankruptcy Code
Das Chapter 11 Verfahren beginnt damit, dass ein „automatic stay“ eintritt. Das bedeutet, dass alle Verbindlichkeiten eingefroren und - sofern bestritten - einheitlich geprüft werden.[45] Der Hauptaspekt dieses Planverfahrens ist, wie der Name schon sagt, die Erstellung eines Restrukturierungsplans. Dieser Plan hat lediglich die Mindestanforderung, dass die Gläubiger damit einverstanden sein müssen. Deshalb wird dieser Plan auch während des Verfahrens von den Gläubigern mit dem Schuldner diskutiert, bis es an einem gewissen Punkt zu einer Abstimmung über den Plan kommt. Es gibt ein Mehrheitsvotum, bei welchem die Gläubiger in bestimmte Gläubigergruppen eingeordnet werden.[46] Innerhalb dieser Gruppen reicht für eine Entscheidung jeweils die Mehrheit der Gläubiger. Erforderlich ist, dass zwei Drittel des gesamten Forderungsvolumens und mehr als die Hälfte der Forderungen im Besitz der zustimmenden Gläubiger sein müssen.[47] Insgesamt müssen aber alle Gläubigergruppen dem Plan zustimmen.[48] Sollte es zu keiner Einigung kommen, besteht die Möglichkeit, dass die Gläubiger einen Restrukturierungsplan vorlegen, welcher selbstverständlich vom Schuldner akzeptiert werden muss, um Gültigkeit zu erlangen. Des Weiteren kann ein Plan auch nach Ermessen des Insolvenzgerichts festgelegt werden.[49] Hier gilt es jedoch zu beachten, dass letztere Möglichkeit bei Insolvenzverfahren für Staaten nicht praktikabel wäre, da sich zum einen kein Schuldnerland einem Plan unterwerfen würde, welcher nicht seinen Vorstellungen entspricht und zum anderen die Souveränität des Staates gewährleistet bleiben muss und ein Plan somit immer der Zustimmung des Schuldners bedarf.
4.2 Die Restrukturierung von Gebietskörperschaften anhand des Chapter 9 des US Bankruptcy Code
Dass es möglich ist, auch Körperschaften des öffentlichen Rechts einem Insolvenzverfahren zu unterziehen, ohne dass diese ihre Souveränität verlieren, wird deutlich durch das US amerikanische Chapter 9 Verfahren für „municipalities“ gezeigt.[50] Dieses Verfahren ist im Grundsatz ein an die Materie angepasstes Chapter 11 Verfahren, welches nur die Restrukturierungsoption beinhaltet. Der Grundsatz dieses Verfahrens ist, dass eine Unantastbarkeit, all jener Gegenstände vorliegt, welche zur Ausübung hoheitlicher Rechte und Pflichten erforderlich sind.[51] Dem Grunde nach ist es dieses Verfahren, welches wirklich als Vorbild für die Insolvenz von Staaten dienen kann. Das einzige große Problem, welches sich auch der Innerstaatlichkeit dieses Gesetzes ergibt, ist, dass die „municipalities“ dem Gesetz und somit auch den Gerichten unterworfen sind. Dies ist bei Staaten jedoch nicht gegeben.
Das Chapter 9 Verfahren beinhaltet einige Besonderheiten, die für die Funktionsfähigkeit des Verfahrens mit Körperschaften öffentlichen Rechts als Schuldner von großer Bedeutung sind. So ist es in einem Chapter 9 Verfahren nur dem Schuldner gestattet, einen Insolvenzantrag zu stellen.[52] Die Verfahrenseröffnung hängt jedoch von verschiedenen Kriterien ab. Zum einen muss die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners vorliegen, zum anderen müssen alle von einem Insolvenzplan betroffenen Gläubigergruppen gemäß einem Mehrheitsentscheid mit einer einfachen Mehrheit der Verfahrenseröffnung zustimmen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zum Planverfahren nach Chapter 11 ist, dass auch während des „automatic stays“ bestimmte Anleihen weiter bedient werden.[53]
Bei der Wahl des Richters wird bei einem Chapter 9 Verfahren großer Wert darauf gelegt, dass dieser besonders geeignet für Insolvenzverfahren erscheint. Des Weiteren soll jeglicher politischer Wille bei der Richterwahl ausgeschlossen sein.[54]
Einschränkungen gelten jedoch auch für das Insolvenzgericht. So ist es dem Gericht gem. § 904, Chapter 9, Title 11 US Code nicht gestattet, sich in politische Angelegenheiten oder staatliche Zuständigkeiten des Schuldners einzumischen. Des Weiteren darf auch nicht auf Vermögen zurückgegriffen werden, welches Einkommen für den Schuldner generiert.[55]
Eine weitere elementare Regelung zum Schutz der Souveränität des Schuldners stellt § 943(b) (6)dar, welcher besagt, dass, sollte zur Durchführung eines Plans die Zustimmung der Wähler erforderlich sein könnte, diese auch zu erlangen ist. Ansonsten darf ein Gericht seine Genehmigung nicht erteilen.[56]
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch noch kurz § 904 des Chapter 9 US Bankruptcy Code erwähnt, welcher explizit besagt, dass „municipalities“ nicht durch Gläubiger oder dritte administriert werden dürfen.
4.3 Weitere nationale Regeln, die als Vorbild für Staateninsolvenzverfahren dienen könnten
Neben den bereits erwähnten Chapter 9 und Chapter 11 Verfahren nach US amerikanischem Recht gibt es eine Vielzahl weiterer Gesetzesvorschriften, die als Vorbild für die Staateninsolvenz verwendbar wären. Nachfolgend werden zwei bedeutsame dieser Regeln vorgestellt.
Ein Problem bei Staateninsolvenzverfahren ist die u.U. unüberschaubare Anzahl an Gläubigern und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Gläubigergruppen. Es wird immer wieder Gruppen geben, welche sich gegen jeden Plan quer stellen werden. Um diesem Problem zu entkommen, könnte bei einem Staateninsolvenzverfahren § 245 InsO als Vorbild herangezogen werden. Diese sogenannte „Cram-Down-Rule“[57] besagt, dass das Einstimmigkeitsprinzip der Gläubigergruppen unter bestimmten Voraussetzungen reduziert werden kann, so dass auch bei der Abstimmung der Gruppen (also nicht bloß innerhalb der Gruppen) ein Mehrheitsentscheid ausreichend ist. Jedoch gilt auch bei dieser Regel, dass sie nicht eins zu eins aus dem nationalen Recht übernommen werden könnte, sondern dem Bedarf eines Staateninsolvenzverfahrens angepasst werden müsste.
Ein weiteres Problem des Staateninsolvenzverfahrens ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, dafür zu sorgen, dass sich ein Staat auch wirklich an die Auflagen des Restrukturierungsplans hält. Dies ist jedoch von Bedeutung, da die Gläubiger auf Teile ihrer Forderungen verzichten, da sie auf die Umsetzung des Plans vertrauen. Für Fälle von Verstößen durch den Schuldner sollte es einen Sanktionsmechanismus geben. Dieser könnte sich an § 255 InsO orientieren, welcher zu einem Wiederaufleben einzelner oder aller Forderungen der Gläubiger führt, sollte ein Schuldner bei der Umsetzung des Plans erheblich in Rückstand geraten. Im schlimmsten Fall würde dies bedeuten, dass der Schuldner wieder so dasteht wie vor dem Insolvenzverfahren. Dies wird ihm die Beschaffung neuen Kapitals sowie erneute Verhandlungen mit den Gläubigern erheblich erschweren.
5 Insolvenzverfahren für Staaten – Der Sachstand
In der Vergangenheit wurde immer wieder argumentiert, dass Staaten nicht insolvent werden können.[58] Im Hinblick auf diverse Optionen, wie z.B. Steuererhöhungen oder die Betätigung der Notenpresse, wurde diese These in politischen und wirtschaftlichen Diskussionen gestützt. Diese Ansicht hat sich durch die Finanzkrisen der letzten Jahre bzw. sogar der letzten Dekaden stark verändert. Es ist mittlerweile weitgehend akzeptiert, dass auch Staaten dem Risiko eines Bankrotts (im Sinne des Staatsbankrotts) nicht komplett entgehen können. Somit hat die Möglichkeit der Schaffung eines Insolvenzverfahrens für Staaten auch Einzug in wirtschaftliche und politische Diskussionen gefunden. Doch nicht bloß die Entwicklungen in der jüngeren Geschichte verdeutlichen, dass das Insolvenzrisiko von Staaten ein existentes Problem ist. Es kam in der Vergangenheit des Öfteren zu Schuldenkrisen, bei welchen Staaten nicht mehr in der Lage waren, ihre ausstehenden Schulden zu begleichen.[59]
Im Jahr 1907 formulierte der argentinische Außenminister die Drogo-Doktrin, welche besagt, dass militärische Gewalt keine Reaktion auf Staatsverschuldung sein darf. Dies war seine Reaktion auf die von Deutschland und anderen Ländern kurz zuvor durchgeführte Kanonenbootpolitik gegen Venezuela.[60] Zu diesem Zeitpunkt war Venezuela nicht in der Lage, seine Staatsschulden zu begleichen. Dies wurde von den Gläubigern jedoch nicht akzeptiert und somit entsandten die Gläubigerstaaten Kriegsschiffe, um Druck auf Venezuela auszuüben.
Diese Art, mit Staatsschulden zu verfahren, wird heutzutage glücklicherweise nicht mehr angewendet. Jedoch wurde die Insolvenzfähigkeit von Staaten weiterhin geleugnet. Wie bereits erwähnt schließt § 12 InsO sogar die Insolvenzfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich aus.
Erschreckend ist diese Leugnung der Insolvenzmöglichkeit vor allem im Hinblick darauf, dass Staatsschuldenkrisen keine isolierten Einzelfälle sind, sondern es immer wieder zu solchen Situationen gekommen ist.[61] Allerdings gab es schon im Jahre 1900, im Zuge der Haager Friedenskonferenz, die Forderung Russlands, ein Staatsschuldengericht einzurichten.[62] Ein solches Gericht wurde jedoch nie eingerichtet, obwohl sich der Permanent Court of Arbitration (PCA) in Den Haag schon mit ähnlicher Materie beschäftigt hat.[63]
Obwohl die Insolvenzfähigkeit von Staaten nicht anerkannt war, kam es in der Historie des Öfteren zu Versuchen, überschuldete Länder zu restrukturieren. Dies wurde meistens durch Umschuldungsmaßnahmen erreicht. Diese Ad-hoc-Lösungen waren sicherlich nicht immer ideal geeignet, geschweige denn besonders fair. Jedoch lässt sich nicht leugnen, dass zum Teil auch diese Lösungen erfolgreich waren. Als Beispiel ist hier Ägypten zu nennen. Die Gläubiger Ägyptens beschlossen 1876, das Ägyptische Insolvenzrecht auf die Staatsschulden anzuwenden. Erwähnenswert ist hier weiterhin das Londoner Abkommen von 1953, durch das Deutschland in der Nachkriegszeit einen großen Schuldenerlass erlangen konnte.[64]
Eine Wendung der politischen Einstellung ist erst seit Ende des 20. Jahrhundert zu bemerken. Erstmals greifbar wurde die Möglichkeit eines Insolvenzverfahrens für Staaten durch die Argentinienkrise im Jahr 2001. Im Zuge dieser Krise unterbreitete der Internationale Währungsfonds einen Vorschlag zu einem Insolvenzverfahren für bankrotte Staaten. Dieser Vorschlag wurde von Deutschland unterstützt, wies jedoch gravierende Mängel auf und ist auf Grund eines Vetos der USA niemals umgesetzt worden.[65] Die Diskussionen zu diesem Thema sind jedoch nie ganz verebbt und leben mit jeder neuen Staatsschuldenkrise, wie jetzt bei der griechischen, wieder auf.
Im Folgenden Kapitel wird nun die Notwendigkeit eines Insolvenzverfahrens für Staaten dargelegt und im Anschluss daran der Stand der Diskussion, sowie die Vor- und Nachteile eines solchen Verfahrens aufgezeigt.
5.1 Gründe für die Notwendigkeit eines Insolvenzmechanismus für Staaten
5.1.1 Allgemeine Gründe
Derzeit existiert bekanntermaßen kein geregeltes Verfahren für den Umgang mit Staatsschuldenkrisen. Daraus resultiert, dass bei Eintritt einer derartigen Staatsschuldenkrise Schuldner wie Gläubiger auf Ad-hoc-Lösungen angewiesen sind. Zumeist endet diese Situation darin, dass die Lösung der Krise in den Händen der Gläubiger liegt.[66] Es existiert also kein kalkulierbarer Ablauf und keiner der Beteiligten kann sich sicher sein, was als Nächstes passiert. Diese Unklarheit, sowie die Macht in den Händen der Gläubiger, vor allem organisierter Gläubigergruppen, welche im Pariser und Londoner Club[67] (im Folgenden auch als die Clubs bezeichnet) zusammenkommen, ist nicht bloß gefährlich für die Souveränität der Schuldnerstaaten, sondern kann und wird in den meisten Fällen zu einer Ungleichbehandlung führen, die vor allem zu Lasten kleiner Gläubiger ausfallen dürften.
Diese Unklarheit über den Ablauf und Ausgang des Verfahrens sorgt aber nicht nur auf Gläubigerseite zu nachteiligen Reaktionen. Da auch der Schuldner in einer ungewissen Lage ist, wird er alles daran setzen, das Eingeständnis der Zahlungsunfähigkeit so lange wie möglich hinauszuzögern. Dadurch werden naturgemäß auch alle Restrukturierungsmaßnahmen verzögert.[68]
Da es keine Disziplinierungsmaßnahmen gibt, denken Politiker typischer Weise nur im Jetzt. Um vor ihren Wählern gut dazustehen, wollen sie sich nicht eingestehen, dass ihr Land heruntergewirtschaftet ist. Zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit des Staates werden neue Darlehen aufgenommen. Somit müssen die aktuellen Politiker die Probleme der Verschuldung nicht ihren (derzeitigen) Wählern auflasten.[69] Erst zukünftige Generationen haben diese Unverantwortlichkeiten zu Tragen. Unverantwortlich deswegen, weil durch eine erhöhte Neuverschuldung das Problem der Überschuldung nicht gelöst werden kann. Zwar sieht es für die derzeitigen Politiker wie eine Gewinnsituation aus, da sie sich nicht mit den Problemlösungen herumschlagen müssen und ihre Wähler zufrieden sind; die Bewältigung wird jedoch lediglich hinausgezögert, die Schuldenlast erhöht und das Problem damit für die Zukunft verschärft. Paulus vergleicht diese Situation mit den Anfangsgewinnen eines Schneeballsystems. Irgendwann ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem die Schulden soweit angestiegen sind, dass es für einen Staat keine Möglichkeit mehr gibt, diese zu begleichen.[70] Dies findet seinen kritischsten Punkt, wenn allein zur Zinstilgung neue Kredite aufgenommen werden müssen. Heutzutage wird diese Situation zwar teilweise durch diverse Rating Agenturen entschärft, da ihnen zu verdanken ist, dass kritische Schuldner nicht allzu leicht an frisches Kapital kommen. Jedoch könnte die gesamte Problematik eingeschränkt werden, wenn es ein klar strukturiertes Insolvenzverfahren gäbe, welches auch dem Schuldner Anreize bietet, freiwillig an einer Restrukturierung teilzunehmen.[71]
Ein weiteres Problem der unstrukturierten Lösungen entsteht durch Gläubigermaßnahmen, die dazu führen können, dass Staaten zu Handlungen gedrängt werden, die für das Volk zu menschenunwürdigen Lebenssituationen führen können. Es werden also gerade von den Gläubigern zur Befriedigung ihrer Forderungen menschenunwürdige Situationen in den Schuldnerstaaten in Kauf genommen. Als Beispiel sei hier Jamaica genannt, welches beinahe seine gesamten Steuereinnahmen zur Tilgung seiner Schulden verwenden muss.[72] Eng damit verbunden ist die Vorgehensweise der Clubs, die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen abzuhalten. Gerade dieses Verfahren ist unter modernen rechtsstaatlichen Gesichtspunkten als sehr fragwürdig zu betrachten.[73]
Gerade solche Verhandlungen, bei denen die Schuldner durch Druck der Gläubiger beinahe schon genötigt werden, stellen eine unkalkulierbare Gefahr für die Wahrung der Souveränität der Schuldnerstaaten dar. Doch eben die Souveränitätswahrung ist eines der bedeutenden Grundprinzipien der Demokratie und der Rechtstaatlichkeit. Entscheidungen müssen durch Vertreter des Volkes getroffen werden, ansonsten wird das ganze System in seinen Grundfesten erschüttert. Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass es vor allem der arme Teil der Bevölkerung ist, welcher unter den aufgezwungenen Maßnahmen leidet. Es geht um Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um überhaupt so etwas wie ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Wenn ein Staat aber nahezu seine gesamten Steuereinnahmen zur Schuldtilgung aufwenden muss, bleiben logischerweise kaum noch Finanzmittel übrig, um das Volk zu unterstützen. Hier besteht großer Bedarf an einem geregelten Verfahren auf internationaler Ebene, welches die Souveränitätswahrung als ein Grundprinzip verankert und ebenfalls das Kapital des Schuldners untergliedert und eine Art Pfändungsgrenze setzt, dem Staat also Mittel belässt, die er zur Ausführung seiner hoheitlichen Aufgaben dringend benötigt.
Aber nicht bloß diese potentielle Ungerechtigkeit des Verfahrens stellt ein Problem dar. Auch die Unklarheit, welche Maßnahmen als nächstes möglicherweise eingeleitet werden beeinflusst das Verhalten der Finanzmärkte, in der Regel nicht zum Positiven bzw. zumindest hin zu nicht hilfreichen Situationen zur Lösung der Schuldenkrise. Es gibt vor allem zwei Arten der Unsicherheit, welche Gläubiger oftmals zu unüberlegten Handlungen veranlassen. Dies ist zum einen die Unsicherheit darüber, ob ein Schuldnerstaat gewillt und fähig ist, seine Schulden in Zukunft zu tilgen. Die zweite Unsicherheit, besteht in der Unklarheit darüber, wie sich andere Gläubiger verhalten.[74] Sollten die Schuldnerstaaten das Ruder in die Hand nehmen, so laufen diese zwar Gefahr, zukünftig erschwerten Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, jedoch ist es ihnen derzeit möglich, die Restrukturierungsmaßnahmen selbst zu treffen, und den Gläubigern bleibt nur, sich einverstanden zu erklären oder möglicherweise gar nichts zu erhalten. Aus diesen Unsicherheiten entspringt die Gefahr einer Destabilisierung der Finanzmärkte,[75] was bei einer derartigen Situation nicht zur Lösung des Problems beiträgt. Um unter anderem die Finanzmärkte zu beruhigen, herrscht dringender Bedarf an schnellen Handlungen, welche, wie die Griechenlandkrise im Frühjahr 2010 beweist, vor allem aus politischen Gründen nicht zustande kommen können.[76] Dies verdeutlicht den dringenden Bedarf eines geregelten Verfahrens, welches von vornerein den Ablauf und die Schrittfolge klarstellt, damit die Situation für jeden transparent und zumindest teilweise berechenbar wird.
[...]
[1] Vgl. Bontrup, Heinz-J. (2004), S. 68 ff.
[2] Vgl. ebenda, S. 633.
[3] Vgl. ebenda, S. 68.
[4] Vgl. Höhler, Gerd, der Westen (2012).
[5] International Business Times (2011).
[6] Nicht außer Acht gelassen werden darf aber auch die Wichtigkeit der Transferleistungen (wie Arbeitslosengelder und Renten) an Bürger, welche sich in modernen Marktwirtschaften etabliert haben, da Sie zu den eher als unantastbar geltenden Staatsaufgaben zählen sollten.
[7] Bontrup, Heinz-J. (2004), S. 666.
[8] Vgl. Potacs, Michael / Mayer, Claudia (2010), S. 107.
[9] Vgl. Alpmann / Brockhaus (2004), S. 1300.
[10] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010a), S. 12.
[11] erlassjahr.de, zu: Deutscher Bundestag, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Ausschussdrucksache Nr. 17(19)170, (2011), S. 2.
[12] Vgl. Alpmann / Brockhaus (2004), S. 1578.
[13] Vgl. ebenda, S. 174.
[14] Michael Grandt, „Der Staatsbankrott kommt“, S. 106, Kopp-Verlag, zitiert in: Hassel-Reusing, Sarah Luiza (2010).
[15] Vgl. Kramer, Ralph / Peter, Frank K. (2012), S. 27.
[16] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 55, RN 109.
[17] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 56, RN 109.
[18] Vgl. Kramer, Ralph / Peter, Frank K. (2012), S. 28.
[19] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 57, RN 113.
[20] Vgl. edenda, S. 57, RN 113.
[21] Vgl. Kramer, Ralph / Peter, Frank K. (2012), S. 29
[22] Vgl. Breuer, Wolfgang (2011), S. 9, RN 10.
[23] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 5 f. RN 8.
[24] Vgl. Breuer, Wolfgang (2011), S. 9, RN 11.
[25] Vgl. Krüger, Frank (2011), S. 38 ff.
[26] Vgl. Breuer, Wolfgang (2011), S. 15, RN 52.
[27] Vgl. ebenda, S. 15, RN 52.
[28] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 12, RN 18.
[29] Vgl. Breuer, Wolfgang (2011), S. 16, RN 52
[30] Vgl. ebenda, S. 16, RN 55.
[31] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 12 f. RN 19.
[32] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 13, RN 20.
[33] Vgl. Schmidt, Andreas (2009), S. 20, RN 1.
[34] Vgl. ebenda, S. 21, RN 7.
[35] Vgl. ebenda, S. 29, RN 33.
[36] Vgl. Schmidt, Andreas (2009), S. 39, RN 62.
[37] Vgl. Krüger, Frank (2011), S. 108 f.
[38] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 72, RN 139.
[39] Vgl. Krüger, Frank (2011), S. 110.
[40] Vgl. Foerste, Ulrich (2010), S. 10, RN 15.
[41] Vgl. Krüger, Frank (2011), S. 110 ff.
[42] Vgl. Paulus, Christoph G. (2012a), S. 34.
[43] Vgl. Paulus, Christoph G. (2009), S. 13.
[44] Vgl. Reinisch, August (2011), S. 213.
[45] Vgl. Reinisch, August (2010), S. 181.
[46] Vgl. Paulus, Christoph G. (2002b), S. 5.
[47] Vgl. Reinisch, August (2010), S. 181.
[48] Vgl. Paulus, Christoph G. (2002b), S. 5
[49] Vgl. Reinisch, August (2010), S. 181.
[50] Vgl. Paulus, Christoph G. (2002b), S. 5.
[51] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010c), S. 794.
[52] Vgl. Kodek, Georg E. (2010), S. 156.
[53] Vgl. ebenda, S. 157 f.
[54] Vgl. ebenda, S. 158.
[55] Vgl. Raffer, Kunibert (2010), S. 46.
[56] Vgl. ebenda, S. 47.
[57] Paulus, Christoph G. (2010c), S. 796.
[58] Vgl. Paulus, Christoph G. (2009), S. 11.
[59] Vgl. ebenda, S. 11.
[60] Vgl. ebenda, S. 11.
[61] Vgl. Abele, Hanns A. / Schäfer, Guido K. (2011), S. 276.
[62] Vgl. Paulus, Christoph G. (2012a), S. 39.
[63] Mehr zur geleisteten Vorarbeit des PCA in Kapitel 6.2.2.
[64] Vgl. Raffer, Kunibert (2010), S. 36.
[65] Mehr zum Vorschlag eines geordneten Insolvenzverfahrens des IWF in Kapitel 5.6.
[66] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010d), S. 315.
[67] Auf das Verfahren der Pariser und Londoner Clubs wird unter 8.1 zurückzukommen sein.
[68] Vgl. Schwarz, Kyrill-A. (2003), S. 171.
[69] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010b), S. 8.
[70] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010b), S. 8.
[71] Vgl. Schwarz, Kyrill-A. (2003), S. 171.
[72] Vgl. Deutscher Bundestag, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hrsg.), (2011), Experten befürworten Insolvenzverfahren für Staaten.
[73] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010d), S. 315.
[74] Vgl. Bruegel (Hrsg.), (2010), S. 5.
[75] Vgl. Schwarz, Kyrill-A. (2003), S. 171.
[76] Vgl. Paulus, Christoph G. (2010d), S. 328.
Details
- Titel
- Staatsinsolvenzverfahren. Eine Sachstandsanalyse
- Hochschule
- Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen
- Note
- 1,7
- Autor
- Marc André Stuhldreier (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V214165
- ISBN (eBook)
- 9783656425533
- Dateigröße
- 731 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- staatsinsolvenzverfahren eine sachstandsanalyse Staateninsolvenz Staateninsolvenzverfahren Insolvenz von Staaten Insolvenz Chapter 9 Chapter Chapter 11 Insolvenzrecht Internationales Insolvenzrecht municipalities Griechenland Griechenland Krise Bruegel SDT Sovereign Debt Sovereign Debt Tribunal
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 36,99
- Arbeit zitieren
- Marc André Stuhldreier (Autor:in), 2013, Staatsinsolvenzverfahren. Eine Sachstandsanalyse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/214165
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-