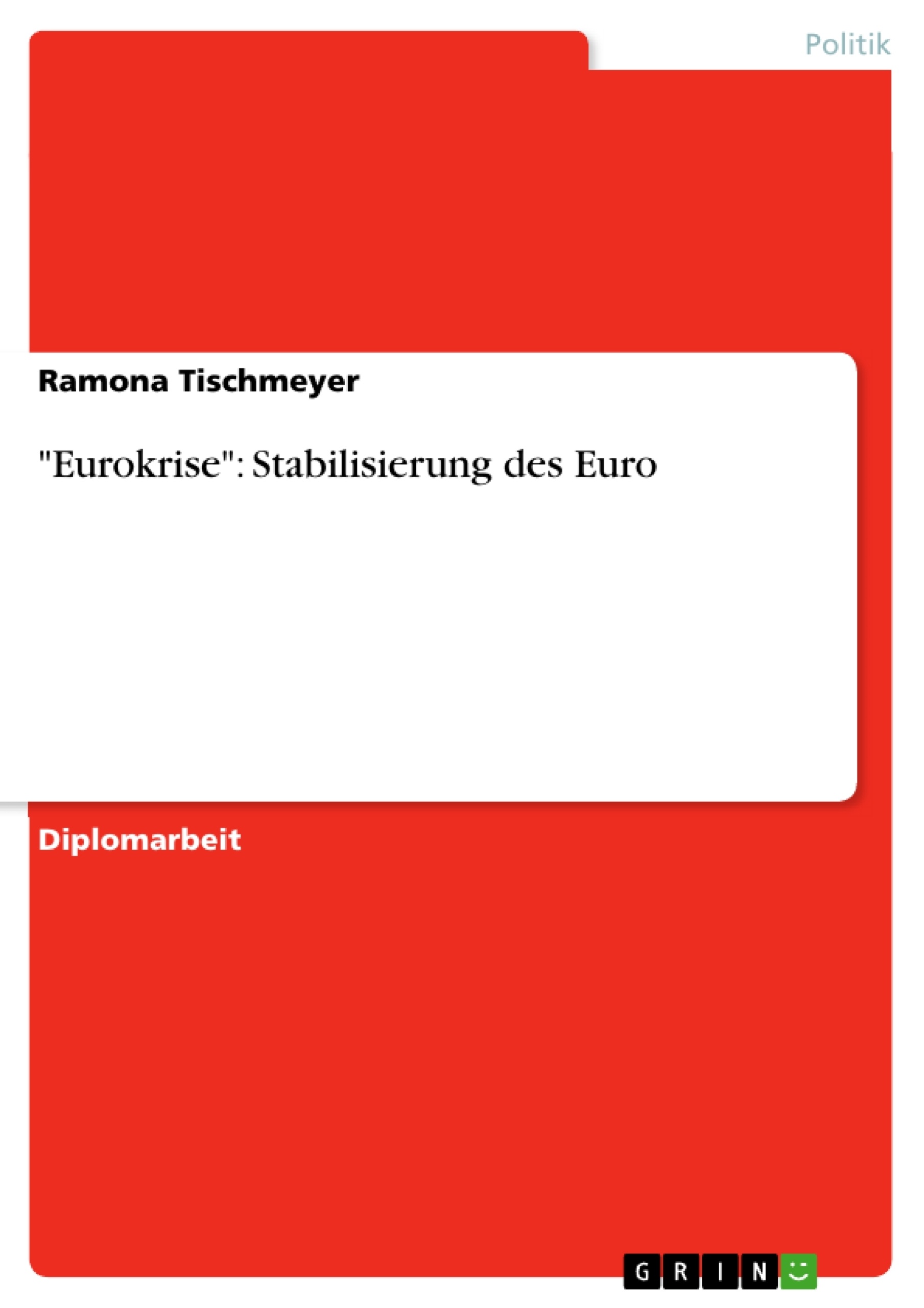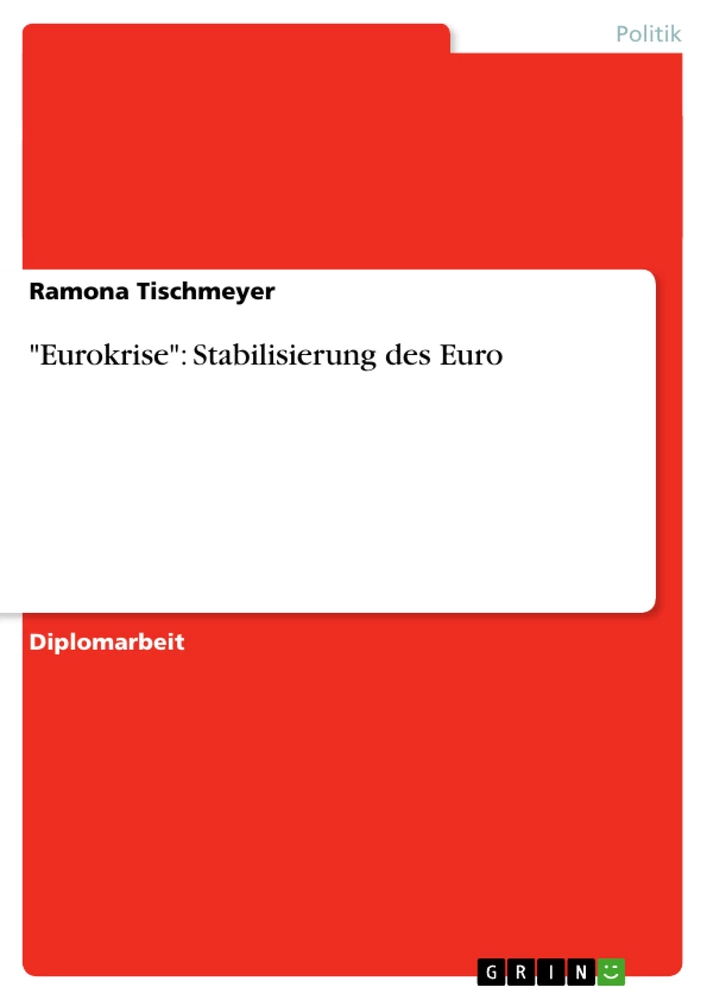
"Eurokrise": Stabilisierung des Euro
Diplomarbeit, 2012
72 Seiten, Note: 3,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Weg des Euro
- 2.1. Die Europäische Währungsunion (EWU)
- 2.2. Warum eine einheitliche Währung?
- 2.3. Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)
- 3. Die „Eurokrise“ – Wie alles begann
- 3.1. Gründe der Krise
- 3.2. Krisenstaaten im Überblick
- 3.2.1. Griechenland
- 3.2.2. Irland
- 3.2.3. Portugal
- 3.2.4. Italien
- 3.2.5. Spanien
- 3.2.6. Zypern
- 4. Maßnahmen gegen die Krise
- 4.1. EU Rettungsmaßnahme „Euro-Rettungsschirm“
- 4.1.1. 1. Griechenland-Hilfspaket
- 4.1.2. Problem: Nichtbeistandsklausel
- 4.1.3. Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
- 4.1.4. Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
- 4.1.5. Fiskalpakt
- 4.1.6. Schuldenschnitt für Griechenland
- 4.1.7. Europäische Bankenunion
- 4.2. Maßnahmen der Krisenländer
- 4.2.1. Griechenland
- 4.2.2. Irland
- 4.2.3. Portugal
- 4.2.4. Italien
- 4.2.5. Spanien
- 4.2.6. Zypern
- 4.1. EU Rettungsmaßnahme „Euro-Rettungsschirm“
- 5. Meinungen und weitere Vorschläge zur „Eurokrise“
- 5.1.1. Harald Langenfeld, Vorstand der Sparkasse Leipzig
- 5.1.2. Hinrich Holm, Vorstand der Norddeutschen Landesbank
- 5.1.3. Hans-Werner Sinn, Chef des Instituts für Wirtschaftsförderung
- 5.1.4. IWF
- 5.1.5. Mario Draghi, Chef der EZB
- 5.1.6. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Eurokrise, beschreibt die Situation der betroffenen Staaten und dokumentiert die getroffenen und geplanten Rettungsmaßnahmen. Zusätzlich werden verschiedene Meinungen und Vorschläge von Experten und Institutionen zur Bewältigung der Krise vorgestellt. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Krise und der Reaktionen darauf zu vermitteln.
- Entstehung der Eurokrise
- Analyse der Situation in den betroffenen Staaten
- Dokumentation der Rettungsmaßnahmen
- Präsentation verschiedener Meinungen und Vorschläge
- Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Eurokrise ein und definiert den Begriff "Krise". Sie beschreibt die Entwicklung der Krise, beginnend mit der Finanzkrise in den USA 2007 und der sich daraus ergebenden Staatsschuldenkrise in der Eurozone ab 2009. Es werden die ersten betroffenen Länder (Griechenland, Irland, Portugal) genannt und die daraufhin eingeleiteten Rettungsmaßnahmen skizziert. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Problems und der Forschungsfrage der Arbeit.
2. Der Weg des Euro: Dieses Kapitel beschreibt den Entstehungsprozess der Europäischen Währungsunion (EWU), die Gründe für die Einführung einer einheitlichen Währung und den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) als Instrument zur Sicherung der Währungsunion. Es legt den historischen Hintergrund für die Krise dar und erklärt die Mechanismen, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Die Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Krisenentwicklung.
3. Die „Eurokrise“ – Wie alles begann: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der Eurokrise und präsentiert einen Überblick über die betroffenen Krisenstaaten. Es geht detailliert auf die Gründe ein, die zur Verschuldung der einzelnen Länder führten und untersucht deren spezifische ökonomische und politische Situationen. Der Abschnitt bietet somit eine umfassende Analyse der Ursachen der Krise und deren Auswirkungen auf die einzelnen betroffenen Staaten.
4. Maßnahmen gegen die Krise: Das Kapitel beschreibt ausführlich die verschiedenen Rettungsmaßnahmen der EU, wie z.B. das erste Griechenland-Hilfspaket, die EFSF, den ESM und den Fiskalpakt. Es erklärt die Funktionsweise dieser Maßnahmen und analysiert deren Auswirkungen auf die betroffenen Länder. Neben den EU-Maßnahmen wird auch auf die Maßnahmen der einzelnen Krisenländer eingegangen, um ein ganzheitliches Bild der Krisenbewältigung zu schaffen.
Schlüsselwörter
Eurokrise, Staatsschuldenkrise, Europäische Währungsunion (EWU), Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), Rettungsmaßnahmen, Griechenland, Irland, Portugal, Italien, Spanien, Zypern, Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Fiskalpakt, Europäische Zentralbank (EZB), Internationaler Währungsfonds (IWF).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Eurokrise
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über die Eurokrise. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Krise, den betroffenen Ländern und den eingeleiteten Rettungsmaßnahmen. Verschiedene Expertenmeinungen werden ebenfalls präsentiert.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung der Eurokrise, die Rolle der Europäischen Währungsunion (EWU) und des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP), die Situation in den betroffenen Ländern (Griechenland, Irland, Portugal, Italien, Spanien, Zypern), die verschiedenen Rettungsmaßnahmen der EU (z.B. EFSF, ESM, Fiskalpakt) und die Maßnahmen der einzelnen Krisenländer. Zusätzlich werden verschiedene Meinungen von Experten und Institutionen wie dem IWF, der EZB und der Deutschen Bundesbank vorgestellt.
Welche Länder waren von der Eurokrise besonders betroffen?
Die am stärksten von der Eurokrise betroffenen Länder waren Griechenland, Irland, Portugal, Italien, Spanien und Zypern. Das Dokument analysiert die spezifischen Ursachen der Schuldenprobleme in diesen Ländern.
Welche Rettungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Eurokrise ergriffen?
Das Dokument beschreibt detailliert die verschiedenen Rettungsmaßnahmen der EU, darunter das erste Griechenland-Hilfspaket, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Fiskalpakt. Es werden auch die Maßnahmen der einzelnen Krisenländer behandelt.
Wer sind die Experten, deren Meinungen im Dokument zitiert werden?
Das Dokument enthält Meinungen und Vorschläge von verschiedenen Experten und Institutionen, darunter Harald Langenfeld (Sparkasse Leipzig), Hinrich Holm (Norddeutsche Landesbank), Hans-Werner Sinn (Institut für Wirtschaftsförderung), der IWF, Mario Draghi (EZB) und Jens Weidmann (Deutsche Bundesbank).
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Der Weg des Euro, 3. Die „Eurokrise“ – Wie alles begann, 4. Maßnahmen gegen die Krise und 5. Meinungen und weitere Vorschläge zur „Eurokrise“.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments ist es, ein umfassendes Bild der Eurokrise und der Reaktionen darauf zu vermitteln. Es untersucht die Entstehung der Krise, analysiert die Situation der betroffenen Staaten, dokumentiert die Rettungsmaßnahmen und präsentiert verschiedene Meinungen und Vorschläge zur Bewältigung der Krise.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments am besten?
Schlüsselwörter sind: Eurokrise, Staatsschuldenkrise, Europäische Währungsunion (EWU), Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), Rettungsmaßnahmen, Griechenland, Irland, Portugal, Italien, Spanien, Zypern, Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Fiskalpakt, Europäische Zentralbank (EZB), Internationaler Währungsfonds (IWF).
Details
- Titel
- "Eurokrise": Stabilisierung des Euro
- Hochschule
- Hochschule Harz - Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)
- Note
- 3,0
- Autor
- Ramona Tischmeyer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 72
- Katalognummer
- V215770
- ISBN (eBook)
- 9783656444251
- ISBN (Buch)
- 9783656444381
- Dateigröße
- 1576 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- eurokrise stabilisierung euro
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Ramona Tischmeyer (Autor:in), 2012, "Eurokrise": Stabilisierung des Euro, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/215770
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-