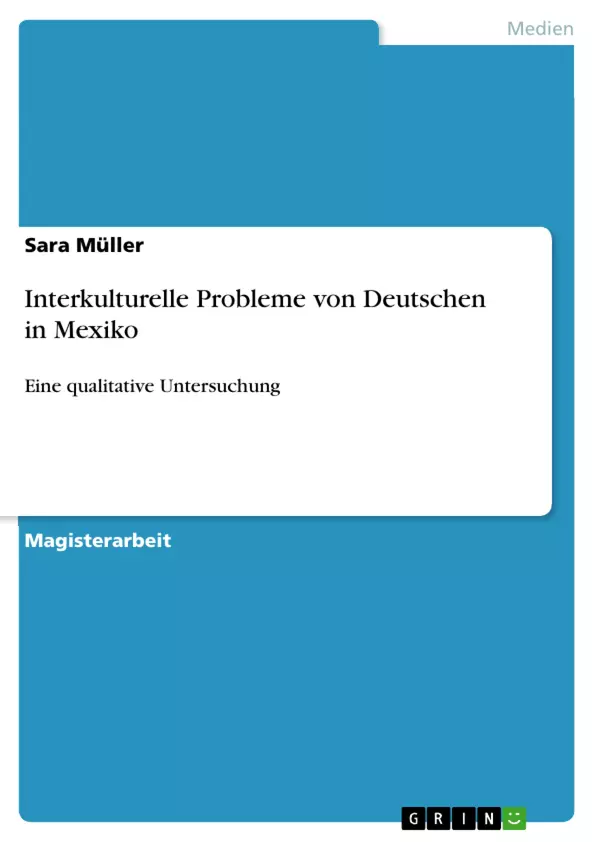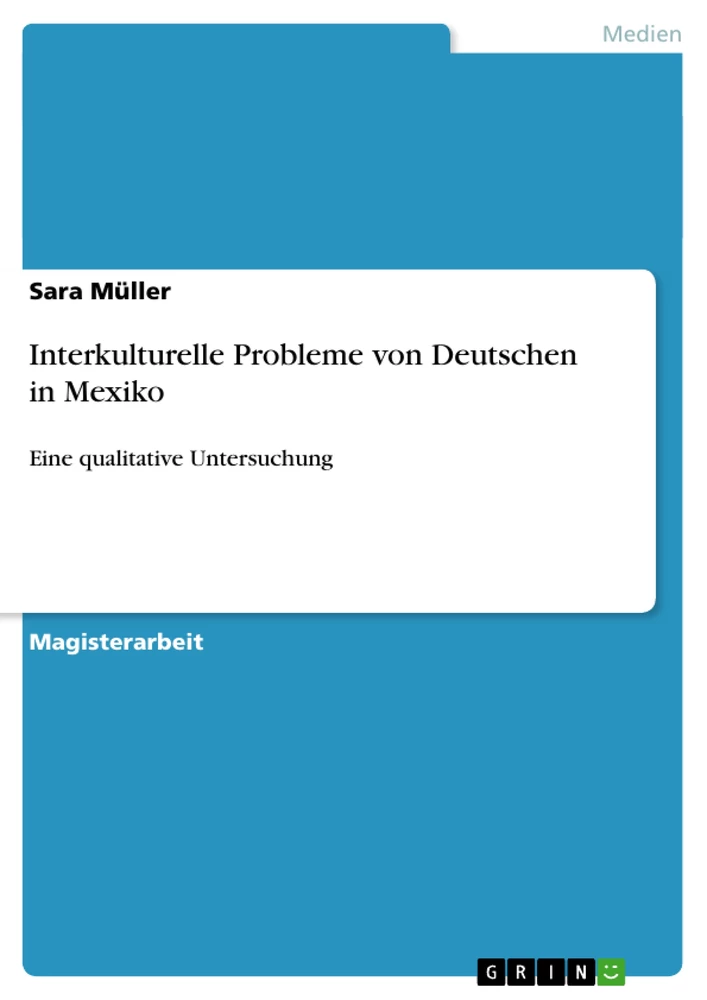
Interkulturelle Probleme von Deutschen in Mexiko
Magisterarbeit, 2010
394 Seiten, Note: 2,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand und Methodik
- Forschungsstand
- Methodik
- Definitionen und Grundlagen
- Interkulturalität – Was ist Kultur?
- Nationalkulturen
- Weitere grundlegende Begriffe
- Stereotypisierung versus kulturelle Unterscheidung
- Unterscheidung zwischen Stereotypisierung und kultureller Kategorisierung
- Entstehung von Stereotypen
- Umgang mit Stereotypen
- Wissenschaftliche Ansätze: Kulturdimensionen und -standards und Kommunikationsmodelle
- Kulturdimensionen
- Kulturstandards
- Kommunikationsmodelle – Friedemann Schulz von Thun interkulturell
- Kulturtiefe
- Begründung der Wahl der Faktoren
- Die rechnerische Darstellung der Kulturtiefe
- Interkulturalität – Was ist Kultur?
- Aufbau und Herangehensweise der Untersuchung
- Aufbau des Fragebogens
- Aufbau und Idee der Gruppendiskussionen
- Herangehensweise an die Auswertung
- Grenzen der Untersuchung
- Auswertung und Analyse
- Auswertung des Fragebogens und der Gruppendiskussionen
- Soziografische Daten
- Selbst- und Fremdbild
- Gefallen und Missfallen
- Gesprächsverhalten
- Unpünktlichkeit
- Körperkontakt
- Organisation
- Kulturelle Umstellung und Anpassung
- Indirektheit
- Kulturschock
- Selbstveränderung
- Vermissen an Deutschland und an Mexiko
- Feedback zur Umfrage
- Vergleichende Auswertung nach Kulturtiefenkategorien
- Auswertung des Fragebogens und der Gruppendiskussionen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht interkulturelle Probleme, die Deutsche in Mexiko erleben und wie diese Probleme bewältigt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung des Konzepts „Kulturtiefe“ und dessen Anwendbarkeit auf die beschriebenen interkulturellen Herausforderungen. Die Arbeit analysiert, wie verschiedene Faktoren (Aufenthaltsgrund, Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse und soziale Kontakte) die Integration in die mexikanische Kultur beeinflussen.
- Wahrnehmung kultureller Unterschiede zwischen deutscher und mexikanischer Kultur
- Interkulturelle Probleme von Deutschen in Mexiko
- Bewältigungsstrategien interkultureller Herausforderungen
- Das Konzept der „Kulturtiefe“ und dessen Validität
- Einfluss soziografischer Faktoren auf die interkulturelle Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Magisterarbeit ein und erläutert die grundlegenden Herausforderungen des Lebens in einer fremden Kultur. Es wird auf die Unterschiede zwischen deutscher und mexikanischer Kultur hingewiesen und die steigende Zahl deutscher Staatsbürger in Mexiko thematisiert. Das Kapitel beschreibt das Ziel der Arbeit, interkulturelle Probleme aufzuzeigen und das Konzept der „Kulturtiefe“ zu untersuchen, welches die Integration in die mexikanische Kultur anhand von vier Schlüsselfaktoren misst. Schließlich wird der Aufbau der Arbeit skizziert.
2. Forschungsstand und Methodik: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu interkulturellen Problemen von Deutschen in Mexiko, wobei die Knappheit umfassender Studien hervorgehoben wird. Es werden einige relevante Arbeiten und deren Limitationen diskutiert, wie z.B. die Arbeit von Cramer und Hofstede. Das Kapitel beschreibt anschließend die methodische Vorgehensweise, die auf einer Onlineumfrage, sowie zwei Gruppendiskussionen (eine deutschsprachige und eine gemischtsprachige) basiert. Die verwendeten Forschungsmethoden und ihre Grenzen werden erläutert.
3. Definitionen und Grundlagen: Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit einer Diskussion über den vielschichtigen Kulturbegriff und unterschiedlichen Definitionen aus verschiedenen Disziplinen. Es wird der Begriff der Nationalkultur erläutert und die Herausforderungen der Generalisierung kultureller Merkmale diskutiert. Der Kulturschock und die Bedeutung von Selbst- und Fremdbild werden als relevante Konzepte eingeführt. Schließlich werden die Entstehung und der Umgang mit Stereotypen im interkulturellen Kontext erörtert, gefolgt von einer Präsentation zentraler wissenschaftlicher Ansätze (Hofstede, Hall, Trompenaars, Schulz von Thun), die für die Arbeit relevant sind. Abschließend wird das eigens entwickelte Konzept der „Kulturtiefe“ definiert und begründet.
4. Aufbau und Herangehensweise der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Methodik der durchgeführten Online-Umfrage. Die einzelnen Fragenblöcke werden erläutert, wobei die einzelnen Fragen zur Erhebung soziografischer Daten, Selbst- und Fremdbild, Gefühlen, Gesprächsverhalten, Unpünktlichkeit, Körperkontakt, Organisation, Anpassung, Indirektheit, Kulturschock, Selbstveränderung und Vermissen detailliert dargestellt werden. Der Aufbau und die Durchführung der Gruppendiskussionen werden beschrieben. Abschließend werden die verwendeten Auswertungsmethoden (qualitative und quantitative Analyse) sowie die Grenzen der Untersuchung dargelegt.
5. Auswertung und Analyse: Dieses Kapitel enthält die detaillierte Auswertung und Analyse der Daten aus der Onlineumfrage und den Gruppendiskussionen. Die Ergebnisse werden für verschiedene Kategorien (soziografische Daten, Selbst- und Fremdbild, Gefallen und Missfallen, etc.) dargestellt und umfassend interpretiert. Die Ergebnisse werden in Bezug auf das Konzept "Kulturtiefe" diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Interkulturelle Herausforderungen Deutscher in Mexiko
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die interkulturellen Probleme, die Deutsche während ihres Aufenthalts in Mexiko erleben, und wie diese Probleme bewältigt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Konzept der „Kulturtiefe“ und dessen Anwendbarkeit auf die beschriebenen interkulturellen Herausforderungen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von Faktoren wie Aufenthaltsgrund, Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse und soziale Kontakte auf die Integration in die mexikanische Kultur.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Online-Umfrage und zwei Gruppendiskussionen (eine deutschsprachige und eine gemischtsprachige). Die Daten wurden sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet. Die Grenzen der verwendeten Methoden werden ebenfalls in der Arbeit diskutiert.
Welche kulturellen Unterschiede werden untersucht?
Die Arbeit untersucht eine Vielzahl kultureller Unterschiede zwischen der deutschen und der mexikanischen Kultur, die zu interkulturellen Problemen führen können. Beispiele hierfür sind Unterschiede im Gesprächsverhalten, Umgang mit Pünktlichkeit, Körperkontakt, Organisationsstrukturen und der Grad an Direktheit in der Kommunikation. Die Arbeit beleuchtet auch die Themen Kulturschock, Selbstveränderung und das Vermissen der Heimat.
Was ist das Konzept der „Kulturtiefe“?
Das Konzept der „Kulturtiefe“ ist ein in der Arbeit entwickeltes Modell, das die Integration in die mexikanische Kultur anhand von vier Schlüsselfaktoren (die im Detail in der Arbeit erläutert werden) misst. Die Arbeit untersucht die Validität dieses Konzepts und seine Anwendung auf die erfassten interkulturellen Herausforderungen.
Welche soziografischen Faktoren werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt verschiedene soziografische Faktoren, wie z.B. Aufenthaltsgrund, Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse und die Anzahl sozialer Kontakte, um deren Einfluss auf die interkulturelle Integration zu analysieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Forschungsstand und Methodik, Definitionen und Grundlagen, Aufbau und Herangehensweise der Untersuchung sowie Auswertung und Analyse. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel „Auswertung und Analyse“ präsentiert detaillierte Ergebnisse der Online-Umfrage und der Gruppendiskussionen. Die Ergebnisse werden für verschiedene Kategorien (soziografische Daten, Selbst- und Fremdbild, Gefallen und Missfallen, etc.) dargestellt und im Kontext des Konzepts „Kulturtiefe“ interpretiert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im letzten Kapitel.
Welche wissenschaftlichen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene wissenschaftliche Ansätze, darunter die Arbeiten von Hofstede, Hall, Trompenaars und Schulz von Thun, um die theoretischen Grundlagen für die Analyse interkultureller Kommunikation und Unterschiede zu legen.
Welche Limitationen der Studie werden erwähnt?
Die Arbeit diskutiert die Limitationen der verwendeten Methoden und des Stichprobenumfangs. Diese Limitationen werden transparent dargelegt, um die Ergebnisse angemessen einzuordnen.
Wo finde ich die detaillierten Ergebnisse?
Die detaillierten Ergebnisse der Auswertung und Analyse der Daten finden sich im fünften Kapitel der Magisterarbeit.
Details
- Titel
- Interkulturelle Probleme von Deutschen in Mexiko
- Untertitel
- Eine qualitative Untersuchung
- Hochschule
- Universität Hildesheim (Stiftung)
- Veranstaltung
- Internationales Informationsmanagement
- Note
- 2,7
- Autor
- Magister Sara Müller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 394
- Katalognummer
- V215838
- ISBN (eBook)
- 9783656444756
- ISBN (Buch)
- 9783656445289
- Dateigröße
- 4799 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- interkulturelle probleme deutschen mexiko eine untersuchung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Magister Sara Müller (Autor:in), 2010, Interkulturelle Probleme von Deutschen in Mexiko, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/215838
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-