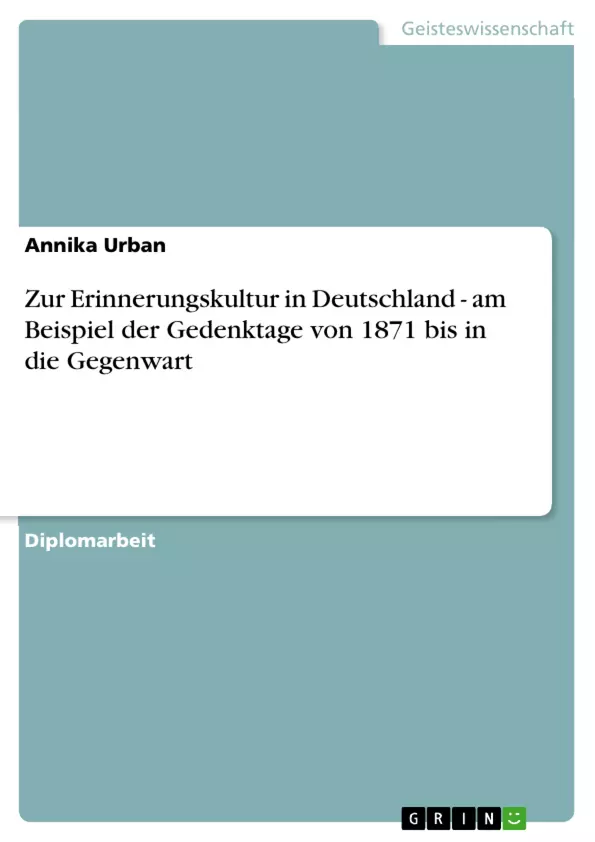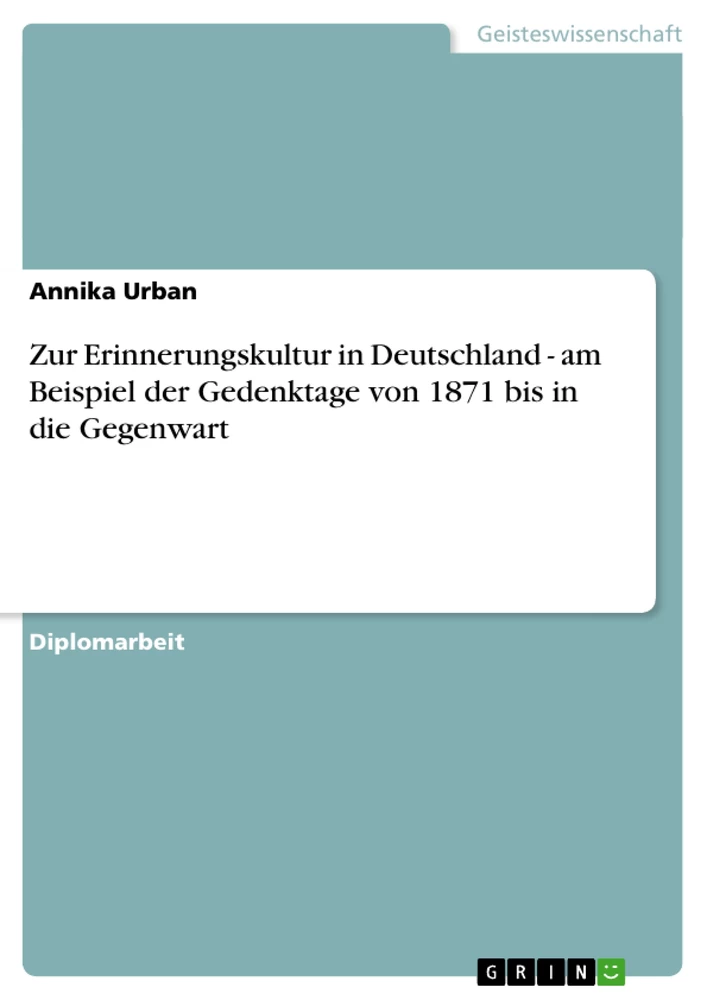
Zur Erinnerungskultur in Deutschland - am Beispiel der Gedenktage von 1871 bis in die Gegenwart
Diplomarbeit, 2003
105 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gedächtnis der Gesellschaft
- Erinnerung und Gedächtnis
- Das Gedächtnis als soziale Konstruktion
- Das kommunikative Gedächtnis
- Der Übergang als „floating gap“?
- Das kulturelle Gedächtnis
- Exkurs - Das kollektive Gedächtnis
- Formen des Kollektivgedächtnisses
- Gedenken
- Gedenktag
- Öffentliche Gedenktage in Deutschland
- Öffentliche Gedenktage im Kaiserreich 1871-1918
- Der Sedantag
- Kaisergeburtstage
- Öffentliche Gedenktage in der Weimarer Republik 1918-1933
- Der 1. Mai
- Der Volkstrauertag
- Der Verfassungstag
- Öffentliche Gedenktage im Dritten Reich 1933-1945
- Der 1. Mai im Nationalsozialismus
- Der Heldengedenktag
- Der Führergeburtstag am 20. April
- Der Erntedanktag
- Öffentliche Gedenktage in der DDR 1949-1989
- Der politische Mythos
- Der Antifaschismus als Gründungsmythos
- Die „Befreiung“
- Gedenktage und ihre Inszenierung
- Der politische Mythos
- Öffentliche Gedenktage in der Bundesrepublik 1949-1989
- Der 7. September
- Der 17. Juni
- Der 20. Juli
- Der 8. Mai
- Historikerstreit
- Inszenierung der Gedenktage
- Exkurs - Der 9. November
- Öffentliche Gedenktage in der Bundesrepublik seit 1990
- Der 27. Januar
- Der 3. Oktober
- Öffentliche Gedenktage im Kaiserreich 1871-1918
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erinnerungskultur in Deutschland anhand öffentlicher Gedenktage von 1871 bis in die Gegenwart. Ziel ist es, die Entwicklung und die Bedeutung von Gedenktagen als Ausdruck des jeweiligen Geschichtsbewusstseins und der politischen Kultur zu analysieren.
- Entwicklung des Konzepts von Erinnerung und Gedächtnis im gesellschaftlichen Kontext
- Die Rolle öffentlicher Gedenktage als politische Symbole
- Veränderung der Erinnerungskultur in den verschiedenen politischen Systemen Deutschlands
- Inszenierung und Instrumentalisierung von Gedenktagen
- Zusammenhang zwischen Erinnerungskultur und nationaler Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Erinnerungskultur in Deutschland ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung von Nation und Identität in öffentlichen Debatten nach 1990 und verortet die vorliegende Arbeit im Kontext existierender Forschungsansätze zur Identitätskonstruktion, wobei sie die Ansätze von Giesen, Rüsen, Welzer, Reichel, Dubiel und Esposito kritisch beleuchtet und den eigenen Fokus auf die Erinnerung und Erinnerungskultur als zentralen Bezugspunkt für ein kollektives Selbstverständnis herausstellt. Die Arbeit stützt sich dabei auf die theoretischen Grundlagen von Aleida und Jan Assmann und Maurice Halbwachs. Die Bedeutung öffentlicher Gedenktage als ritualisierte Formen der Vergegenwärtigung von Vergangenheit und als Indikatoren für Veränderungen nationaler, politischer und kultureller Identitäten wird hervorgehoben.
Das Gedächtnis der Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit theoretischen Grundlagen der Erinnerung und des Gedächtnisses. Es analysiert die Konzepte von Erinnerung und Gedächtnis, das Gedächtnis als soziale Konstruktion, das kommunikative Gedächtnis, den Übergang als „floating gap“, das kulturelle Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis und dessen Formen sowie die Konzepte von Gedenken und Gedenktag. Es legt somit den theoretischen Rahmen für die Analyse der öffentlichen Gedenktage in den folgenden Kapiteln.
Öffentliche Gedenktage in Deutschland: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse der öffentlichen Gedenktage in Deutschland von 1871 bis in die Gegenwart, unterteilt nach den jeweiligen politischen Systemen: Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes Reich, DDR und Bundesrepublik. Es untersucht für jede Epoche die spezifischen Gedenktage, deren Inszenierung und die dahinterstehenden politischen und ideologischen Intentionen. Es wird deutlich, wie Gedenktage als politische Werkzeuge benutzt wurden, um bestimmte Geschichtsdeutungen zu propagieren und kollektive Identitäten zu formen oder zu verändern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Öffentliche Gedenktage in Deutschland
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Erinnerungskultur in Deutschland anhand öffentlicher Gedenktage von 1871 bis in die Gegenwart. Sie untersucht die Entwicklung und Bedeutung dieser Gedenktage als Ausdruck des jeweiligen Geschichtsbewusstseins und der politischen Kultur.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Konzepts von Erinnerung und Gedächtnis im gesellschaftlichen Kontext, die Rolle öffentlicher Gedenktage als politische Symbole, die Veränderung der Erinnerungskultur in verschiedenen politischen Systemen Deutschlands, die Inszenierung und Instrumentalisierung von Gedenktagen und den Zusammenhang zwischen Erinnerungskultur und nationaler Identität.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die theoretischen Grundlagen von Aleida und Jan Assmann und Maurice Halbwachs. Sie beleuchtet und diskutiert kritisch die Ansätze von Giesen, Rüsen, Welzer, Reichel, Dubiel und Esposito zur Identitätskonstruktion.
Welche Epochen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die öffentlichen Gedenktage im Deutschen Kaiserreich (1871-1918), in der Weimarer Republik (1918-1933), im Dritten Reich (1933-1945), in der DDR (1949-1989), und in der Bundesrepublik Deutschland (1949-1989 und seit 1990).
Welche konkreten Gedenktage werden analysiert?
Die Arbeit analysiert eine Vielzahl von Gedenktagen, darunter der Sedantag, Kaisergeburtstage, der 1. Mai, der Volkstrauertag, der Verfassungstag, der 1. Mai im Nationalsozialismus, der Heldengedenktag, der Führergeburtstag, der Erntedanktag, der 7. September, der 17. Juni, der 20. Juli, der 8. Mai, der 9. November, der 27. Januar und der 3. Oktober. Die Analyse umfasst jeweils die jeweilige Inszenierung und die politischen und ideologischen Intentionen.
Wie werden die Gedenktage im Kontext der jeweiligen politischen Systeme betrachtet?
Die Arbeit zeigt, wie Gedenktage als politische Werkzeuge benutzt wurden, um bestimmte Geschichtsdeutungen zu propagieren und kollektive Identitäten zu formen oder zu verändern. Für jede Epoche werden die spezifischen Gedenktage, deren Inszenierung und die dahinterstehenden politischen und ideologischen Intentionen untersucht.
Welche Konzepte zu Erinnerung und Gedächtnis werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Konzepte wie Erinnerung und Gedächtnis, das Gedächtnis als soziale Konstruktion, das kommunikative Gedächtnis, den Übergang als „floating gap“, das kulturelle Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis, Gedenken und Gedenktag.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen des Gedächtnisses der Gesellschaft, ein Kapitel zur umfassenden Analyse öffentlicher Gedenktage in Deutschland (aufgeteilt nach den verschiedenen politischen Systemen) und eine Zusammenfassung.
Details
- Titel
- Zur Erinnerungskultur in Deutschland - am Beispiel der Gedenktage von 1871 bis in die Gegenwart
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Institut für Soziologie)
- Note
- 1,3
- Autor
- Annika Urban (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 105
- Katalognummer
- V22140
- ISBN (eBook)
- 9783638255646
- ISBN (Buch)
- 9783638841146
- Dateigröße
- 736 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Erinnerungskultur Deutschland Beispiel Gedenktage Gegenwart
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Annika Urban (Autor:in), 2003, Zur Erinnerungskultur in Deutschland - am Beispiel der Gedenktage von 1871 bis in die Gegenwart, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/22140
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-