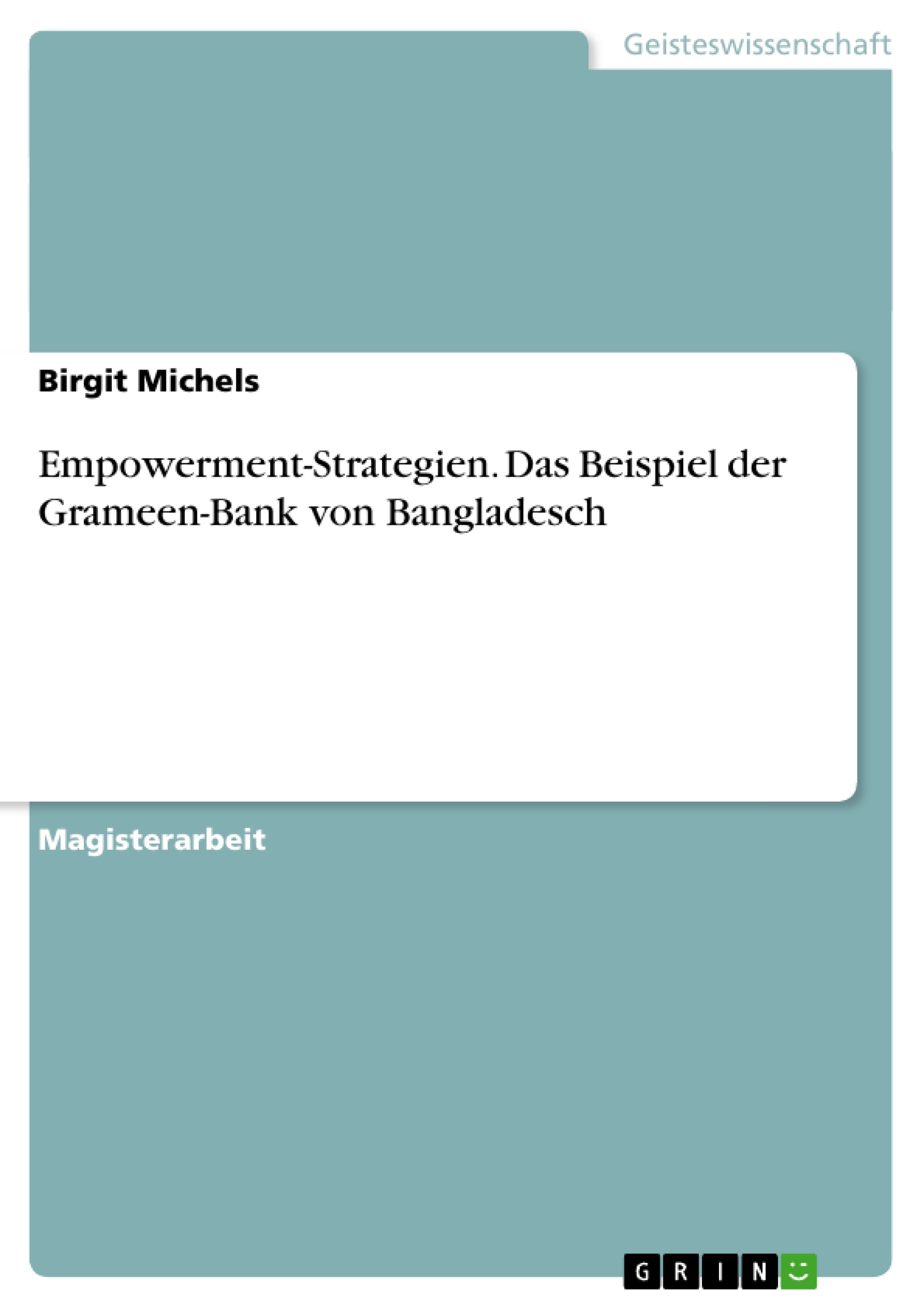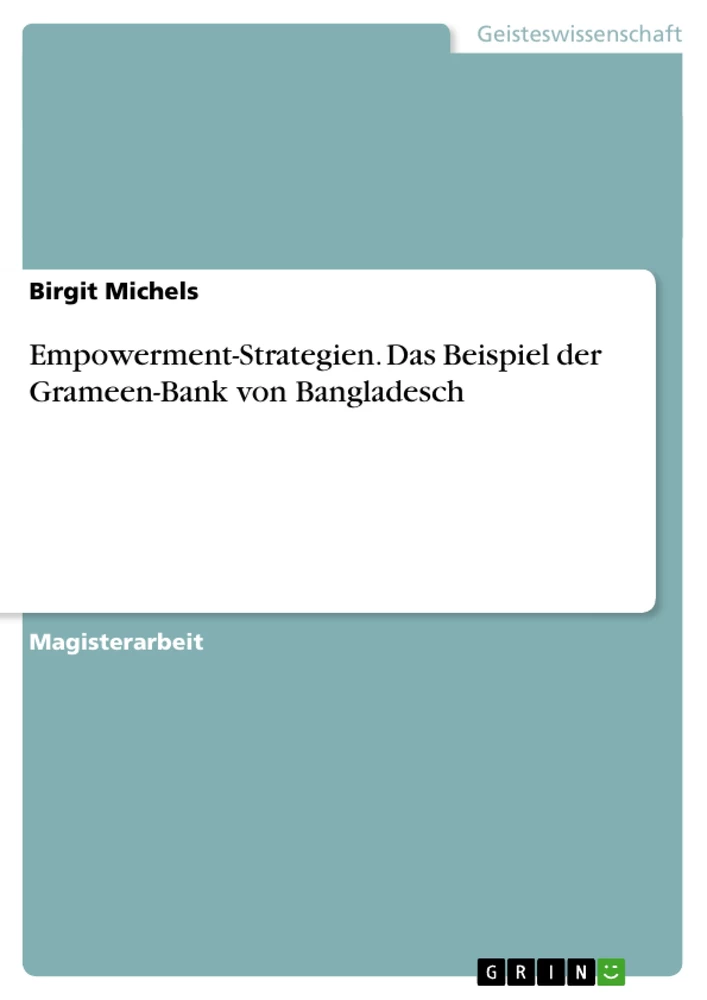
Empowerment-Strategien. Das Beispiel der Grameen-Bank von Bangladesch
Magisterarbeit, 2003
97 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema und Abgrenzung
- 1.1. Ziel der Untersuchung
- 1.2. Aufbau und Inhalt der Untersuchung
- 2. Eine gender-sensible Betrachtung des Bedeutungsfeldes 'Empowerment'
- 2.1. Strukturelle Determinanten von Disempowerment
- 2.2. Zur Zentralität des Machtdiskurses im Empowerment-Ansatz
- 2.3. Das Idealmodell eines Empowerment-Prozesses
- 3. Untersuchung von Mikrokrediten der Grameen-Bank als Instrument des Frauen-Empowerments
- 3.1. Zwischen Tradition und Neubeginn: Veränderungspotentiale der gesellschaftlichen Position von Frauen in Bangladesch
- 3.1.1. Rahmenbedingungen: Lebensalltag bengalischer Frauen
- 3.1.2. Zur Relativität normativer Ansprüche
- 3.2. Projektverlauf und Hintergründe der Grameen-Bank
- 3.3. Evaluierungen zur Grameen-Bank
- 3.3.1. Herangehensweisen von Evaluierungen mit Empowerment bejahendem Ergebnis
- 3.3.2. Herangehensweisen von Evaluierungen mit Empowerment verneinendem Ergebnis
- 3.3.3. Ursachen für heterogene Ergebnisse im Forschungsdiskurs
- 4. Die Empowerment-Wirkungskette dargestellt am Beispiel von Mikrokrediten der Grameen-Bank
- 4.1. Die Visibilisierung des ‘unsichtbaren Geschlechts’ als Auslöser einer Wirkungskette
- 4.1.1. Die erste Hürde: Motive für das aktive Heraustreten aus Marginalisierung und Fremdbestimmung
- 4.1.2. Mehr als bloße Kreditsicherheit: Die Erzeugung eines Wir-Gefühls in den Frauenspargruppen
- 4.1.3. Die Bedeutung von Vorbildern und Innovatoren
- 4.2. Wandel der Wahrnehmung: Prozesse soziokultureller Aufwertung
- 4.2.1. Partizipation als selbstwertdienlicher Mechanismus
- 4.2.2. Von der Hausfrau zur Familien-Ernährerin: Auswirkungen auf das haushaltsinterne Machtgefüge
- 4.2.3. Anerkennung oder Duldung? Zur Außenwahrnehmung und Akzeptanz von Kreditnehmerinnen in der bengalischen Gesellschaft
- 4.3. Neue Horizonte: Allokation von Krediten als erstmalige Chance einer eigenständigen Lebensgestaltung
- 4.3.1. Die Bedeutung eines Bewusstseins für monetäre Mechanismen als Grundlage für individuelle Lebensplanung
- 4.3.2. Beseitigung formaler Barrieren: Die Erschließung überindividueller Handlungsoptionen
- 4.3.3. Handlungsfelder zwischen Kapitalvermehrung und -konvertierung
- 4.4. Empowerment - Chance zur Überwindung des klassischen Determinismus oder Schaffung von Frauen-Nischen?
- 4.5. Schwierigkeiten und Barrieren im Empowerment-Konzept der Grameen-Bank
- 4.6. Investitionen in die Zukunft: Zu Nachhaltigkeit und Perspektiven gesellschaftlichen Wandels
- 5. Fazit und Ausblick: Multidimensionales Erklärungsmodell zur Erklärung von Empowerment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Empowerment-Strategien der Grameen-Bank in Bangladesch und analysiert die Auswirkungen von Mikrokrediten auf die Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Frauen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Mikrokrediten auf die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen, die Herausforderungen und Chancen des Empowerment-Ansatzes und die Bedeutung von soziokulturellen Faktoren für die nachhaltige Veränderung von Frauenleben.
- Frauen-Empowerment in Entwicklungsländern
- Mikrokredite als Instrument des Empowerments
- Die Rolle der Grameen-Bank in der Förderung von Frauen
- Soziokulturelle Faktoren und ihre Auswirkungen auf Empowerment
- Nachhaltigkeit von Empowerment-Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Frauenempowerment-Strategien in Entwicklungsländern ein und grenzt die Untersuchung ab. Es werden die Zielsetzung und der Aufbau der Magisterarbeit erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich mit einer gender-sensiblen Betrachtung des Begriffs "Empowerment". Dabei werden die strukturellen Determinanten von Disempowerment, die Bedeutung des Machtdiskurses und das Idealmodell eines Empowerment-Prozesses analysiert. Kapitel drei untersucht Mikrokredite der Grameen-Bank als Instrument des Frauen-Empowerments in Bangladesch. Es analysiert die gesellschaftliche Position von Frauen in Bangladesch, den Projektverlauf und die Hintergründe der Grameen-Bank sowie die Evaluierungen ihrer Arbeit. Kapitel vier beleuchtet die Empowerment-Wirkungskette, die durch Mikrokredite der Grameen-Bank ausgelöst wird. Es untersucht die Motive für das aktive Heraustreten von Frauen aus Marginalisierung und Fremdbestimmung, die Entstehung eines Wir-Gefühls in Frauenspargruppen sowie die Bedeutung von Vorbildern und Innovatoren. Das Kapitel analysiert außerdem den Wandel der Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft, die Auswirkungen auf das haushaltsinterne Machtgefüge und die Akzeptanz von Kreditnehmerinnen in der bengalischen Gesellschaft. Weiterhin werden die neuen Möglichkeiten, die durch die Allokation von Krediten entstehen, untersucht.
Schlüsselwörter
Frauen-Empowerment, Mikrokredite, Grameen-Bank, Bangladesch, Gender, Soziokulturelle Faktoren, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Handlungsoptionen, Marginalisierung, Fremdbestimmung, Partizipation, Machtgefüge, Lebensbedingungen, gesellschaftliche Position.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Grameen-Bank in Bangladesch?
Das Ziel ist das Empowerment von Frauen durch die Vergabe von Mikrokrediten, um Armut zu lindern und Selbsthilfe auf individueller und struktureller Ebene zu ermöglichen.
Wie funktioniert der Empowerment-Mechanismus durch Mikrokredite?
Durch Kapitalallokation erhalten Frauen Ressourcen für eine eigenständige Lebensgestaltung, was zu einem Wandel im haushaltsinternen Machtgefüge und soziokultureller Aufwertung führt.
Welche soziokulturellen Faktoren beeinflussen das Empowerment in Bangladesch?
Traditionelle Rollenbilder, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen und bestehende Herrschaftsverhältnisse sind entscheidende Faktoren, die den Prozess entweder fördern oder behindern.
Welche Bedeutung haben Frauenspargruppen für das Konzept?
Diese Gruppen erzeugen ein Wir-Gefühl und dienen als soziale Absicherung sowie als Raum für kollektives Handeln außerhalb der Marginalisierung.
Gibt es auch Kritik am Empowerment-Konzept der Grameen-Bank?
Ja, die Arbeit untersucht auch Barrieren und Evaluierungen mit negativen Ergebnissen, um zu prüfen, ob lediglich "Frauen-Nischen" geschaffen werden statt struktureller Unterdrückung zu überwinden.
Wie verändert sich die Rolle der Frau innerhalb der Familie?
Frauen entwickeln sich oft von der reinen Hausfrau zur Familien-Ernährerin, was ihre Position im Entscheidungsprozess des Haushalts stärkt.
Details
- Titel
- Empowerment-Strategien. Das Beispiel der Grameen-Bank von Bangladesch
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Soziologisches Seminar)
- Note
- 1,5
- Autor
- Birgit Michels (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V22750
- ISBN (eBook)
- 9783638260190
- ISBN (Buch)
- 9783638717458
- Dateigröße
- 1466 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Analyse beschäftigt sich mit einem in emanzipatorischer und entwicklungspolitischer Absicht induzierten Prozess der Frauenförderung und untersucht dessen Wirkungen, Auswirkungen, Folgen. Am Beispiel der Grameen-Bank von Bangladesch werden mit Mikrokreditallokation zusammenhängende Mechanismen des Wandels/des Empowerments als Wirkungskette multidimensional analysiert. Untersuchungstyp: Evaluationsstudie/Folgenabschätzungsforschung
- Schlagworte
- Empowerment-Strategien Beispiel Grameen-Bank Bangladesch
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Birgit Michels (Autor:in), 2003, Empowerment-Strategien. Das Beispiel der Grameen-Bank von Bangladesch, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/22750
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-