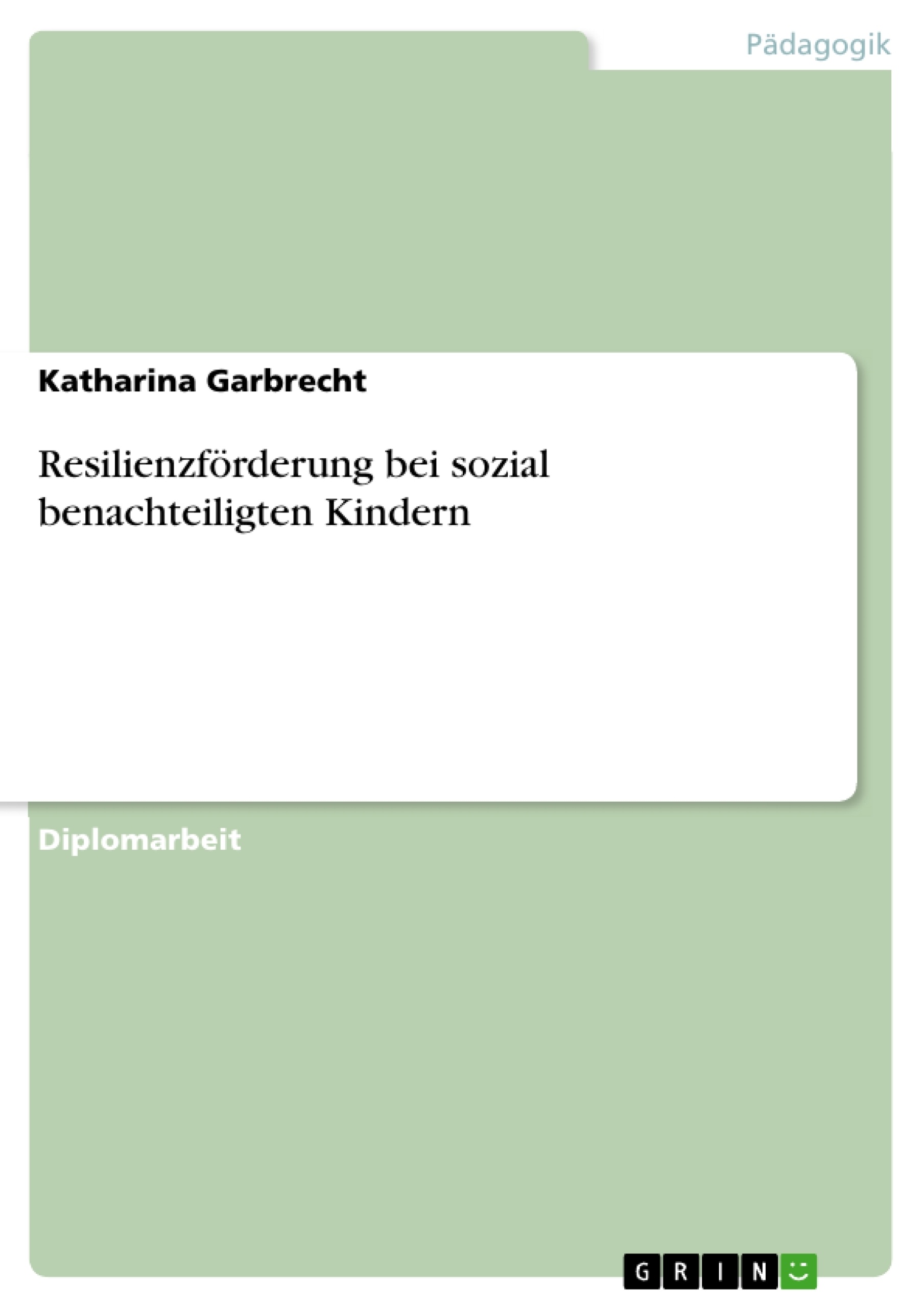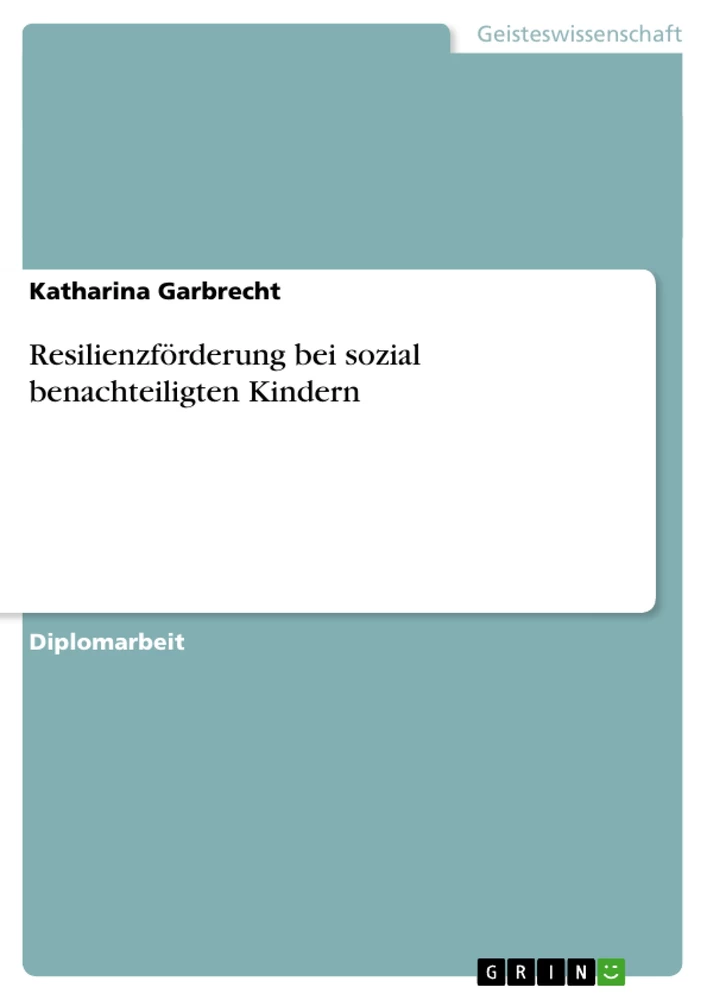
Resilienzförderung bei sozial benachteiligten Kindern
Diplomarbeit, 2013
73 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Genderaspekt
- 2 Das Resilienzkonzept
- 2.1 Das Konzept der Salutogenese
- 2.2 Zum Begriff der Resilienz
- 2.3 Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren
- 2.4 Resilienzmodelle
- 2.4.1 Das Kompensationsmodell
- 2.4.2 Herausforderungsmodell
- 2.4.3 Das Interaktionsmodell
- 2.4.4 Kumulationsmodell
- 2.5 Das Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer
- 2.6 Die Anfänge der Resilienzforschung
- 2.6.1 Die Kauai- Studie
- 2.6.2 Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- 2.7 Das Konzept der Risikofaktoren
- 3 Die soziale Benachteiligung
- 3.1 Die relative Armut als Risikofaktor
- 3.1.1 Einkommensarmut
- 3.1.2 Lebenslagekonzept
- 3.2 Kinder in Armut
- 3.2.1 Das Bildungspaket
- 3.3 Unterschiedliche Auswirkungen der familiären Armutslage auf Jungen und Mädchen
- 3.4 Materielle Notlage und Fehlernährung
- 4 Bedeutung von Kinderarmut für die Bildungszukunft
- 5 Resilienzförderung
- 5.1 Das Konzept der Bewältigungsstrategien
- 5.2 Protektive Faktoren
- 5.3 Handlungskonzepte zur Resilienzförderung
- 5.3.1 Das kindzentrierte Konzept nach Edith Grotberg
- 5.4 Resilienzförderung in der Institution Schule
- 5.5 Ganztagsschulangebot von bildungspolitischer Seite
- 5.6 Was macht Schulen zu Brennpunktschulen?
- 5.7 Resilienzförderung versus Stigmatisierung
- 5.7.1 Exkurs: Grunderkenntnis der modernen Neurobiologie
- 5.8 Resilienzfördernde Kompetenzentwicklung im Unterricht
- 5.8.1 Stärkung der Ich- und Sozialkompetenzen durch reformpädagogische Maßnahmen
- 5.8.2 Der offene Unterricht
- 5.9 Beispiele für den Unterricht zur Resilienzförderung
- 5.10 Beteiligung von Eltern
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Resilienz bei sozial benachteiligten Kindern, insbesondere im Kontext von Armut. Die Zielsetzung ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Resilienzförderung in pädagogischen Einrichtungen, vor allem in der Schule, zu beleuchten.
- Das Resilienzkonzept und seine verschiedenen Modelle
- Soziale Benachteiligung und Armut als Risikofaktoren
- Auswirkungen von Armut auf die Entwicklung von Kindern (geschlechtsspezifische Unterschiede)
- Handlungsansätze zur Resilienzförderung
- Die Rolle der Schule und des Religionsunterrichts in der Resilienzförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit beginnt mit persönlichen Erfahrungen der Autorin im pädagogischen Bereich, die die Unterschiede zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen aufzeigen. Die Beobachtung von Ungleichheiten in der Schulausstattung und dem Zugang zu Grundbedürfnissen führt zur zentralen Forschungsfrage: Wie können sich Kinder mit ähnlichen Voraussetzungen so unterschiedlich entwickeln? Die Autorin stellt die Resilienz als zentralen Aspekt heraus und kündigt die Auseinandersetzung mit Definitionsansätzen von Resilienz und sozialer Benachteiligung an.
2 Das Resilienzkonzept: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Resilienz und die Entstehung der Resilienzforschung. Es werden verschiedene Resilienzmodelle (Kompensations-, Herausforderungs-, Interaktions- und Kumulationsmodell) vorgestellt und deren Zusammenhänge und Unterschiede diskutiert. Das Rahmenmodell von Kumpfer wird detailliert beschrieben, welches die Komplexität des Phänomens Resilienz durch die Betrachtung von Einflussbereichen (akuter Stressor, Umweltbedingungen, personale Merkmale, Entwicklungsergebnis) und Transaktionsprozessen (Zusammenspiel von Person und Umwelt, Person und Entwicklungsergebnis) verdeutlicht. Schließlich werden die Kauai-Studie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie als wegweisende Forschungsarbeiten präsentiert.
3 Die soziale Benachteiligung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der sozialen Benachteiligung, wobei der Fokus auf Kinder in prekären ökonomischen Situationen liegt. Es werden zwei gängige Definitionsansätze von Armut vorgestellt: das Ressourcenkonzept (Einkommensarmut) und das Lebenslagekonzept. Letzteres berücksichtigt neben dem Einkommen weitere Dimensionen wie Ernährung, Wohnverhältnisse, Bildung und soziale Teilhabe. Die unterschiedlichen Auswirkungen der Armutslage auf Jungen und Mädchen werden analysiert, wobei geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse eine wichtige Rolle spielen. Der Zusammenhang zwischen materieller Notlage, Fehlernährung und den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen wird ebenfalls thematisiert.
4 Bedeutung von Kinderarmut für die Bildungszukunft: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Kinderarmut auf die Bildungskarriere. Es wird gezeigt, dass Kinder aus armen Familien oft einen verspäteten und verlangsamten Bildungsweg durchlaufen, der bereits im Kindergarten beginnt und sich in der Grundschule verfestigt. Die Bedeutung der Grundschule als soziale Ressource und die Herausforderungen für Schulen im Umgang mit benachteiligten Kindern werden hervorgehoben.
5 Resilienzförderung: Dieses Kapitel widmet sich der Resilienzförderung bei sozial benachteiligten Kindern. Es werden die Kompetenzen und Eigenschaften resilienter Kinder beschrieben und Handlungskonzepte zur Resilienzförderung vorgestellt, insbesondere das kindzentrierte Konzept nach Edith Grotberg mit seinen drei Kategorien von Ressourcen ("Ich habe", "Ich bin", "Ich kann"). Die Bedeutung von protektiven Faktoren und die Rolle der Schule, sowie die Herausforderungen der Ganztagsschule werden diskutiert. Der Unterschied zwischen offener und gebundener Ganztagsschule und das Problem der Stigmatisierung werden beleuchtet. Ein Exkurs in die Neurobiologie unterstreicht die Bedeutung von Freude und Begeisterung beim Lernen.
Schlüsselwörter
Resilienz, soziale Benachteiligung, Kinderarmut, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Resilienzmodelle, Salutogenese, Kohärenzgefühl, Kompetenzentwicklung, Ganztagsschule, reformpädagogische Maßnahmen, offener Unterricht, Stigmatisierung, Neurobiologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Resilienzförderung bei sozial benachteiligten Kindern
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Förderung von Resilienz bei sozial benachteiligten Kindern, insbesondere im Kontext von Armut. Ein Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Resilienzförderung in pädagogischen Einrichtungen, vor allem in der Schule.
Welche Konzepte werden im Detail erläutert?
Die Arbeit behandelt das Resilienzkonzept mit verschiedenen Modellen (Kompensations-, Herausforderungs-, Interaktions- und Kumulationsmodell), das Konzept der Salutogenese, die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren, sowie verschiedene Definitionen und Auswirkungen sozialer Benachteiligung und Armut (Ressourcen- und Lebenslagekonzept). Weiterhin werden Handlungsansätze zur Resilienzförderung, die Rolle der Schule und konkrete Beispiele für den Unterricht zur Resilienzförderung diskutiert. Die Kauai-Studie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie werden als wichtige Forschungsarbeiten vorgestellt.
Welche Rolle spielt Armut in dieser Arbeit?
Armut wird als zentraler Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern betrachtet. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Auswirkungen von Armut auf Jungen und Mädchen und beleuchtet den Zusammenhang zwischen materieller Notlage, Fehlernährung und den daraus resultierenden gesundheitlichen und bildungsbezogenen Folgen. Der Einfluss von Kinderarmut auf die Bildungskarriere und die Herausforderungen für Schulen im Umgang mit benachteiligten Kindern werden ausführlich untersucht.
Welche Strategien zur Resilienzförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Handlungskonzepte zur Resilienzförderung, einschließlich des kindzentrierten Konzepts nach Edith Grotberg. Die Bedeutung von protektiven Faktoren und die Rolle der Schule (insbesondere Ganztagsschule) werden diskutiert. Es werden Methoden zur Stärkung der Ich- und Sozialkompetenzen durch reformpädagogische Maßnahmen und offener Unterricht vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen der Stigmatisierung und beinhaltet einen Exkurs in die Neurobiologie, der die Bedeutung von Freude und Begeisterung beim Lernen unterstreicht.
Welche Modelle der Resilienz werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Resilienzmodelle: das Kompensationsmodell, das Herausforderungsmodell, das Interaktionsmodell und das Kumulationsmodell. Die Unterschiede und Zusammenhänge dieser Modelle werden diskutiert, und das Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer wird detailliert beschrieben.
Welche Studien werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Kauai-Studie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie als wegweisende Forschungsarbeiten zur Resilienz.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Resilienz, soziale Benachteiligung, Kinderarmut, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Resilienzmodelle, Salutogenese, Kohärenzgefühl, Kompetenzentwicklung, Ganztagsschule, reformpädagogische Maßnahmen, offener Unterricht, Stigmatisierung und Neurobiologie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Das Resilienzkonzept, Die soziale Benachteiligung, Bedeutung von Kinderarmut für die Bildungszukunft, Resilienzförderung und Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung im Text.
Details
- Titel
- Resilienzförderung bei sozial benachteiligten Kindern
- Hochschule
- Evangelische Hochschule Berlin
- Note
- 1,3
- Autor
- Katharina Garbrecht (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 73
- Katalognummer
- V230137
- ISBN (eBook)
- 9783656464822
- Dateigröße
- 7557 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- resilienzförderung kindern
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Garbrecht (Autor:in), 2013, Resilienzförderung bei sozial benachteiligten Kindern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/230137
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-