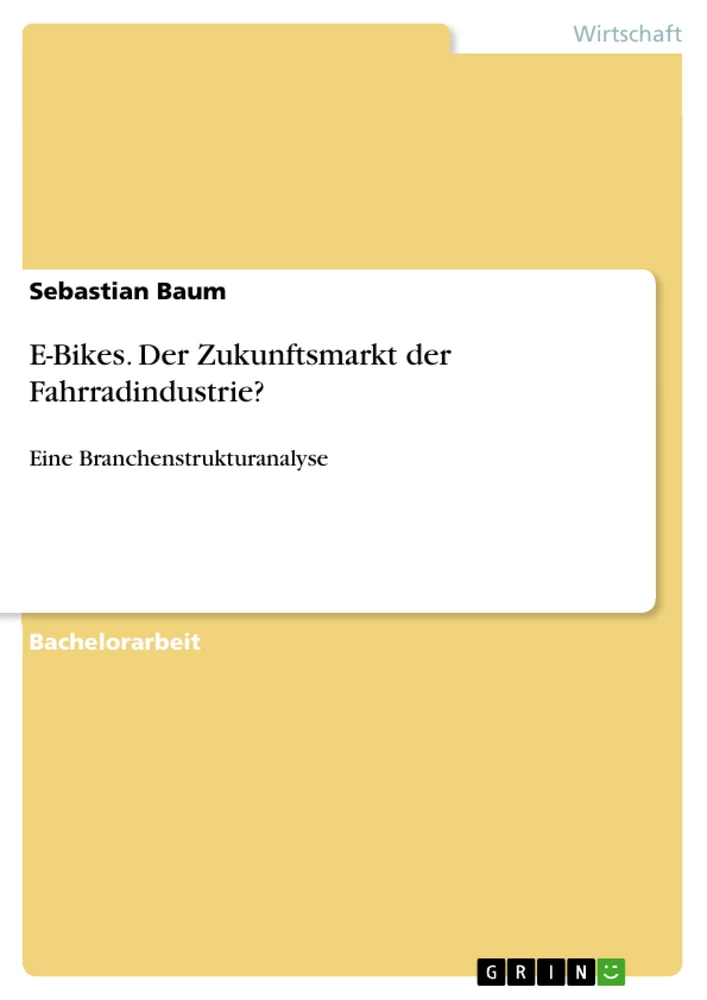
E-Bikes. Der Zukunftsmarkt der Fahrradindustrie?
Bachelorarbeit, 2013
40 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Five Forces Modell von Porter
2.1 Die Fahrradindustrie - globaler Wettbewerb in regionalen Märkten
2.1.1 Die Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern
2.1.2 Die Verhandlungsstärke der Lieferanten
2.1.3 Markteintrittsbarrieren
2.1.4 Die Verhandlungsstärke der Abnehmer
2.1.5 Die Gefahr durch Substitutionsprodukte
2.2 Das Ergebnis der Branchenstrukturanalyse
3 Eine mögliche Branchenentwicklung des E-Bike Segments
3.1 Der Produktlebenszyklus des E-Bikes
3.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und weitere Faktoren, die die Attraktivität des E-Bikes beeinflussen
4 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturrecherche und Datenzugang
Appendix A: Methodik
Appendix B: Literaturverzeichnis
Details
- Titel
- E-Bikes. Der Zukunftsmarkt der Fahrradindustrie?
- Untertitel
- Eine Branchenstrukturanalyse
- Hochschule
- Freie Universität Berlin (Management-Department)
- Veranstaltung
- Strategisches Management
- Note
- 2,3
- Autor
- Sebastian Baum (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V230572
- ISBN (eBook)
- 9783656463719
- ISBN (Buch)
- 9783656463764
- Dateigröße
- 748 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Branchenstrukturanalyse Michael Porter Five Forces Branchenanalyse Strategisches Management Wettbewerbsumwelt Aufgabenumwelt Management BWL Konkurrentenanalyse Fahrradindustrie E-Bike E-Bikes Fahrradbranche Fahrradhersteller- und zuliefer
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Baum (Autor:in), 2013, E-Bikes. Der Zukunftsmarkt der Fahrradindustrie?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/230572
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









