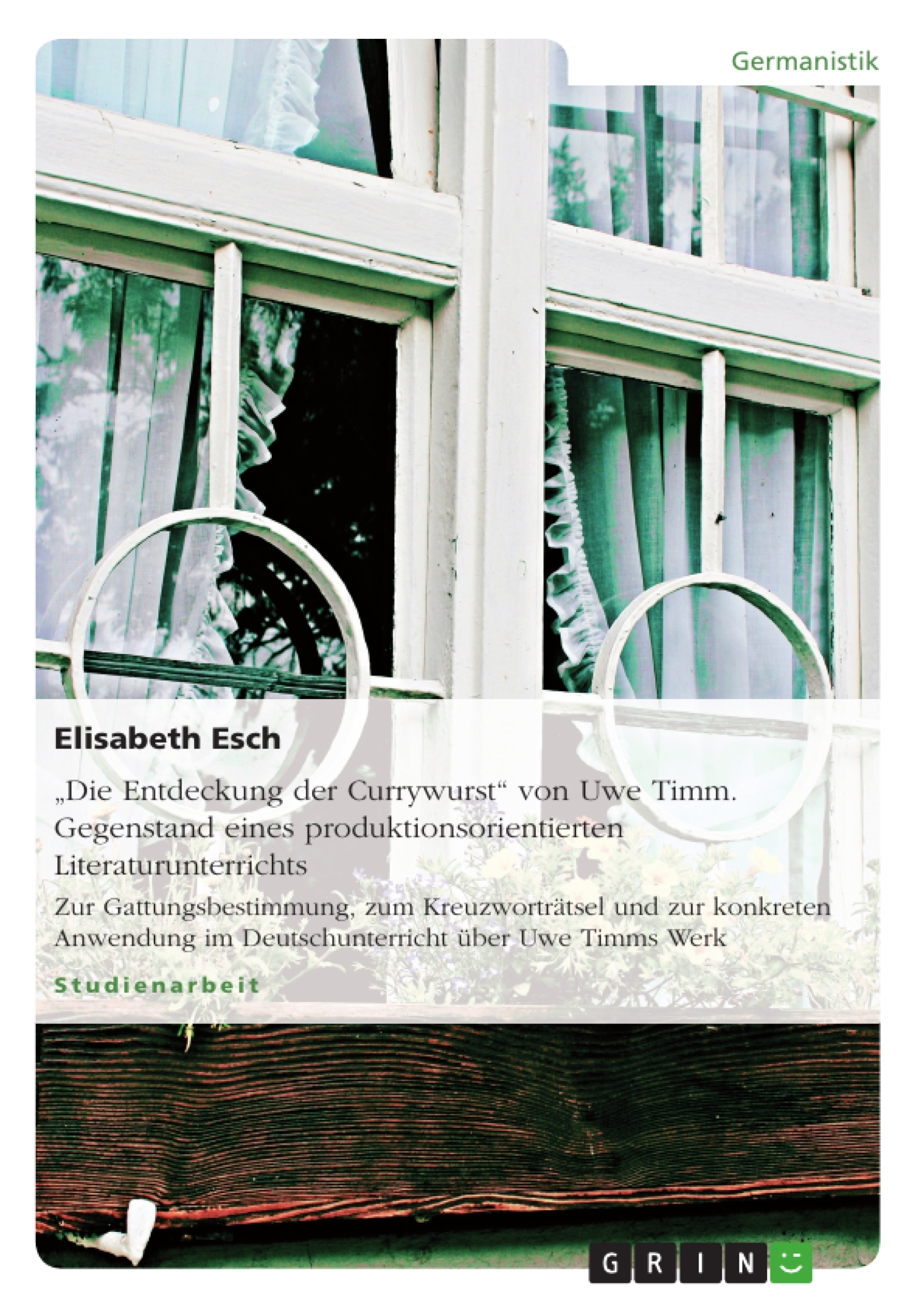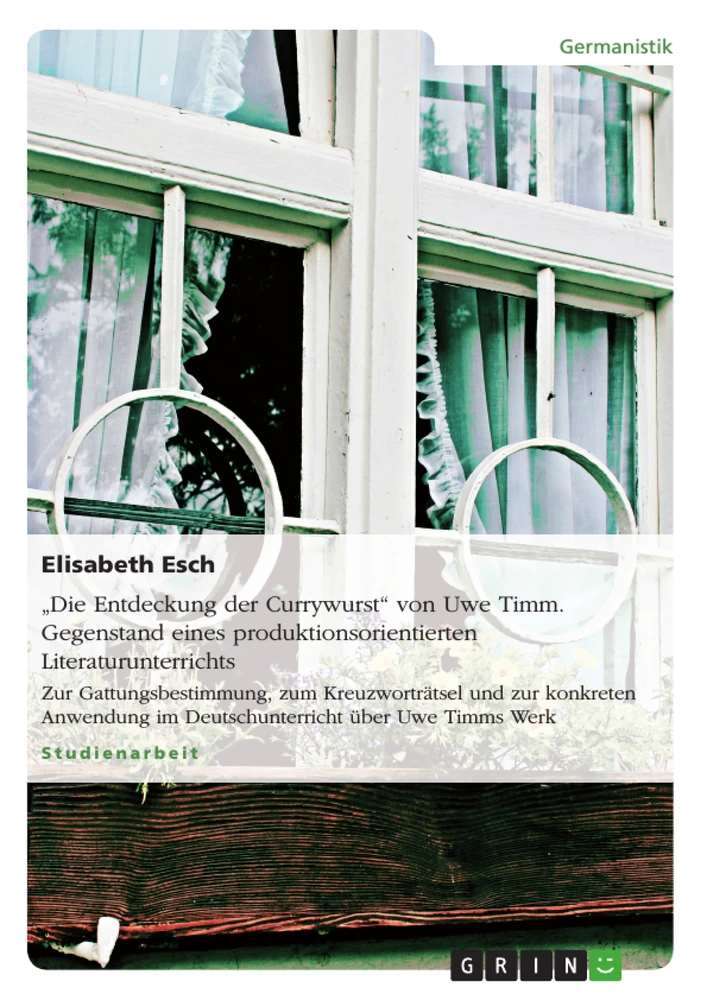
"Die Entdeckung der Currywurst" von Uwe Timm. Gegenstand eines produktionsorientierten Literaturunterrichts
Studienarbeit, 2013
47 Seiten
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Novelle?
- Charakteristika einer Novelle
- Handelt es sich bei Timms Die Entdeckung der Currywurst um eine Novelle?
- Das Kreuzworträtsel
- Homers Odyssee
- Kriegerisch-politische Wörter
- Lösungswörter, die die Machart der Novelle aufgreifen
- Weitere Lösungswörter des Kreuzworträtsels
- Bedeutung von Die Entdeckung der Currywurst für den Deutschunterricht
- Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht
- Was zeichnet einen handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht aus?
- Was sind Möglichkeiten und Grenzen eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts in Abgrenzung zu anderen Methoden?
- Ein Vorschlag zur Vermittlung: Handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtssequenz anhand von Timms Die Entdeckung der Currywurst
- Didaktische Impulse
- Methodische Impulse
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Uwe Timms Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“ im Kontext eines produktionsorientierten Literaturunterrichts. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die Arbeit als eine Novelle im Sinne der klassischen Gattungsmerkmale einordnen lässt und welche Bedeutung sie für den Deutschunterricht hat. Besonderes Augenmerk wird auf das in der Novelle enthaltene Kreuzworträtsel gelegt, dessen Lösungswörter und ihre Verbindung zu der Handlung analysiert werden.
- Gattungsmerkmale der Novelle
- Analyse des Kreuzworträtsels und seiner Bedeutung für die Handlung
- Einsatzmöglichkeiten im produktionsorientierten Deutschunterricht
- Didaktische und methodische Implikationen für die Unterrichtsgestaltung
- Potenzial für einen handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“ als Ausgangspunkt und erläutert den Rahmen der Arbeit. Es wird der Frage nach der Entstehung der Currywurst nachgegangen und die Verbindung zur Handlung der Novelle hergestellt.
Das Kapitel „Was ist eine Novelle?“ beschäftigt sich mit den charakteristischen Merkmalen der Gattung und untersucht, ob Timms Werk diesen Kriterien entspricht. Die Analyse befasst sich mit der Handlungsstruktur, der narrativen Gestaltung, dem Symbolgehalt und der Funktion von Leitmotiven.
Das Kapitel „Das Kreuzworträtsel“ analysiert die Bedeutung des Kreuzworträtsels in der Novelle. Es werden die verschiedenen Lösungswörter und ihre Beziehung zur Handlung sowie zum Mythos von Kalypso und Kirke aus Homers Odyssee untersucht.
Die Kapitel „Bedeutung von Die Entdeckung der Currywurst für den Deutschunterricht“ und „Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht“ beleuchten das Potenzial der Novelle für den Deutschunterricht und präsentieren die Vor- und Nachteile eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Gattungsmerkmalen der Novelle, der Bedeutung des Kreuzworträtsels in der Novelle, der Anwendung von Produktionsorientierung im Deutschunterricht, sowie den didaktischen und methodischen Implikationen der Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“ für die Unterrichtsgestaltung.
Details
- Titel
- "Die Entdeckung der Currywurst" von Uwe Timm. Gegenstand eines produktionsorientierten Literaturunterrichts
- Untertitel
- Zur Gattungsbestimmung, zum Kreuzworträtsel und zur konkreten Anwendung im Deutschunterricht über Uwe Timms Werk
- Hochschule
- Universität zu Köln (Institut für deutsche Sprache und Literatur)
- Autor
- Elisabeth Esch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V231421
- ISBN (eBook)
- 9783656475279
- ISBN (Buch)
- 9783656476504
- Dateigröße
- 3489 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diese Ausarbeitung habe ich angefertigt für die Vorbereitung meiner Examensprüfung.
- Schlagworte
- Entdeckung der Currywurst Uwe Timm Timm Hermann Lena Brücker Bremer Novelle Novellenmerkmale Gattung Kreuzworträtsel Homer Odyssee Odyseus Kalypso Kirke Ingwer Curry Matrazteninsel Floß Kapriole Pegasus Rose Deutschunterricht handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Handlungsorientierung Produktionsorientierung Unterrichtssequenz Unterrichsstunde Dingsymbol unerhörte Begebenheit Diaktik Lehrplan
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Esch (Autor:in), 2013, "Die Entdeckung der Currywurst" von Uwe Timm. Gegenstand eines produktionsorientierten Literaturunterrichts, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/231421
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-