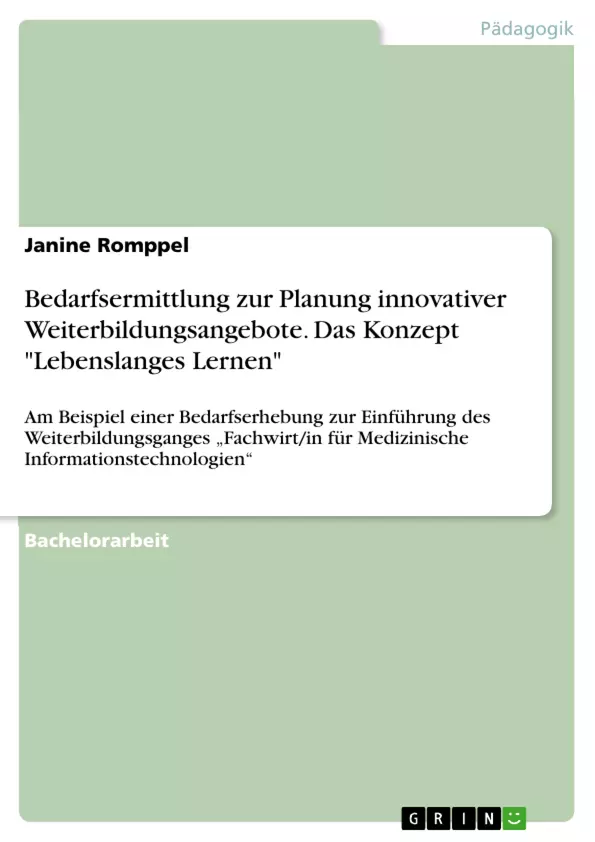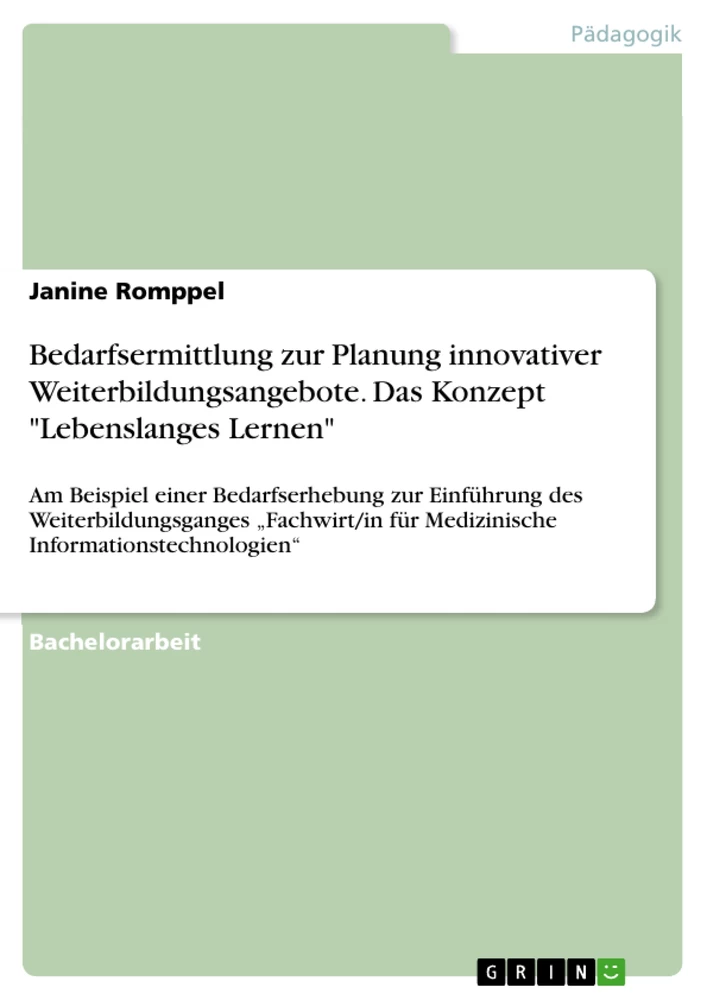
Bedarfsermittlung zur Planung innovativer Weiterbildungsangebote. Das Konzept "Lebenslanges Lernen"
Bachelorarbeit, 2009
50 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 2. Weiterbildung als Baustein Lebenslangen Lernens
- 2.1 Der Begriff der Weiterbildung
- 2.3 Die Beteiligung an Weiterbildung
- 2.3 Der Begriff des Lebenslangen Lernens
- 2.4 Weiterbildung und Lebenslanges Lernen im Zusammenhang
- 3. Zwischenfazit
- 4. Programmplanungshandeln in der Weiterbildung
- 4.1 Der Begriff Programm in der Weiterbildung
- 4.2 Der Begriff Programmplanung
- 4.3 Programmplanung als Kopplung von Wissensinseln
- 5. Bedarfsermittlung als Planungsinstrument
- 5.1 Der Begriff des Bedarfs
- 5.2 Methoden der Bedarfsermittlung
- 6. Empirische Studie zur Bedarfserhebung des Deutschen Institutes zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V. (DIW-MTA)
- 6.1 Vorstellung des DIW-MTA
- 6.2 Die Idee und Vorüberlegungen zur Studie
- 6.3 Leitfadenentwicklung und Vorüberlegungen zur Vorgehensweise der Bedarfserkundung
- 6.4 Durchführung der Bedarfserhebung
- 6.4.1 Teilnehmerbefragung als Instrument der Bedarfsermittlung
- 6.5 Präsentation und Auswertung der Ergebnisse
- 6.6 Kritische Anmerkungen zur Studie und Beurteilung der gewählten Methode
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Bedarfsermittlung für die Gestaltung innovativer Weiterbildungsangebote. Sie analysiert eine empirische Studie zur Einführung eines neuen Weiterbildungsgangs und setzt diese im Kontext des lebenslangen Lernens. Die Arbeit bewertet die gewählte Methode der Bedarfserhebung und interpretiert die Ergebnisse kritisch.
- Bedeutung der Bedarfsermittlung für die Weiterbildungsplanung
- Bewertung von Methoden der Bedarfserhebung
- Lebenslanges Lernen und Weiterbildung
- Analyse einer konkreten Bedarfserhebung im medizinischen Bereich
- Konzeption und Planung von Weiterbildungsangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel und die zunehmende Bedeutung von Weiterbildung und lebenslangem Lernen im Kontext einer wissensbasierten Gesellschaft. Sie hebt die Notwendigkeit einer fundierten Bedarfsermittlung für die Planung von Weiterbildungsangeboten hervor und führt in die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit ein. Die Arbeit fokussiert sich auf eine Bedarfsanalyse am DIW-MTA zur Einführung des Weiterbildungsgangs „Fachwirt/in für Medizinische Informationstechnologien“ als Beispiel für Programmplanungshandeln.
2. Weiterbildung als Baustein Lebenslangen Lernens: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Weiterbildung und seine Vielschichtigkeit, differenziert zwischen verschiedenen Weiterbildungsformen und typologisiert diese nach Inhaltsbereichen, Trägerschaften und Formalisierungsgrad. Es betont den lebensbegleitenden Charakter von Weiterbildung und setzt sie in Beziehung zum Konzept des lebenslangen Lernens, indem es deren Notwendigkeit und Ziele erörtert. Es analysiert die verschiedenen Perspektiven auf Weiterbildung und die Herausforderungen, die mit ihrer Umsetzung verbunden sind.
4. Programmplanungshandeln in der Weiterbildung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Programmplanung in der Weiterbildung und beschreibt sie als Prozess der Kopplung von Wissensinseln. Es legt den Fokus auf die Bedeutung einer systematischen Planung und analysiert, wie gesellschaftliche, bildungspolitische und adressatenbezogene Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen, um erfolgreiche Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es betont, dass Weiterbildung nicht nur ein reaktiver, sondern ein aktiver und proaktiver Prozess sein sollte.
5. Bedarfsermittlung als Planungsinstrument: Das Kapitel erläutert den Begriff des Bedarfs im Kontext der Weiterbildung und stellt verschiedene Methoden der Bedarfsermittlung vor. Es beleuchtet die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung von Bedarfsermittlungen und begründet deren Notwendigkeit für eine erfolgreiche Weiterbildungsplanung. Es unterstreicht den methodischen Anspruch einer systematischen Bedarfsermittlung, im Gegensatz zu beiläufigen, ungezielten Ansätzen.
6. Empirische Studie zur Bedarfserhebung des Deutschen Institutes zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V. (DIW-MTA): Dieses Kapitel präsentiert die durchgeführte Bedarfsanalyse am DIW-MTA, die als Teilprozess eines Programmplanungshandelns dient. Es beschreibt das DIW-MTA, die Idee und die Vorüberlegungen zur Studie, den Entwicklungsprozess des Leitfadens und die Vorgehensweise der Bedarfsanalyse. Es detailliert die Durchführung der Bedarfserhebung, insbesondere die Teilnehmerbefragung als Instrument und die anschließende Präsentation und Auswertung der Ergebnisse. Schließlich werden kritische Anmerkungen zur Studie und zur Beurteilung der gewählten Methode formuliert.
Schlüsselwörter
Bedarfsermittlung, Weiterbildung, Lebenslanges Lernen, Programmplanung, Medizinische Informationstechnologien, Empirische Studie, Bedarfserhebung, Weiterbildungsplanung, Qualifikation, Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bedarfsermittlung in der Weiterbildung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Bedarfsermittlung für die Gestaltung innovativer Weiterbildungsangebote. Sie analysiert eine empirische Studie zur Einführung eines neuen Weiterbildungsgangs und setzt diese im Kontext des lebenslangen Lernens. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung der gewählten Methode der Bedarfserhebung und der kritischen Interpretation der Ergebnisse.
Welche Aspekte der Weiterbildung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Weiterbildung, darunter der Begriff der Weiterbildung selbst, die verschiedenen Weiterbildungsformen, der Zusammenhang zwischen Weiterbildung und lebenslangem Lernen, die Programmplanung in der Weiterbildung und insbesondere die Bedarfsermittlung als zentrales Planungsinstrument.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Bedarfsermittlung für die Planung erfolgreicher Weiterbildungsangebote aufzuzeigen. Sie analysiert eine konkrete empirische Studie, um die praktische Anwendung von Bedarfsermittlungsmethoden zu beleuchten und deren Stärken und Schwächen zu diskutieren.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Forschungsmethode. Der qualitative Ansatz liegt in der Analyse bestehender Literatur und Konzepte zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen. Der quantitative Ansatz liegt in der Auswertung der Ergebnisse einer empirischen Studie, die eine Teilnehmerbefragung umfasst.
Welche Studie wird analysiert?
Die Arbeit analysiert eine empirische Studie des Deutschen Institutes zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V. (DIW-MTA) zur Bedarfserhebung für einen neuen Weiterbildungsgang „Fachwirt/in für Medizinische Informationstechnologien“.
Welche Ergebnisse liefert die Studie?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Studie des DIW-MTA, einschließlich der Auswertung der Teilnehmerbefragung. Sie bewertet die Ergebnisse kritisch und diskutiert die Stärken und Schwächen der gewählten Methode.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Bedeutung systematischer Bedarfsermittlungen für die erfolgreiche Planung und Gestaltung von Weiterbildungsangeboten. Sie gibt Empfehlungen für die Auswahl und Anwendung geeigneter Methoden der Bedarfsermittlung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bedarfsermittlung, Weiterbildung, Lebenslanges Lernen, Programmplanung, Medizinische Informationstechnologien, Empirische Studie, Bedarfserhebung, Weiterbildungsplanung, Qualifikation, Kompetenzentwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen, Programmplanung, Bedarfsermittlung und der Präsentation und Auswertung der empirischen Studie. Sie schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Details
- Titel
- Bedarfsermittlung zur Planung innovativer Weiterbildungsangebote. Das Konzept "Lebenslanges Lernen"
- Untertitel
- Am Beispiel einer Bedarfserhebung zur Einführung des Weiterbildungsganges „Fachwirt/in für Medizinische Informationstechnologien“
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Note
- 1,3
- Autor
- M.A. Janine Romppel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V231680
- ISBN (Buch)
- 9783656728139
- ISBN (eBook)
- 9783656728160
- Dateigröße
- 921 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bedarfsermittlung planungsinstrument gewinnung weiterbildungsangebote beispiel bedarfserhebung einführung weiterbildungsganges fachwirt/in medizinische informationstechnologien deutschen institut weiterbildung technischer assistentinnen assistenten medizin betrachtung konzeptes lebenslanges lernen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- M.A. Janine Romppel (Autor:in), 2009, Bedarfsermittlung zur Planung innovativer Weiterbildungsangebote. Das Konzept "Lebenslanges Lernen", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/231680
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-