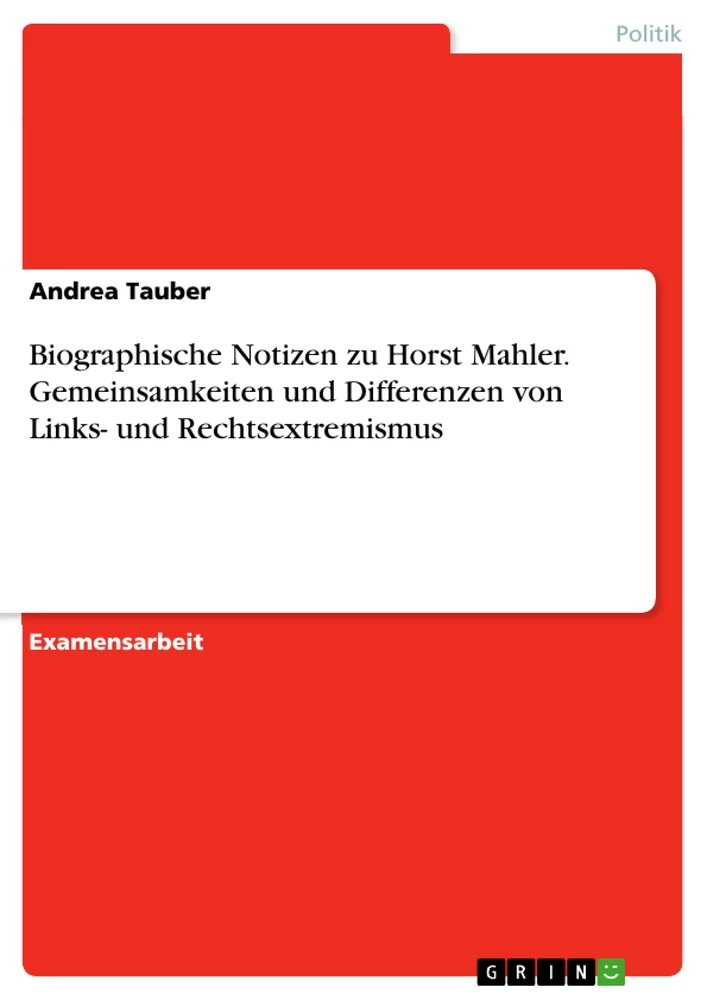
Biographische Notizen zu Horst Mahler. Gemeinsamkeiten und Differenzen von Links- und Rechtsextremismus
Examensarbeit, 2013
70 Seiten, Note: 1,66
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen zentraler Begriffe
- Politischer Extremismus
- Ideologische Merkmale des Linksextremismus' (Ziele)
- Ideologische Merkmale des Rechtsextremismus' (Ziele)
- Die Protestbewegung
- Biographische Darstellung
- Mahlers Elternhaus und Kindheit
- Jugend, Studium und erste politische Aktivitäten
- Der Rechtsanwalt
- Mahlers Beteiligungen in der geheimen Novembergesellschaft und dem Republikanischen Club (RC)
- Der Tod Benno Ohnesorgs
- Das Attentat auf Rudi Dutschke
- Die Schlacht am Tegeler Weg
- Kaufhausbrandstiftungen in Brüssel und Frankfurt
- Mahler als Initiator der RAF
- Militärische Ausbildung in Jordanien
- Banküberfall
- Mahlers Rede vor Gericht
- Der Bruch mit der RAF
- Mahlers neue Ideologien?
- Auf freiem Fuß
- Der Rechtsextremist
- Die NPD und das Verbotsverfahren
- Holocaust-Leugner
- Horst Mahlers ideologische Merkmale
- Horst Mahlers politische Sozialisation
- Antiimperialismus im Vergleich der 60er/70er Jahre und heute
- Antisemitismus im Linksextremismus
- Antisemitismus im Vergleich der 60er/70er Jahre und heute
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den politischen Werdegang von Horst Mahler, um Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen Links- und Rechtsextremismus zu beleuchten. Sie analysiert Mahlers Biographie im Hinblick auf seine scheinbar radikale politische Wandlung und hinterfragt die gängige Vorstellung einer strikten Trennung zwischen „links“ und „rechts“. Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenzierteres Verständnis der politischen Entwicklung Mahlers und der komplexen Zusammenhänge zwischen extremistischen Ideologien zu ermöglichen.
- Die Entwicklung des politischen Extremismus in Deutschland
- Die Biographie Horst Mahlers als Fallbeispiel für politische Wandlungen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Links- und Rechtsextremismus
- Die Rolle von Antisemitismus in extremistischen Ideologien
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Links-Rechts-Dichotomie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und problematisiert die vereinfachende Links-Rechts-Dichotomie in der politischen Analyse. Sie stellt die Forschungsfrage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Links- und Rechtsextremismus und wählt Horst Mahler als Fallbeispiel, dessen Biographie als „politisches absurdum“ beschrieben wird, da er scheinbar von links nach rechts gewechselt ist. Die Einleitung hebt die Komplexität des Themas und die Schwierigkeit hervor, Mahlers politische Entwicklung linear zu erklären.
Definitionen zentraler Begriffe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „politischer Extremismus“, und unterscheidet die ideologischen Merkmale von Linksextremismus und Rechtsextremismus, in Bezug auf ihre Ziele und den politischen Standpunkt. Es legt das Fundament für die spätere Analyse von Mahlers politischer Entwicklung, indem es ein Rahmenwerk für die Klassifizierung extremistischer Ideologien bietet.
Biographische Darstellung: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte chronologische Darstellung von Mahlers Leben, von seiner Kindheit in einer nationalsozialistischen Familie bis hin zu seiner rechtsextremen Phase. Es skizziert seine Beteiligung an verschiedenen politischen Gruppen und Organisationen, seine juristische Karriere, seinen Terrorismus in der RAF und sein späteres Engagement in der NPD. Es beleuchtet Schlüsselereignisse, die seinen politischen Werdegang prägten und versucht, seine Entwicklung nachzuvollziehen.
Horst Mahlers ideologische Merkmale: Dieses Kapitel analysiert die ideologischen Grundlagen von Mahlers politischen Entwicklung. Es untersucht seine politische Sozialisation, vergleicht seinen Antiimperialismus der 60er/70er Jahre mit dem heutigen, und analysiert die Rolle des Antisemitismus sowohl im Linksextremismus als auch in seinem späteren Rechtsextremismus, sowie im Kontext der jeweiligen Zeitperioden. Es untersucht die Kontinuitäten und Brüche in seinen Ideologien.
Schlüsselwörter
Horst Mahler, Linksextremismus, Rechtsextremismus, RAF, NPD, Antisemitismus, politische Radikalisierung, Ideologie, Biographie, politische Wandlung, Extremismusforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Horst Mahler
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den politischen Werdegang von Horst Mahler, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Links- und Rechtsextremismus aufzuzeigen. Sie analysiert seine Biographie im Hinblick auf seine scheinbar radikale politische Wandlung und hinterfragt die gängige Vorstellung einer strikten Trennung zwischen „links“ und „rechts“. Der Fokus liegt auf einem differenzierteren Verständnis von Mahlers Entwicklung und den komplexen Zusammenhängen extremistischer Ideologien.
Welche Aspekte von Horst Mahlers Leben werden behandelt?
Die Arbeit bietet eine detaillierte biographische Darstellung von Mahlers Leben, beginnend mit seiner Kindheit und Jugend, über seine frühen politischen Aktivitäten, seine Beteiligung an der RAF, seinen späteren Rechtsextremismus und seine Aktivitäten innerhalb der NPD bis hin zu seinen antisemitischen Äußerungen. Schlüsselereignisse, die seinen politischen Werdegang prägten, werden beleuchtet und analysiert.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie „politischer Extremismus“, „Linksextremismus“ und „Rechtsextremismus“, wobei jeweils die ideologischen Merkmale und Ziele unterschieden werden. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die Analyse von Mahlers politischer Entwicklung.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen dem Linksextremismus Mahlers und seinem späteren Rechtsextremismus? Die Arbeit sucht nach Kontinuitäten und Brüchen in seinen Ideologien.
Wie wird die Links-Rechts-Dichotomie in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit problematisiert die vereinfachende Links-Rechts-Dichotomie in der politischen Analyse und hinterfragt die Möglichkeit, Mahlers Entwicklung linear von „links“ nach „rechts“ zu erklären. Sie argumentiert für ein differenzierteres Verständnis der komplexen Zusammenhänge extremistischer Ideologien.
Welche ideologischen Merkmale Horst Mahlers werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Mahlers politische Sozialisation, seinen Antiimperialismus (im Vergleich der 60er/70er Jahre und heute) und die Rolle des Antisemitismus in seinem Denken, sowohl im Kontext des Linksextremismus als auch des Rechtsextremismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Definition zentraler Begriffe, eine detaillierte biographische Darstellung Horst Mahlers, eine Analyse seiner ideologischen Merkmale und ein Resümee, welches die Forschungsfrage beantwortet. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Horst Mahler, Linksextremismus, Rechtsextremismus, RAF, NPD, Antisemitismus, politische Radikalisierung, Ideologie, Biographie, politische Wandlung, Extremismusforschung.
Details
- Titel
- Biographische Notizen zu Horst Mahler. Gemeinsamkeiten und Differenzen von Links- und Rechtsextremismus
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1,66
- Autor
- Andrea Tauber (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V232344
- ISBN (eBook)
- 9783656483427
- ISBN (Buch)
- 9783656483472
- Dateigröße
- 667 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- biographische notizen horst mahler gemeinsamkeiten differenzen links- rechtsextremismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Tauber (Autor:in), 2013, Biographische Notizen zu Horst Mahler. Gemeinsamkeiten und Differenzen von Links- und Rechtsextremismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/232344
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









