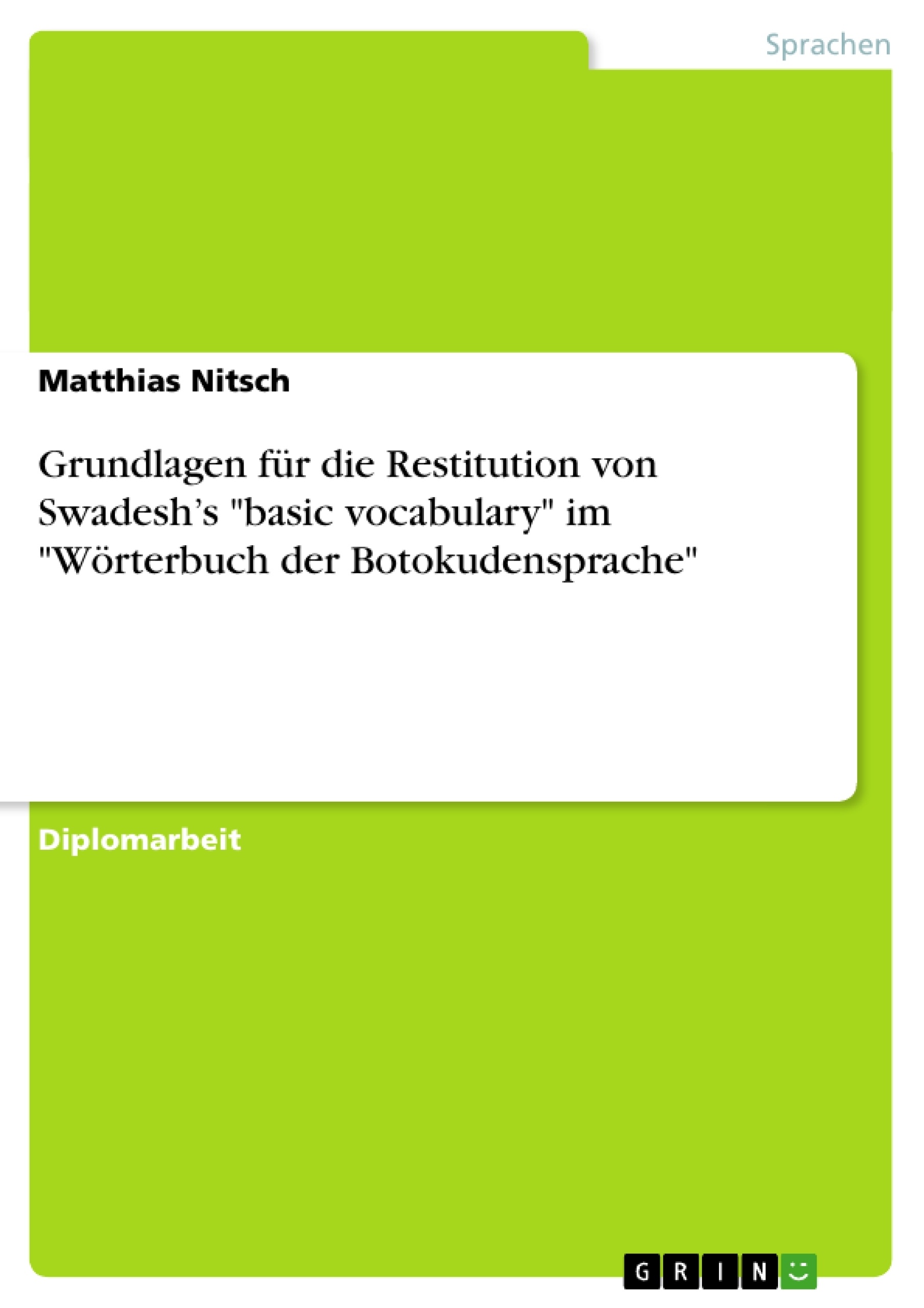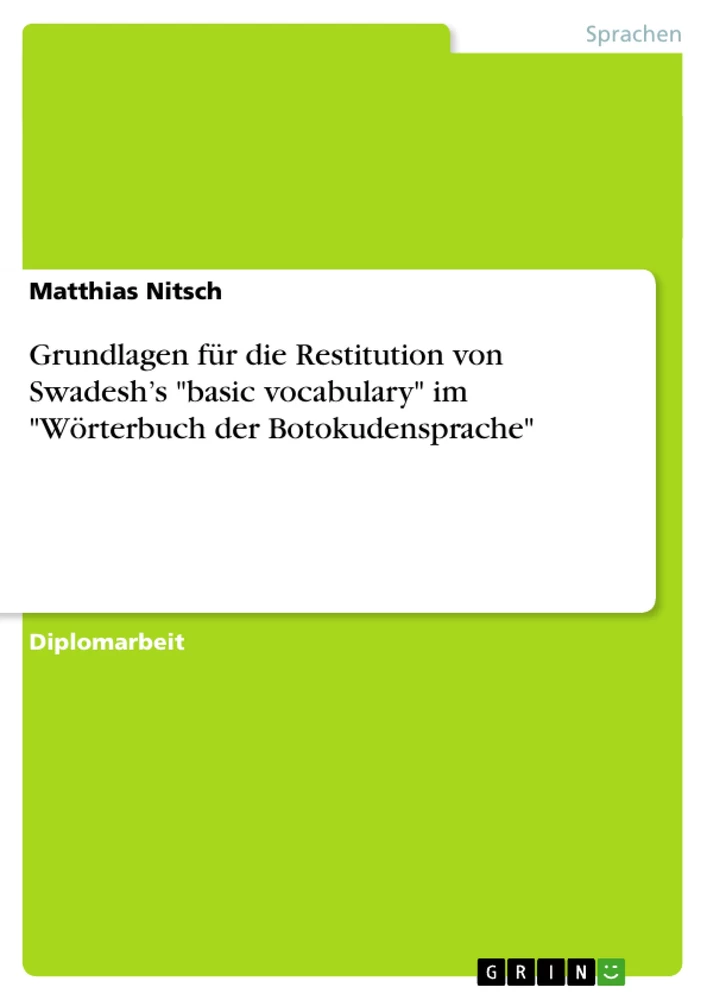
Grundlagen für die Restitution von Swadesh’s "basic vocabulary" im "Wörterbuch der Botokudensprache"
Diplomarbeit, 2013
261 Seiten, Note: 1,0 (sehr gut)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
2 Indigene Ethnien und Sprachen in Brasilien
2.1 Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung
2.2 Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen
2.3 Die Vernichtung und heutige Situation indigener brasilianischer Sprachen
3 Die indigene Ethnie der Botokuden
3.1 Namensgebung
3.2 Verbreitungsgebiet und Lebensweise
4 Die Sprache der Botokuden
4.1 Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache
4.2 Die genetische und typologische Klassifikation der Botokudensprache
4.2.1 Phonetische und phonologische Aspekte des Krenák
4.2.2 Morphosyntaktische Aspekte des Krenák
5 Das Wörterbuch der Botokudensprache
5.1 Neue Forschungsergebnisse zum Autor und Entstehungskontext
5.1.1 Der Autor Bruno Rudolph
5.1.2 Der Entstehungskontext
5.2 Die Rezeption des Wörterbuchs
5.3 Die metalexikographische Analyse des Wörterbuchs
5.4 Defizite des Wörterbuchs der Botokudensprache
5.4.1 Graphie und Transkription
5.4.2 Morphologie und Segmentierung
5.4.3 Semantik und Übersetzung
6 Swadesh’s basic vocabulary
6.1 Theoretische Grundlagen zur Entstehung und zu den Eigenschaften von Swadesh’s basic vocabulary
6.2 Gründe für die Verwendung von Swadesh’s basic vocabulary im Wörterbuch
6.3 Methoden zur Erstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs
6.4 Besonderheiten im Wortschatz der Botokudensprache und ihre Bedeutung für die Swadesh-Liste des Wörterbuchs
7 Die Restitution
7.1 Definition und theoretische Grundlagen der Restitution
7.2 Die Restitution der Entsprechung von Swadesh’s test item Nr. 95 full
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang 1 Karten
Anhang 1.1 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Nimuendajú)
Anhang 1.2 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Loukotka)
Anhang 1.3 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Mattos)
Anhang 1.4 Der Sprachstamm Macro-Jê
Anhang 1.5 Die Kolonien am Mucuri
Anhang 2 Fotografien der Botokuden
Anhang 3 Bildmaterial zum Wörterbuch der Botokudensprache
Anhang 3.1 Titelblatt des Wörterbuchs und Todesanzeige von Bruno Rudolph
Anhang 3.2 Signatur von Bruno Rudolph
Anhang 3.3 Ausschnitt aus dem Wörterbuch der Botokudensprache
Anhang 4 Listen zu Sachgebieten im Wörterbuch der Botokudensprache
Anhang 4.1 Einige Bezeichnungen der Botokuden im Wörterbuch
Anhang 4.2 Hydronyme im Wörterbuch der Botokudensprache A10
Anhang 4.3 Sprachvergleiche im Wörterbuch der Botokudensprache
Anhang 5 Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Verteilung der Artikel im Wörterverzeichnis
Abbildung 2: Die typische Mikrostruktur eines Wörterbuchartikels aus dem ersten Teil des Wörterbuchs der Botokudensprache
Tabelle 1: Die 22 konsonantischen Phoneme des Krenák
Tabelle 2: Die konsonantischen Phone des Krenák
Tabelle 3: Die 12 vokalischen Phoneme des Krenák
Tabelle 4: Die vokalischen Phone des Krenák
Tabelle 5: Die Silbentypen des Krenák
Tabelle 6: Das Pronominalsystem des Krenák (Entwurf)
Tabelle 7: Aufbau und Umfang des Wörterbuchs der Botokudensprache
Tabelle 8: Bruno Rudolphs Transkriptionssystem der Botokudensprache
Tabelle 9: Graphische Zeichen im Wörterbuch der Botokudensprache
Tabelle 10: Beispiel eines test items zur Erläuterung der Swadesh-Liste
Tabelle 11: Doppelte Entsprechungen von Swadesh’s test items im Wörterbuch
Tabelle 12: Beispiel eines test items zur Erläuterung der Restitution
Tabelle 13: Graphischer Vergleich der Entsprechungen des test items full
Tabelle 14: Lautlicher Vergleich der Entsprechungen des test items full
Tabelle 15: Gegenüberstellung von [mət] mit Kontrollvokabular des Krenák
Abkürzungsverzeichnis
Allgemeine Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Von der indigenen Ethnie der Botokuden hörte ich erstmals im August des Jahres 2006. Ich hatte gerade meine Diplomvorprüfung als Student der Regionalwissenschaften Lateinamerika an der Universität zu Köln erfolgreich abgelegt und suchte nach neuen Herausforderungen. An der Bundesuniversität von Minas Gerais (UFMG) in Belo Horizonte/Brasilien traf ich auf den Linguisten Prof. Dr. Rui Rothe-Neves, der mich in die faszinierende Geschichte der Botokuden einführte. Er machte mich darauf aufmerksam, dass ein Großteil der Forschungen zu dieser Ethnie nur im Original auf Deutsch vorliege und in Brasilien - sehr zum Leidwesen der noch jungen indigenen Sprachwissenschaft - teilweise noch unveröffentlicht sei. Dies traf hauptsächlich auf die Ethnographischen Beobachtungen Carl August Schmögers (Kästner 1990:23-35), zwei Veröffentlichungen Paul Ehrenreichs (1887; 1896) und auf das Wörterbuch der Botokudensprache von Bruno Rudolph (1909) zu. Eine Mitarbeit bei der Übersetzung und Publikation dieser Werke in Brasilien bot sich für mich an. Jedoch konnte damals noch niemand ahnen, dass es damit allein nicht getan sein würde. Es bedarf einer noch viel größeren Kraftanstrengung, das Wörterbuch sprachwissenschaftlich nutzbar zu machen.
Aufgrund meiner persönlichen Initiative wurde schließlich ein Partnerschaftsabkommen zwischen beiden Universitäten vereinbart und ich trat, gefördert durch den DAAD, im Februar 2008 mein einjähriges Auslandsstudium in Belo Horizonte an. Dort begann ich, noch als aluno especial, mit der Arbeit am Wörterbuch. Das Forschungsprojekt trägt den Titel: “A língua dos Botocudos na etnografia alemã: tradução e edição de documentação linguística em alemão relativa aos índios Botocudos do Mucuri e Rio Doce”. Inzwischen ist die Partnerschaft beider Universitäten vollständig institutionalisiert und blickt auf mehrere Semester des fruchtbaren Austauschs von deutschen und brasilianischen Studenten zurück.
Viele Erkenntnisse, die ich während des Studiums an beiden Universitäten gewonnen habe, sind in diese Arbeit eingeflossen. Darunter insbesondere die Überzeugung, dass für eine Übersetzung und Neuveröffentlichung des Wörterbuchs zuerst eine lexikologische und lexikographische Analyse erfolgen muss. Dann ist eine Vorgehensweise zu entwickeln, die zeigt, wie zumindest einem exemplarisch ausgewählten Teil des Wörterbuchgegenstandes aus dem Status des Rudolph’schen „Rohmaterials“ (Seler 1909:V) heraus geholfen werden kann, sodass es für die Sprachforschung besser nutzbar wird. Schließlich sollten auch das Leben und die Arbeitsweise des Autors sowie der Entstehungskontext des Wörterbuchs untersucht werden, da dies zu einem besseren Verständnis des Werkes und der Sprache beitragen kann. Die Umsetzung dieses Vorhabens wäre ohne die Hilfe vieler nicht möglich gewesen. Ihnen möchte ich danken/gostaria de agradecer:
Prof. Dr. Martin Becker für die wohlwollende Betreuung dieser regionalwissenschaftlichen Arbeit in meinem Wahlpflichtfach Iberoromanische Sprachwissenschaft,
Prof. Dr. Rui Rothe-Neves für die Idee und die Einladung zum Forschungsprojekt, die Betreuung während meines Auslandsstudiums und die daraus entstandene Freundschaft,
Prof. Dr. Claudius Armbruster und dem gesamten Portugiesisch-Brasilianischen Institut für die Unterstützung meines Auslandsstudiums und der Partnerschaft mit der UFMG,
Dr. Sebastião Iken für die Unterrichtung in deutsch-portugiesischer Lexikologie und die Möglichkeit, darüber im Portugiesisch Club International (PCI) zu referieren,
à Profa. Dra. Maria Cândida Trindade Costa de Seabra pelas aulas de lexicografia e lexicologia de línguas indígenas durante meu intercâmbio acadêmico na UFMG,
Dr. Sebastian Drude für die Einführung in die Arbeit mit bedrohten indigenen Sprachen im Museu Paraense Emílio Goeldi und in seinem Haus in Belém,
Dr. Georg Wink für die Einführung in die deutsch-brasilianische Kulturwissenschaft und die lehrreiche Zeit während seines Lektorats an der UFMG,
Dipl.-Reg.-Wiss. Brit Sperber vom Akademischen Auslandsamt der Universität zu Köln für die Unterstützung meines Auslandsstudiums an der UFMG,
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für mein Jahresstipendium zur wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung im Ausland,
Dr. Gregor Wolff und Gudrun Schumacher vom Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin für die Möglichkeit, in den Nachlässen von Eduard Seler und Paul Ehrenreich zu forschen,
ao Prof. Dr. Eduardo Rivail Ribeiro por administrar o site etnolinguistica.org e a Biblioteca Digital Curt Nimuendajú que facilitaram a minha pesquisa e enriqueceram este trabalho,
ao Dr. Toni Vidal Jochem e à Marilia Marx Jordan por administrarem e participarem do fórum imigração alemã e por me ajudarem com a pesquisa genealógica de Bruno Rudolph,
ao Eduardo Vieira Rudolph pelas informações sobre sua família, especialmente, sobre seu bisavô Bruno Rudolph, autor do “Dicionário da Língua dos Botocudos”,
à Laura Márcia Luiza Ferreira pela amizade e por ensinar-me o português do Brasil durante meu intercâmbio escolar de 2001 no Colégio Santo Agostinho em Belo Horizonte,
meinen Eltern Hans-Peter und Christel Nitsch sowie meinem Bruder Andreas für ihre Geduld, Verständnis und Unterstützung bei dieser Arbeit.
Matthias Nitsch, Köln im Juni 2013
1 Einleitung
Das Wörterbuch der Botokudensprache ist die umfassendste und in seiner Form außergewöhnlichste Quelle der Sprache einer indigenen Ethnie Südostbrasiliens. Es wurde von dem deutschen Apotheker und Brasilienauswanderer Bruno Rudolph an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verfasst, als die Botokuden bereits auszusterben drohten.[1] Die einzigen Indigenen dieser Ethnie, die die europäische Kolonisation überlebt haben, gehören zur Botokuden-Subgruppe der Krenák, die heute nur noch über wenige hundert Angehörige und nicht mehr als eine Handvoll Sprecher verfügt. Ihnen konnten in einer feierlichen Zeremonie im Mai 2011 auch die sterblichen Überreste des Botokuden Quäck übergeben werden, den Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied vor fast 200 Jahren von seiner Brasilienreise mit nach Deutschland gebracht hatte
(Melo/Pelli 2011; Pelli 2011).
Die Sprache der Botokuden wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts von einer Reihe von Forschern, meist europäischen Reisenden und Naturalisten, in Form von einfachen und knappen Wortlisten dokumentiert. Diese Wortlisten, von denen heute etwa 60 bekannt sind, teilen mit dem Wörterbuch das Schicksal, dass sie die Sprache der schriftlosen Kultur nur ungenau abbilden und deswegen nicht unmittelbar für weitere sprachwissenschaftliche Forschungen oder gar zur Revitalisierung der Botokudensprache eingesetzt werden können. Dies liegt daran, dass die ersten Erforscher der Botokudensprache weder ausgebildete Linguisten waren, noch auf eine hinreichend entwickelte Sprachwissenschaft zurückgreifen konnten. Erst die moderne Sprachwissenschaft stellt passende Instrumente und Methoden bereit, um etwa die Sprache exakt zu transkribieren und in ihrer Struktur adäquat zu analysieren.
Diese Arbeit versucht, die Grundlagen für ein Modell zu schaffen, nach dem die phonetische und schließlich auch die phonologische Struktur der Botokudensprache wiederhergestellt werden kann. Dazu wird neben dem Wörterbuch auch auf weitere historische Quellen der Botokudensprache und neuere Untersuchungen des Krenák zurückgegriffen. Dabei versteht sich dieser Beitrag bewusst als eine regionalwissenschaftliche Arbeit, die sowohl historische als auch ethnologische Aspekte berührt und zugleich einen linguistischen Schwerpunkt auf den Bereich der Lexikologie und Lexikographie sowie auf die Beschreibung einer bedrohten indigenen brasilianischen Sprache legt.
Die vollständige Restitution der Botokudensprache auf Grundlage dieser Arbeit sowie die Darstellung der Gesamtheit ihrer Merkmale muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben. Gleiches gilt für eine umfassende Darstellung der indigenen Ethnie der Botokuden, deren einzigartige Kultur und tragische Geschichte eine ausführlichere Beschreibung verdient hätten. In dieser Arbeit soll exemplarisch auf die wichtigsten Punkte eingegangen werden, die in Zusammenhang mit der Überarbeitung des Wörterbuchs mittels Swadesh’s basic vocabulary und der Methode der Restitution stehen. Als Ergebnis soll, beispielhaft für die gesamte Sprache, ein Lexem des Wörterbuchs bis hin zu seiner tatsächlichen phonetischen Form restituiert werden.
Zu Beginn dieser Arbeit wird ein allgemeiner Überblick zu indigenen Ethnien und Sprachen in Brasilien gegeben, die Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung auf dem südamerikanischen Kontinent sowie die Erforschung, Vernichtung und heutige Situation indigener brasilianischer Sprachen dargestellt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Botokuden, deren Lebensweise, Verbreitungsgebiet und Namensgebung dann eingehender behandelt wird. Überleitend zum Hauptuntersuchungsgegenstand dieser Arbeit, dem Wörterbuch, wird dann die Sprache der Botokuden hinsichtlich ihrer Erforschung und Dokumentation sowie genetischer und typologischer Klassifikation näher erläutert. Dabei werden einige phonetisch-phonologische und morphosyntaktische Aspekte des Krenák, der einzigen nach modernen linguistischen Methoden erforschten Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden, vorgestellt.
Die Untersuchung des Wörterbuchs der Botokudensprache bildet, zusammen mit der Erstellung einer Liste bestehend aus Swadesh’s basic vocabulary, den Hauptteil dieser Arbeit. Zunächst werden der Autor und der Entstehungskontext des Wörterbuchs beleuchtet und neue Forschungsergebnisse präsentiert, die einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der deutsch-brasilianischen Erforschung indigener Sprachen darstellen. Dann wird die Rezeption des Wörterbuchs in Brasilien und Deutschland besprochen. Im Anschluss erfolgt eine umfassende metalexikographische Analyse des Wörterbuchs mit besonderer Berücksichtigung des Wörterbuchtyps, des Aufbaus und Umfangs sowie der Struktur und des Inhalts. Außerdem werden die Defizite des Wörterbuchs untersucht, die hauptsächlich in den Bereichen der Graphie und Transkription, der Morphologie und Segmentierung sowie der Semantik und Übersetzung auftreten.
Nun wird sich Swadesh’s basic vocabulary zugewandt, einem speziellen Grundwortschatz bestehend aus 100 Wörtern, mit dessen Hilfe das Vokabular des Wörterbuchs eingegrenzt und zur Restitution aufbereitet werden soll. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen, die Entstehung und die Eigenschaften dieses Vokabulars besprochen und dann die Gründe angeführt, weshalb es zur Bearbeitung des Wörterbuchs der Botokudensprache eingesetzt wird. Daraufhin werden die Methoden zur Erstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs erst allgemein und dann anhand eines Beispiels erläutert. Die gesamte Liste, in der Swadesh’s Ausgangsbegriffen über 4 000 Entsprechungen aus dem Wörterbuch zugeordnet werden konnten, ist dieser Arbeit als Anhang beigefügt. Sie stellt nicht nur eine wichtige Voraussetzung für die Restitution des Botokuden-Vokabulars da, sondern kann zukünftig auch als wichtiges Instrument zur weiteren Erforschung der Botokudensprache eingesetzt werden. Zusätzlich werden einige Besonderheiten in der Struktur des Wortschatzes dieser Sprache erörtert, die sich aus der Zusammenstellung der Liste ergeben haben und fortan mitberücksichtigt werden müssen.
Am Ende dieser Arbeit wird die sprachwissenschaftliche Methode der Restitution erläutert. Die Restitution ist die synchrone Rekonstruktion von Sprachen, die wie im Falle des Wörterbuchs nur in einer mangelhaften Form überliefert wurden. Dies geschieht analog zur Swadesh-Liste erst allgemein und dann anhand eines Beispiels. Auf diese Weise wird die Restitution an einem Lexem aus dem Wörterbuch der Botokudensprache bis zu seiner phonetischen Form durchgeführt. Damit soll gezeigt werden, wie dieses Verfahren zunächst zur Wiederherstellung des übrigen Vokabulars der Swadesh-Liste und schließlich zur Restitution des Wörterbuchs und der gesamten Botokudensprache eingesetzt werden kann.
2 Indigene Ethnien und Sprachen in Brasilien
In diesem Kapitel wird ein genereller Überblick zu den indigenen Ethnien und Sprachen in Brasilien gegeben. Ausgangspunkt bildet die Besiedlung Südamerikas und die damit verbundenen Besonderheiten bei der Herausbildung indigener Sprachen. Anschließend wird deren Erforschung und weitgehende Vernichtung thematisiert und schließlich ihre heutige Situation beleuchtet. All dies soll auch als Grundlage für das Verständnis der Botokudensprache dienen.
2.1 Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung
Bei der Ankunft der Europäer in Brasilien im Jahre 1500 war der Kontinent nicht leer, sondern seit tausenden von Jahren vollständig besiedelt (Guidon 1992; Melatti 2007:17). Wann genau wie viele Völker über welche Route Amerika erreichten, ist seit langem umstritten. Angesichts neuer Erkenntnisse muss die aus den 1950er Jahren stammende Annahme, wonach nur eine Gruppe von Siedlern erst vor 12 000 Jahren über den Beringia-Landweg kam und die Clovis-Kultur begründete, überdacht werden. Vieles spricht indes dafür, dass bereits vor 70 000 Jahren mindestens zwei Völker auf unterschiedlichen Wegen einwanderten (Guidon 1992:37ff.). Archäologische Funde aus Südamerika, insbesondere Brasilien, scheinen dies zu belegen. Sie deuten auf eine 60 000 Jahre alte menschliche Präsenz im Bundesstaat Piauí hin.[2] Eine Besiedelung des südlichen Minas Gerais erfolgte vor ca. 30 000 Jahren (Guidon 1992:41).
Eine herausragende Rolle in der neuesten Forschung spielt „Luzia“, das älteste Skelett beider Amerikas. Sie wurde bei Lagoa Santa in Minas Gerais entdeckt und wird den ersten Einwanderern, den Paläoindianern, zugerechnet. Luzia konnte auf ein Alter von 11 000 bis 11 500 Jahren datiert werden und weist im Gegensatz zu heutigen südamerikanischen Indigenen mongoloiden Typs eine australo-melanesische Schädelmorphologie auf. Dies bestätigt die Annahme, dass Amerika nacheinander von mindestens zwei unterschiedlichen Völkern besiedelt worden ist (Neves/Hubbe 2004:56-60; Neves/Piló 2008).
Durch Luzia konnte erstmals eine Verbindung zwischen den prähistorischen Kulturen der Paläoindianer zu den Indigenen der Neuzeit nachgewiesen werden, was lange als schwierig galt (Guidon 1992:52). Neueste kraniometrische und genetische Untersuchungen belegen, dass Luzia und ihre Artgenossen direkte Vorfahren der Botokuden waren (Neves/Atui 2004; Neves/Piló 2008; Gonçalves et. al. 2010). Bereits im Jahr 1876 hatten Lacerda/Peixoto sowie im Jahr 1887 Ehrenreich ähnliche Vermutungen angestellt:
Wir sind, wie ich glaube, wohl berechtigt, die alten Höhlenmenschen des Centrums der Provinz Minas als die direkten Vorfahren unserer heutigen Botocuden im östlichen Theile dieser Provinz zu betrachten. […] Die Lagoasanta-Menschen […] repräsentieren das Urvolk, von dem Botocuden und heutige Gēs sich abgezweigt haben. (Ehrenreich 1887:80f.)
Die zeitlichen, geographischen und ethnologischen Umstände der Besiedelung Südamerikas beeinflussten erheblich die Sprachentwicklung und -differenzierung auf diesem Kontinent. Er liegt isoliert zwischen den größten Ozeanen der Welt und der schmale Zugang über den Isthmus von Panama erlaubte kaum Rückwanderungen. Verbunden mit der frühen Besiedelung durch mehrere Ethnien trug dies zur Herausbildung von Sprachen mit einzigartigen Merkmalen und besonderer Bedeutung für die sprachwissenschaftliche Theoriebildung bei (Rodrigues 1993:85-88).
Embora todas as línguas apresentem grande quantidade de fatos triviais para o conhecimento já acumulado pela ciência lingüística, cada língua indígena sul-americana pode apresentar fenômenos ainda desconhecidos, seja na fonologia, seja na gramática ou seja na organização do discurso. (Rodrigues 1993:85f.)
Die Vielfalt und Einzigartigkeit indigener brasilianischer Sprachen ist sowohl unter typologischen als auch unter genetischen Gesichtspunkten beachtlich. Was die Klassifikation von Sprachen aufgrund struktureller Eigenschaften angeht, existieren z.B. analytische oder polysynthetische Sprachen mit Merkmalen, die nur auf dem amerikanischen Kontinent zu finden sind. Es haben sich sowohl Sprachen mit einem außerordentlich reichen als auch extrem reduzierten Phoneminventar herausgebildet. Unter anderem treten auch verschiedene Typen von Tonsprachen auf, oder Sprachen, die zwischen einer fala masculina und fala feminina unterscheiden (Seki 2000a:240-245; Rodrigues 2001, 2002).
Die Botokudensprache ist eine der am spärlichsten erforschten aber zugleich eine der am stärksten vom Aussterben bedrohten Sprachen Brasiliens. Das Wenige, was wir über die Botokudensprache wissen, ist jedoch umso bedeutsamer. Lautlich gesehen verfügt sie z.B. über die stimmlosen Nasalkonsonanten [m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊], die weltweit selten auftreten (Ladefoged/Maddieson 1996:106-116; Seki 2008:125f.; Pessoa 2012:91-102).
Was die Klassifikation von Sprachen aufgrund von Ähnlichkeiten durch die Abstammung von einer gemeinsamen Ursprache angeht, lassen sich die noch lebenden 150-180 indigenen brasilianischen Sprachen zu etwa 40 Sprachfamilien gruppieren. Davon können wiederum jeweils 10 zu zwei noch größeren genealogischen Einheiten, den Sprachstämmen Tupí und Macro-Jê, zusammengefasst werden (Rodrigues 1993, 1999, 2001, 2002; Moore et al. 2008; Ribeiro 2006, 2010). Die Botokudensprache gehört der gleichnamigen Sprachfamilie an, die ihrerseits dem Macro-Jê Stamm zugerechet werden kann. Ein ausführlicher Überblick zur genetischen und typologischen Klassifikation der Botokudensprache erfolgt im Kapitel 4.2, S. 22.
2.2 Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen
Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen lässt sich grob in fünf Phasen unterteilen. Auf jede einzelne Phase und ihre typischen Merkmale soll im Folgenden kurz eingegangen werden.[3] Alle Forschungsbemühungen werden durch die Tatsache erschwert, das sämtliche indigenen Ethnien Südamerikas schriftlose Kulturen waren. Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache wird im Kapitel 4.1, S. 20, speziell erläutert.
Die erste Phase der Erforschung indigener Sprachen begann Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem Studium durch europäische Missionare und dauerte etwa 250 Jahre an. Sie ist durch eine Reihe von Problemen gekennzeichnet. Alle Sprachen auf die die Europäer zuerst trafen, waren Tupí-Guaraní Sprachen der brasilianischen Küste. Dies verleitete die Missionare zu Generalisierungen und Fehleinschätzungen, die zur Verfestigung des Gegensatzes „Tupí vs. Tapúya“ und zur sogenannten „Hypervalorisation des Tupí“ führten[4] (Câmara Jr. 1965:99-112). Außerdem waren die Missionare weniger an der Sprache an sich interessiert, als vielmehr an der „spirituellen Eroberung“ der Indigenen. Nicht zuletzt scheiterten die Ordensleute oft an den völlig unbekannten Strukturen der indigenen Sprachen. Diese versuchten sie anhand der ihnen vertrauten griechischen oder lateinischen Kategorien zu analysieren, was meist zu unzulässigen Deformationen führte. Dennoch verdanken wir den Missionaren wichtige Dokumente und sprachliche Entdeckungen aus den ersten drei Jahrhunderten der Kolonisation Brasiliens. Herausragende Beispiele sind die Tupí-Grammatiken der Jesuitenpadres José de Anchieta (1595) und Luis Figueira (1687) sowie die Grammatik und der Katechismus des Kipeá-Kirirí (Macro-Jê) von Padre Luis Vincencio Mamiani (1699; 1942 [1698]). Eine umfassende Studie zu portugiesischen Missionarsgrammatiken bietet Zwartjes (2011). Das intensive Studium des Tupí durch die Missionare sollte später in Gestalt der „filologia tupí“ durch brasilianische Gelehrte fortgesetzt werden (Câmara Jr. 1965:105-112).
Die zweite Phase der Erforschung indigener Sprachen setzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein. Zu dieser Zeit erfuhr die Kolonie Brasilien im Zuge der Übersiedelung des portugiesischen Königshofes eine politische und kulturelle Öffnung. Nun wurde auch europäischen Reisenden und Naturforschern der Zugang ins Land gestattet, der beispielsweise Alexander von Humboldt noch kurz zuvor, im Jahre 1800, verwehrt geblieben war. Während die ersten Missionare ihre Forschungen auf die Sprachen an der Küste beschränkt hatten, drangen die Naturalisten nun tief ins Landesinnere vor. In ihren Reiseberichten finden sich meist Aufzeichnungen verschiedener indigener Sprachen. Jedoch war dieses Material von geringer Qualität und Quantität. Es handelte sich um lose Wortlisten, die auf impressionistische Art und Weise angefertigt wurden. Dies geschah ausgehend von der Muttersprache eines jeden Forschers und unter Zuhilfenahme anderer ihm bekannter europäischer Sprachen. Außerdem erfolgte die Beschäftigung mit der indigenen Sprache oft nur nebenbei und rückte gegenüber den eigentlichen Interessen oder Aufträgen der meist in Botanik, Zoologie, Geologie oder Medizin ausgebildeten Reisenden in den Hintergrund. Insgesamt waren die Forschungen dieser Gruppe wenig systematisch und entbehrten jeglicher grammatischer Interpretation. Dennoch sind sie heute oft die einzigen Quellen zu bereits ausgestorbenen indigenen Sprachen. Typische Vertreter dieser zweiten Phase waren z.B. der französische Botaniker Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), der österreichische Botaniker, Mineraloge und Mediziner Johann Emanuel Pohl (1782-1834) und der deutsche Geologe Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855).[5] Herausragende Ausnahmen unter den Brasilienreisenden dieser Zeit sind mit Abstand Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied (1782-1867) und Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). Sie ähneln bereits den Forschern des „ethnologischen Typs“ der nächsten Phase, waren also ihrer Zeit weit voraus. Noch heute besitzen ihre Werke über die Indigenen und indigenen Sprachen bleibende Gültigkeit. In den Reisebeschreibungen aller hier genannten Personen finden sich auch Berichte über die Botokuden.
Die dritte Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen fällt in die Zeit der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Es ist zugleich die Geburtsstunde der Ethnologie in Brasilien. Wegbereiter dieser äußerst produktiven Ära sind v.a. deutsche Forscher wie Karl von den Steinen (1855–1929), Theodor Koch-Grünberg (1872–1924), Paul Ehrenreich (1855–1914) und Curt Unckel Nimuendajú (1883–1945). Nie zuvor wurden in der Geschichte Brasiliens indigene Ethnien so intensiv und mit solch geballter Expertise erforscht wie zu dieser Zeit (Drude 2005). Im Zentrum des Interesses standen die Kulturen als Ganzes, einschließlich der Sprache. Câmara Jr. sieht in dieser Einheit von ethnologischer und linguistischer Forschung aber auch ein Problem:
A maior crítica, porém, que se pode fazer a todos êsses estudos lingüísticos, como complemento dos etnológicos, é que a língua é aí sempre vista de maneira subsidiária e não essencial. Procura-se a comunicação com os nativos; procura-se estudar a língua como elemento cultural, e procura-se estudá-la para melhor autenticação dos dados etnológicos, geográficos e físicos. (Câmara Jr. 1965:124)
Nichtsdestotrotz besitzen die Sprachstudien dieser Ethnologen eine bis dato unerreichte Qualität. Erstmals war mit Koch-Grünberg auch ein ausgebildeter Philologe unter den Forschern. Und auch die Arbeiten seiner Landsleute sind in ihrem Wert für die indigene Sprachwissenschaft bis heute unumstritten. Lucy Seki hält u.a. die Bakairí-Grammatik von den Steinens (1892) für aussagekräftiger als manche Studien zeitgenössischer Autoren (2000a:236). Für die hier vorliegende Arbeit sind insbesondere die Werke Ehrenreichs über die Botokuden von Bedeutung (1887; 1896). In dieser Arbeit finden die darin enthaltenen ethnologischen und linguistischen Beschreibungen Verwendung. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts wirkt der Autor an der Übersetzung Ehrenreichs ins Portugiesische mit.
Die vierte Phase wird im Jahre 1934 mit José Oiticicas paradigmatischem Aufsatz Do método no estudo das línguas sulamericanas eingeleitet. Darin fordert er die systematische Dokumentation der indigenen brasilianischen Sprachen und ihre Erforschung mit rein sprachwissenschaftlichen Methoden. Bis dato war die gesamte Disziplin der Sprachwissenschaft an brasilianischen Universitäten inexistent. Sie beginnt sich erst langsam mit der Berufung Joaquim Mattoso Câmara Júniors (1904-1970) als erstem Professor für Linguistik im Jahre 1935 und der Veröffentlichung seiner Schriften zu formieren. Später finden sich darunter auch Beiträge speziell zur indigenen Sprachwissenschaft (Câmara Jr. 1959a-d; 1965). Weitere Pioniere dieser Phase sind Rosário Farani Mansur Guérios (1907-1987) und sein Schüler Aryon Dall’Igna Rodrigues (geb. 1925). Letzterer gilt heute als Nestor der indigenen brasilianischen Sprachwissenschaft, der seit 1942 über 110 Arbeiten zum Thema veröffentlicht hat und noch immer aktiv ist (D’angelis 2006). Lucy Seki vertritt die Ansicht, dass sich die Sprachwissenschaft in Brasilien institutionell erst in den 1960er Jahren an den Universitäten etablierte. Sie führt aus, dass das Studium der indigenen Sprachen durch brasilianische Wissenschaftler u.a. durch das Engagement des Summer Institute of Linguistics (SIL)[6], welches seit 1959 selbst im Land forscht, verzögert worden sei (Seki 1999:262-266; 2000a:237).
Die fünfte Phase setzt in den 1970er und 1980er Jahren ein und dauert bis heute an. Nunmehr erfährt die indigene brasilianische Sprachwissenschaft einen Entwicklungsschub, der sowohl die Lehre als auch die Forschung betrifft. Sie ist gekennzeichnet durch den wachsenden Anteil an brasilianischen Wissenschaftlern und die stetig steigende Anzahl an untersuchten indigenen Sprachen. Jetzt entstehen auch die ersten linguistischen Arbeiten zum Krenák, der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden (Seki 1984, 1985; Silva 1983, 1986, 1987). Im Jahre 1991 werden insgesamt 59 indigene Sprachen von brasilianischen Wissenschaftlern untersucht, was eine Steigerung von 36 % gegenüber 1985 bedeutet. Dieser Wert steigt bis 1998 noch einmal auf 80 Sprachen an. Zur gleichen Zeit werden etwa 30 Sprachen vom SIL beforscht (Seki 1999:271f.). Diese Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein großer Teil der überlebenden 150-180 indigenen brasilianischen Sprachen von der Forschung völlig unbeachtet bleibt. Außerdem sind fast alle diese Studien auf wenige Teilaspekte der Sprachen begrenzt und von sehr unterschiedlicher Qualität. Erst im Jahre 2000 erscheint mit Lucy Sekis Werk zum Kamaiurá (2000b) die erste durch eine Brasilianerin verfasste, ausführliche Grammatik einer indigenen Sprache seit Anchietas Beschreibung des Tupinambá von 1595!
Allgemein hat sich die Forschungssituation in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. In Brasilien beteiligen sich nun mehr als zehn Universitäten und Institution aktiv am Studium und Schutz indigener Sprachen (Seki 1999:273-288). Im Jahre 2005 wird dem indigenen Nanblá Gakran der Ethnie Laklãnõ (Xokléng, Jê) an der Landesuniversität von Campinas der erste Masterabschluss in Linguistik verliehen. Zurzeit arbeitet er an der Universität von Brasília an seiner Dissertation zur Lexikographie seiner Muttersprache. Vielleicht ist er der Begründer einer neuen Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen.
2.3 Die Vernichtung und heutige Situation indigener brasilianischer Sprachen
Den Ausgangspunkt dieses Kapitels bildet die Frage nach der ursprünglichen Anzahl indigener Sprachen in Brasilien. Anschließend wird ihre weitgehende Vernichtung thematisiert und zuletzt der aktuelle Status der überlebenden Sprachen erläutert.
Die genaue Anzahl der indigenen Sprachen zu beziffern, die bei der Ankunft der Europäer auf dem Gebiet Brasiliens gesprochen wurden, ist nahezu unmöglich. Für eine systematische Forschung in diesem Bereich liegen schlichtweg zu wenige Daten vor. Nach konservativen Kalkulationen Rodrigues' könnte sich ihre Anzahl aber auf 1 175 Sprachen belaufen haben (1993:88-93). Vermutlich waren es aber wesentlich mehr. Aussagen über die Zahl der indigenen Bevölkerung Brasiliens um 1500 sind ebenfalls vage und variieren stark. Der Anthropologe Julio Cezar Melatti stellt drei Schätzungen verschiedener Wissenschaftler vor, die etwa von 1,2 über 2,4 bis hin zu 4,3 Mio. Indigenen reichen (2007:43-47).
Seit dem 16. Jahrhundert ist das Aussterben indigener Sprachen in Brasilien ein andauernder Prozess. Verantwortlich dafür ist der Kollaps der indigenen Bevölkerung durch Kriege, Epidemien und Assimilationsprozesse (Moseley 2010:88).[7] Rodrigues betont, dass sich insbesondere die portugiesische Kolonisation zerstörerisch auf Sprachen und Ethnien ausgewirkt hat. Er weist darauf hin, dass ihr tödlicher Einfluss auch noch lange nach der Unabhängigkeit im Jahre 1822 anhielt und sich über die gesamte Kaiserzeit (1822-1889) und die Zeit der Republik (ab 1889) bis weit ins 20. Jahrhundert fortsetzte – je nach Zeitpunkt, Region und Intensität des fremden Einflusses (1993:93f.).[8] So starben allein 67 indigene Sprachen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus. Von 532 bis heute ausgestorbenen Sprachen wurde nur ihr Name überliefert. Viele sind einfach verschwunden, ohne dass man je von ihnen gehört hätte (Rodrigues 1993:94). Der Schwund so vieler Ethnien, Sprachen und vermutlich auch ganzer Sprachfamilien führte dazu, dass sich auf entsprechenden Karten regelrecht leere Gebiete auftun. Dies trifft v.a. auf das östliche Viertel des Landes und damit auch auf das traditionelle Stammesgebiet der Botokuden zu:
Se traçarmos uma linha imaginária de São Luís do Maranhão ao Norte até o Chuí ao Sul, a Leste dela temos uma área de pouco mais de 25% do território brasileiro, na qual se extinguiram praticamente todas as línguas indígenas. Essa é a área onde foi mais longo o processo colonizador. Aí só se falam hoje o Yatê (Fulniô) em Pernambuco, o Maxacali e o Krenak (mas este já moribundo) em Minas Gerais e o Xokléng em Santa Catarina. (Rodrigues 1993:95)
Die genaue Anzahl der heute noch verbliebenen Indigenen und indigenen Sprachen zu ermitteln, stellt die Wissenschaft vor große Herausforderungen. Es werden noch immer unbekannte Sprachen entdeckt oder man stößt auf Sprecher von bereits für Tod erklärte Sprachen. Umgekehrt können die letzten Sprecher einer Sprache sterben oder allmählich deren Gebrauch zu Gunsten einer anderen Sprache aufgeben. Zwei üblicherweise als eigenständig geführte Sprachen können sich als eng miteinander verwandte Varietäten ein und derselben Sprache herausstellen. Letzteres führt dazu, dass Moore et al. heute nur noch von 150, Rodrigues aber von 180 indigenen Sprachen in Brasilien ausgehen. Dies stellt je nach Autor einen Verlust von etwa 75-85 % der Sprachen in den letzten 500 Jahren dar (Moore et al. 2008:1f.; Rodrigues 1993:92). Im Jahre 2001 lag die Anzahl der indigenen Bevölkerung des Landes bei ungefähr 190 000, von denen aber etwa nur 160 000 indigene Sprachen sprechen (Rodrigues 2001).[9]
Sämtliche heute in Brasilien noch existierende indigene Sprachen fallen in die Kategorie der „bedrohten Sprachen“, da selbst die beiden größten von ihnen, das Tikúna und das Guaraní-Kaiowá, nur noch über etwa 30 000 Sprecher verfügen. Mehr als 30 Sprachen gelten aufgrund ihrer geringen Sprecherzahlen als „ernsthaft gefährdet“ bzw. „moribund“, da sie, wie z.B. das Xipáia, Apiaká und Guarasú nur noch von einem bzw. zwei Menschen gesprochen werden. Verschärft wird die Situation dadurch, dass gerade die Sprachen, die am ehesten vom Aussterben betroffen sind, kaum erforscht wurden (Moore et al. 2008; Moseley 2010:89). Dies trifft auch für das Krenák zu, die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden. Sie wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach für tot erklärt, zuletzt von Melatti (2007:70-72). Im von der UNESCO herausgegebenen Atlas of the World’s Languages in Danger (Moseley 2010:20f.) gilt das Krenák als “critically endangered”, was der letzten von fünf Stufen der Bedrohung vor dem Aussterben entspricht. Moore et al. beziffern die Zahl der noch lebenden Indigenen der Ethnie Krenák auf 150 Personen,[10] darunter vermutlich nur acht Sprecher (2008:6). Laut Flávia Martin sprachen im Jahre 2009 noch 9 Personen, die bereits alle über 50 Jahre alt waren, diese Sprache. Es handelte sich um Laurita, Maria Sônia, Deja, Eva, Júlia, Euclides, Gracinda, Jovelina und Antônio Jorge Krenák (2009).
Erst in den letzten Jahren hat sich in Brasilien ein Bewusstsein für bedrohte Sprachen und die dringende Notwendigkeit sie zu schützen und zu dokumentieren entwickelt. Das Aufgabenspektrum heutiger Linguisten umfasst u.a. die Analyse und den Vergleich indigener Sprachen, ihre Revitalisierung sowie die Rekonstruktion ihrer Geschichte und ihres Ursprungs sowie das Auffinden und Nutzbarmachen von Material bereits ausgestorbener Sprachen. Mehrere nationale und internationale Initiativen sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert (Moseley 2010:89). Darunter auch das Projekt Dokumentation bedrohter Sprachen (DoBeS) der Volkswagenstiftung in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen.[11] Vielleicht kann auch die vorliegende Arbeit einen kleinen Beitrag leisten.
3 Die indigene Ethnie der Botokuden
In diesem Kapitel wird zunächst ein chronologischer Überblick zu den wichtigsten Bezeichnungen der Botokuden geben. Dann folgt eine Erläuterung zu ihrem Verbreitungsgebiet und ihrer Lebensweise.
3.1 Namensgebung
Es existiert eine Fülle von Bezeichnungen, die auf die Botokuden referieren. Zu Beginn der Kolonisation waren dies meist unpräzise und pejorative Fremdbezeichnungen. Deren Anzahl, Art und Gebrauch veränderte sich schrittweise, je nach Vordringen der Europäer und ihrer Kenntnis der Ethnie. Für mehr als 300 Jahre war es unmöglich, Aussagen über die tatsächlichen Stammesnamen und -zugehörigkeiten zu treffen. Gründe hierfür waren die einst enorme räumliche Verbreitung der Botokuden im lange unerschlossen gebliebenen Hinterland Südostbrasiliens, ihre soziale Zersplitterung in kleine Gruppen (engl. bands) und nicht zuletzt ihre natürlichen Wanderungs- und erzwungenen Fluchtbewegungen.
Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird der Gebrauch von Eigenbezeichnungen der Ethnie überliefert. Deren Vielfalt und Fremdartigkeit stellte die Forscher oft vor große Herausforderungen. Durch das bessere Verständnis der Sprache und die vergleichende Analyse historischer Quellen lassen sich heute einige Namen und Ethnien genauer zuordnen. Dennoch existiert bislang kein schlüssiges Gesamtbild.
Tapúya:[12] Dieser Ausdruck bedeutet „Fremde, Feinde, Barbaren“. Darunter subsummierten schon vor Ankunft der Europäer die kulturell und sprachlich relativ homogenen Tupí-Guaraní der brasilianischen Küste die große Vielfalt an anderssprachigen Ethnien aus dem Hinterland. Darunter auch die Botokuden, die Ehrenreich als „den mächtigsten und gefürchtetsten Stamm der Tapuyas“ bezeichnet (1887:79). Die große Diversität unter diesen Sprachen und Kulturen muss verwirrend auf die ersten Missionare und Chronisten gewirkt haben. Sie übernahmen die Bezeichnung und trugen somit zur Verfestigung des fundamentalen Gegensatzes „Tupí vs. Tapúya“ bei, der die Vorstellungswelt über die brasilianischen Indigenen während der gesamten Kolonialzeit prägen sollte (Wright/Carneiro da Cunha 1999:335). Die Abneigung gegenüber den Tapúya wird z.B. an den Zeilen des Jesuiten Fernão Cardim deutlich, der im Jahre 1584 schreibt:
Todas estas setenta e seis nações de Tapuyas, que têm as mais dellas differentes linguas, são gente brava, silvestre e indomita, são contrárias quazi todas do gentio que vive na costa do mar, visinhos dos Portuguezes [...] com os mais Tapuyas, não se pode fazer conversão por serem muito andejos e terem muitas e differentes linguas dificultosas. (Cardim 1881 [1584]:59f.)
Erst im Jahre 1867 kann Martius zeigen, dass sich der abwertende Sammelbegriff Tapúya nicht zur wissenschaftlichen Klassifikation von indigenen brasilianischen Sprachen eignet. Martius ist sogar der erste, dem es gelingt, die Jê-Sprachfamilie als solche zu erkennen und aus dem unspezifischen Konglomerat herauszulösen (1867). Heute weiß man, dass die damals als Tapúya bezeichneten Ethnien und Sprachen mehrheitlich dem Macro-Jê Sprachstamm angehören. Dieser Terminus wurde wiederum 1950 von J. Alden Mason geprägt, um Begriffe wie Tapuya und Tapuya-Jê zu ersetzen (Mason 1950:298f; Ribeiro 2006).
Aimoré: Die Bedeutung dieser Bezeichnung ist nicht gesichert, könnte aber auf die Tupí-Wörter aib-poré „Bewohner der Wildnis“, ai-boré „Unhold“ oder aimb-buré „die, die Lippenscheiben aus dem emburé-Holz tragen“ zurückgehen (Paraiso 1990:64f.).[13] Der Ausdruck tritt Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals bei Chronisten auf, als Indigene aus dem Hinterland die Kapitanien[14] Porto Seguro und Ilhéus überfallen und verwüsten: “Chamanse Aimorés, os quaes andam por esta costa como salteadores,& habitam da capitania dos Ilheos ate a de Porto Seguro. Estes Alarves tem feito muito dãno nestas capitanias […]” (Gandavo 1576:44). Ab 1555 unternehmen portugiesische Eroberer mehrere bewaffnete Expeditionen, um das Landesinnere zu erkunden und Indigene zu versklaven. Auch sie treffen auf Aimorés (Paraiso 1990:66f.). Der Gebrauch dieser Bezeichnung hält etwa 100 Jahre an. Fast alle Forscher sind sich darüber einig, dass die Aimorés identisch sind mit der Ethnie, die man später als Botokuden bezeichnen wird (Emmerich/Monserrat 1975). Heute erinnern in Brasilien einige Toponyme an die Bezeichnung dieser Indigenen, wie z.B. der Gebirgszug und die Stadt “Serra dos Aimorés” in Minas Gerais. Die Mehrzahl der Brasilianer assoziiert den Namen indes mit Backwaren der gleichlautenden Lebensmittelmarke (biscoitos Aymoré), die mit einem stilisierten Indigenen für ihre Produkte wirbt.
Guerén/Gren/Kren: Hierbei handelt es sich vermutlich um die Selbstbezeichnung einer Untergruppe der Botokuden, die aber stellvertretend auf die gesamte Ethnie angewendet wurde. Die Bedeutung lautet Kopf[15]. Metonymisch steht dieser Ausdruck wohl für den Menschen als Ganzes. Die Bezeichnung entstand etwa zur selben Zeit wie Aimoré, also um 1550, und wird synonym verwendet (Emmerich/Monserrat 1975). Ab 1650 verdrängt er sogar völlig den Ausdruck Aimoré. Die Bezeichnung tritt bis 1760 auf und wird dann durch Botocudo ersetzt. Traurige Berühmtheit erlangen die Guerén/Gren/Kren als ihnen 1673 offiziell der „Gerechte Krieg“ erklärt wird (Southey 1817:564-567). Čestmír Loukotka kann durch einen Sprachvergleich zeigen:
“[…] les Gueren étaient en effet une tribu des Botocudos” (1955:120f.).
Botocudo/Botokuden: Dieser Ausdruck lässt sich auf das portugiesische Wort botoque ‚Fassspund‘ zurückführen und verweist auf die hölzernen Lippen- und Ohrscheiben, die diese Ethnie trug: “Botôque chamaõ no Brasil a pedra, que os Indios metem na barba, furada para este effeito, & he seu principal ornato [...]” (Bluteau 1728:170). Die Bezeichnung wird seit 1760 für die Indigenen benutzt, die im Grenzgebiet der heutigen Bundesstaaten Minas Gerais, Espírito Santo und Bahia lebten (Emmerich/Monserrat 1975:8).[16] Sie findet in der gesamten Literatur vom Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts breite Verwendung.[17] Dabei handelt es sich um eine verallgemeinernde Fremdbezeichnung mit pejorativen Konnotationen. Obwohl der Ausdruck Botokuden aus diesen Gründen umstritten ist, wird er bis heute auch in der sprachwissenschaftlichen Literatur benutzt. Meist um eindeutig zu Kennzeichnen, dass man sich unter räumlichen, zeitlichen und sprachlichen Gesichtspunkten auf genau jene Indigenen bezieht und nicht auf die einer anderen Epoche (wie z.B. Tapúya, Aimoré oder Guerén). Seit mehr als zwanzig Jahren ist es auch üblich, dem Ausdruck Botokuden die Eigenbezeichnung Borúm hinzuzufügen, die „(indigener) Mensch“ bedeutet. In dieser Arbeit wird hingegen, wie in der Einleitung erläutert, die deutsche Form Botokuden verwendet. Eingang in die belletristische brasilianische Literatur fand die Bezeichnung in Machado de Assis Roman Memorias postumas de Bras Cubas (1881:313).[18] Heute wird die Bezeichnung botocudo in Brasilien umgangssprachlich für ein “indivíduo rude, rústico, incivil, caipira” verwendet (Houaiss et al. 2001:498; Ferreira et al. 2004:321).
Borúm: Dies ist seit jeher die Eigenbezeichnung der Botokuden. Sie wird als Oberbegriff auch von den unterschiedlichen Subgruppen benutzt. Die Bedeutung lautet „Mensch, Indigener“. Rudolph schreibt in seinem Wörterbuch: „porum – Mann; Name, den die Botokuden sich selbst geben […]“ (1909:38). Korrekt müsste der Ausdruck nach Pessoa phonetisch [mbuˈɾũŋ] und phonologisch /buɾũŋ/ transkribiert werden (2012:150/169). Die Botokuden bezeichneten demgegenüber alle nicht-Indigenen mit [kɾaˈʔi] ‘não-índio’ oder [kɾẽnˈtɔn] ‘cabeça louca/feia’ (Emmerich/Monserrat 1975:9f.).
Die Eigenbezeichnungen unzähliger Subgruppen werden ab dem 19. Jahrhundert überliefert. Sie sind topographischen Ursprungs[19] oder ergeben sich aus den Namen ihrer Anführer.[20] Loukotka stellt eine Liste mit insgesamt 38 Subgruppen der Botokuden zusammen, einschließlich der Bedeutung ihrer Namen (1955:114f.). Die wichtigsten Subgruppen sind laut Ehrenreich Nāk-nenuk, Nāk-erehä, Etwet, Takruk-krak und Ńep-ńep (1887:8).
Naknenúk: Die Bedeutung ist nicht abschließend geklärt und schwankt zwischen den gegensätzlichen Interpretationen „nicht von diesem Lande“ und „Herren des Landes“ (Ehrenreich 1887:8f.)[21] Hierbei handelt es sich um die Eigenbezeichnung einer der größten Subgruppen der Botokuden, die um 1940 ausstarb (Nimuendajú 1946:99). Der Gebrauch der Bezeichnung Naknenúk ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts überliefert: “Cheguei ao Rio de Santo Antonio pelo Doce [...] Achei no caminho huma numerosa Tropa de Indios Naknenuks […]” (Marlière 1825:158). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über die Flusstäler des Rio Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus und Doce (Loukotka 1968:71; Emmerich/Monserrat 1975:12-19).[22] Teófilo Otoni hat die Naknenúk am Mucuri im Jahre 1859 ausführlich beschrieben: “Recapitulemos as tribos de que tenho dado perfunctória notícia. Nas cabeceiras do sul do Mucuri e Alto Todos os Santos as tribos confederadas dos naknenuks. Os naknenuks são botocudos” (2002 [1859]:86). Vermutlich hat Bruno Rudolph die meisten Vokabeln in seinem Wörterbuch unter den Naknenúk am Mucuri gesammelt, wo er mehr als 40 Jahre lebte und arbeitete (Rothe 1985:89).[23]
Krenák:[24] Dies ist die Bezeichnung der einzigen überlebenden Subgruppe der Botokuden. Sie geht zurück auf den Namen ihres Anführer Capitão Krenák, der sich mit seinen Gefolgsleuten am Anfang des 20. Jahrhunderts von der Subgruppe der Gutkrák abspaltete.[25] Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Krenák umfasste die Flusstäler des mittleren Rio Doce in Minas Gerais (Estigarribia 1934:39). Nach einem langen und grausamen Prozess der Repression und der Diaspora[26] leben sie heute mehrheitlich wieder auf ihrem angestammten Territorium in einem Reservat , der Aldeia Krenák, nahe der Stadt Resplendor – MG.[27] In den 1980er Jahren wurde ihre Sprache u.a. durch Lucy Seki dokumentiert und zuletzt von Pessoa (2012) einer umfassenden phonetischen und phonologischen Analyse unterzogen. Als berühmtester Krenák gilt heute ihr Anführer, der Schriftsteller und Aktivist Ailton Krenák. Im Jahre 2003 wurde er durch die Regierung des Bundesstaates Minas Gerais zum Sonderbevollmächtigten für indigene Angelegenheiten (Assessor Especial para Assuntos Indígenas) ernannt. Laut eigener Aussage markiert erst dieses Ereignis das Ende des Krieges, der den Botokuden 1808 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte seitens der portugiesischen Krone offiziell erklärt wurde (Tavares Coelho 2009:203).
3.2 Verbreitungsgebiet und Lebensweise
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Botokuden erstreckte sich über weite Teile des östlichen Brasilianischen Berglandes. Das Gebiet wird von einer Reihe großer Flüsse durchzogen, wie dem Rio Pardo und Jequitinhonha im Norden, dem Mucuri und São Mateus im Zentrum sowie dem Doce und Manhuaçu im Süden. In dem zerklüfteten Bergland, welches einst mit dichtem atlantischen Regenwald bedeckt war, herrscht tropisches Klima. Wied schreibt, dass die Botokuden den Raum bewohnen, „der sich längs der Ostküste, jedoch mehrere Tagesreisen vom Meere entfernt vom 15ten bis zu 19½ Graden südlicher Breite ausdehnt […]“ (2001 [1821]:2). Als westliche Grenze ihres Verbreitungsgebietes kann etwa der 43. westliche Längengrad gelten. Das Areal umfasste die Grenzregionen der heutigen Bundesstaaten Minas Gerais, Espírito Santo sowie den Süden von Bahia und belief sich auf ca. 150 000 km2, was 42 % der Fläche Deutschlands entspricht.[28]
Im Folgenden sollen einige Aspekte der traditionellen Lebensweise der Botokuden geschildert werden. Diese herrschte noch bis etwa zur Hälfte des 18. Jahrhunderts vor. Bis dahin hatte es unter den Botokuden fast keinen durch Europäer induzierten Kulturwandel gegeben, da ihr Gebiet, der sogenannte Sertão do Leste, von der Kolonisation völlig unberührt geblieben war.[29]
Nach dem von Kästner verwendeten historisch-ethnographischen Klassifikationssystem waren die Botokuden Vertreter des wirtschaftlich-kulturellen Typs der Jäger und Sammler, der tropischen Waldgebiete Südamerikas (1987:653f.; 1990:25). Ein Hauptmerkmal ihrer Lebensweise war der Nomadismus sowie die soziale Organisation in viele kleine Gruppen, die sich wiederum in unzählige Subgruppen aufspalteten. Diese bands bestanden aus etwa 50 bis 200 Individuen, die sich häufig auch untereinander bekriegten (Métraux 1946:536). Ihre Anführer zeichneten sich durch physische Stärke (nyipmrõ) und metaphysische Kräfte (yikę́gn) aus, waren aber ansonsten nicht von ihren Stammesgenossen zu unterscheiden (Nimuendajú 1946:98). Das markanteste Zeichen der kulturellen Identität der Botokuden war der Gebrauch von hölzernen Lippen- und Ohrscheiben (port. botoques), worauf auch ihre Bezeichnung zurückgeht.[30]
Kleidung war den Botokuden unbekannt, abgesehen von einem Penisfutteral bei den Männern (Métraux 1946:534). Der Gebrauch bunter Vogelfedern war selten. Allein die Männer befestigten sie entweder mit Wachs an den Haaren oder mit Bastschnüren an Armen und Beinen (Wied 2001 [1821]:12f.; Métraux 1946:534). Ihr Kopfhaar trugen die Botokuden ähnlich einer Tonsur mit einem kahlen Streifen über den Ohren. Die übrige Körperbehaarung epilierten sie vollständig. Zu festlichen und kriegerischen Anlässen bemalten sie ihren Körper mit rotem Urucu (Bixa orellana) und blauschwarzem Jenipapo (Genipa brasiliensis) (Wied 2001 [1821]:10ff.; Ehrenreich 1887:22).
Einen Großteil ihrer Zeit verwendeten die Botokuden für die Nahrungsbeschaffung. Anders als es die üppige Vegetation ihres Verbreitungsgebiets vermuten lässt, konnten selbst die erfolgreichsten Wildbeuter der Natur nur wenig Essbares abringen. Es herrschte dabei eine strenge geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Während die Männer mit Pfeil und Bogen fischten sowie Affen, Vögel, Reptilien und Kleinsäuger jagten, oblag es den Frauen Früchte, Nüsse, Wurzeln und Insektenlarven zu sammeln (Ehrenreich 1887:27-30).[31]
Die Herstellung von Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen und Waffen ist ebenfalls überliefert. So fertigten die Frauen Schnüre aus Pflanzenfasern, die später zu Tragenetzen weiterverarbeitet wurden. Dies machte die Technik des Korbflechtens überflüssig. Das Brennen von Keramik war den Botokuden ebenfalls unbekannt (Métraux 1946:535). An Werkzeugen verwendeten sie Steinäxte und -klingen sowie scharfe Schaber aus Bambus (taquara). Feuer entfachten die Botokuden mit einem Feuerbohrer aus geeigneten Hölzern. Waren diese nicht verfügbar, so benutzten sie mitgeführte glimmende Holzstücke oder kleine Fackeln aus rohem Bienenwachs (Wied 2001 [1821]:18f.; Ehrenreich 1887:24f.). Zu den Hauptwaffen der Botokuden gehörten Pfeil und Bogen. Die Pfeile unterschieden sich je nach Einsatzzweck in Größe und Machart. So gab es Pfeile für große Tiere, Kriegspfeile mit Widerhaken und Vogelpfeile mit mehreren Spitzen (Ehrenreich 1887:25f.). Außerdem beschreibt Wied rituelle Stockkämpfe, die mit langen Bambusstangen ausgefochten wurden (2001 [1821]:43). Schließlich präparierten sie den Weg auf der Flucht oder auf dem Rückzug von Gefechten mit scharfen Bambusspitzen (Métraux:1946:536).
Die Botokuden nutzten als Behausungen temporäre Unterstände aus kreisförmig in die Erde gesteckten Palmzweigen und einfache Hütten aus einem mit Lianen verbundenen Holzgestell und schräg angestelltem Dach, das mit Blättern gedeckt war (Ehrenreich 1887:22f.).[32] Im Gegensatz zu vielen anderen indigenen Völkern Brasiliens war den Botokuden der Gebrauch der Hängematte unbekannt. Sie schliefen entweder auf dem nackten Boden, auf Laub oder auf dem Bast einer Baumrinde (Ehrenreich 1887:23).
Zur Behandlung von Krankheiten verfügten die Botokuden über ein breites Wissen an Arzneimitteln und Heilmethoden. So ist z.B. die Anwendung von Dampfbädern, Abführ-, Brech- und schweißtreibenden Mitteln sowie die Heilung von Wunden, Frakturen, Atemwegs- und Hauterkrankungen überliefert (Wied 2001 [1821]:52-56; Ehrenreich 1887:35f.; Métraux 1946:537f.). Der Aderlass erfolgte mittels Pfeilschuss in die Stirnvene (Ehrenreich 1887:36).
Zur Geburt eines Kindes zogen sich die Frauen allein in den Wald zurück. Kleinkinder trugen sie stets in einer um die Stirn gelegten Bastschlinge auf dem Rücken, wobei die Hangelenke des Kindes vor dem Hals der Mutter zusammengebunden wurden (Ehrenreich 1887:31).[33] Ehen schlossen die Botokuden ohne Zeremonie und lösten sie ebenso rasch wieder auf. Geheiratet wurde meist exogam, also aus der Gruppe heraus. Polygynie war das Privileg starker Männer und begabter Jäger. Oft hatten daher nur die Anführer mehrere Frauen (Métraux 1946:537).
Was die Begräbnisriten angeht, herrscht Uneinigkeit unter den Autoren. Wied schreibt, dass der Leichnam in seiner Hütte mit zusammengebundenen Händen, auf dem Rücken liegend und ohne Beigaben bestattet wurde. Anschließend wurde der Wohnplatz verlassen und auf dem Grab ein Feuer entfacht, um böse Geister fernzuhalten (Wied 2001 [1821]:56ff.). Andere Quellen beschreiben z.B. eine hockende Position des Toten, die Beigabe persönlicher Gegenstände und das Stampfen der Erde bzw. Reinigen des Waldbodens (Métraux 1946:537; Ehrenreich 1887:33f.).
Die Botokuden glaubten an eine Reihe von übernatürlichen Wesen. Paraiso unterteilt sie in vier Gruppen. Die der himmlischen Sphäre (marét), angeführt durch den Kulturheroen Marét-Khamaknian,[34] die Naturgeister der irdischen Sphäre (tokón), die Geister der Seele lebender Menschen (nakandyúng) sowie die der Toten und der Unterwelt (nandyóng) (Paraiso 1992:425). Die Botokuden, die übernatürliche Kräfte (yikę́gn) besaßen, konnten mit den marét in Kontakt treten. Dies geschah meist an Orten mit heiligem Totempfahl (yoñkyón) (Nimuendajú 1946).[35]
Die übernatürlichen Wesen kamen auch in den Mythen der Botokuden vor. Im Jahre 1939 konnte Nimuendajú 23 dieser Erzählungen mit Hilfe von Informanten dokumentieren. Sie handeln von der Entstehung und Ordnung der Dinge und ihrem göttlichen Grund, z.B. „Der Ursprung des Gewitters“ oder „Der Erwerb des Feuers“ (Viveiros de Castro 1986:90-97). Außerdem konnte Manizer im Jahre 1915 erstmals Erzählungen der Botokuden zweisprachig und in internationaler Lautschrift festhalten. Es handelt sich dabei um Tierfabeln, wie „Jaguar, Hase und Frosch“ oder „Der Kaiman und das hübsche Mädchen“ (Sebestyén 1981). Diese Quellen sind von großem Wert, da sie einen umfassenden Zugang zur Sprache und Kultur der Botokuden ermöglichen.[36]
4 Die Sprache der Botokuden
Dieses Kapitel beschreibt die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache und geht dabei auf wichtige Persönlichkeiten und Primärquellen sowie ihre spätere Systematisierung ein. Sodann wird die genetische und typologische Klassifikation des Krenák erläutert, der Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden. Anhand einer Auswahl von typologischen Merkmalen werden dann einige phonetische und phonologische sowie morphosyntaktische Aspekte des Krenák ausführlicher dargestellt.
4.1 Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache
Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache beginnt mit Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied. Im zweiten Band seines 1821 erschienenen Reiseberichts beschreibt er nicht nur detailliert die Lebensweise der Botokuden, sondern liefert auch eine 459 Wörter umfassende Liste mit Sprachproben (2001 [1821]:305-314). Diese hatte er 1816 am Jequitinhonha gesammelt und später zusammen mit dem von ihm nach Deutschland gebrachten Botokuden Quäck überprüft und vervollständigt. Im weiteren Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts entsteht eine große Anzahl an Quellen zur Botokudensprache. Es handelt sich dabei jedoch fast ausschließlich um einfache Wortlisten. Diese wurden von Personen erstellt, die der in Kapitel 2.2, S. 6-8, geschilderten zweiten und dritten Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen angehören. Insgesamt sind heute 58 Vokabulare der Botokudensprache als Primärquellen bekannt (Seki 2008:125). Der Zugang zu ihnen gestaltet sich, abgesehen von einigen frei verfügbaren Digitalisaten, schwierig. Viele Listen lagern verstreut in Archiven, befinden sich als unveröffentlichte Manuskripte teilweise in Privatbesitz oder sind ganz und gar verloren gegangen.
Die Vokabulare der Botokudensprache sind von sehr unterschiedlicher Qualität und Quantität, was ihre heutige sprachwissenschaftliche Verwertbarkeit oft beeinträchtigt. Die Mehrzahl der Listen umfasst nur wenige hundert Wörter. Selten enthalten sie ganze Sätze oder gar Texte. Beschreibungen der Grammatik sind fast nie zu finden. Die Autorschaft ist sehr heterogen, was die Nationalität, Muttersprache, Ausbildung, den Beruf und das Forschungsinteresse betrifft.[37]
Auch die Methoden zur Erstellung der Wortlisten waren nach heutigen Maßstäben oft ungeeignet. Häufig wurden die Sprachproben mit Hilfe von Dritten gesammelt, die keine Muttersprachler des Botokudo waren, sondern lediglich Mittler zwischen den Forschern und den Indigenen:
Je disais des mots portugais à un nègre du commandant qui avait appris l’idiome des sauvages; je faisais répéter les traductions du nègre à un Botocudo de la troupe de Jan-oé, et j’écrivais ensuite. Après avoir mis sur le papier les mots qui m’avaient été dictés en langage botocudo, je les lisais à l’Indien de Jan-oé, en me faisant montrer par lui les objets que représentaient ces mots; quand il ne me comprenait pas bien, je me faisais répéter les mêmes mots par le nègre de Julião, et, après cela, je corrigeais ce que j’avais écrit. (Saint-Hilaire 1830:153f.)
Die große Mehrheit der Autoren verwendet keinerlei System zur phonetischen Transkription. Die Graphie orientiert sich an ihren europäischen Muttersprachen. Dies führt dazu, dass sie die tatsächlichen Laute der Botokudensprache oft nur fehlerhaft oder gar nicht erfassen.
Als herausragende Positivbeispiele sind aus mehreren Gründen die Quellen dreier Autoren zu nennen. Allen voran Ehrenreich, der auf die sieben im Jahre 1867 schon von Martius kompilierten Vokabulare zurückgreift, sie „einer genaueren Durchsicht unterzieht“ und seinem eigenen Material hinzufügt (1887; 1896). Dabei benutzt er zur Transkription das Allgemeine Linguistische Alphabet von Karl Richard Lepsius (1855). Ehrenreichs Sprachproben der Botokuden umfassen auch ganze Sätze und sogar relativ umfassende Studien der Grammatik. Die Qualität des Materials wird später wohl nur noch von dem linguistisch geschulten Manizer übertroffen, der mittels des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) Fabeln und Lieder der Botokuden transkribiert (1915).[38] Auch Nimuendajú liefert mit seinen Vokabularen und anthropologischen Studien zur sozialen Organisation, zum Glauben und zur Verwandtschaftsterminologie wertvolle Beiträge zur Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache (1939; 1946).[39]
Die Systematisierung der Primärquellen beginnt mit Loukotka, der alle bis dato erschienenen Veröffentlichungen zur Botokudensprache auflistet und selbst phonologische und morpho-syntaktische Untersuchungen vornimmt (1955:131-134). Emmerich und Monserrat analysieren 20 Jahre später 28 Vokabulare, um so das Phoneminventar und eventuelle dialektale Unterschiede der Botokudensprache zu ermitteln (1975). Zuletzt präsentiert Seki im Jahre 2008 eine Übersicht von 41 Wortlisten der Botokudensprache und ordnet diese nach Botokuden-Subgruppe, Autor, Umfang, Entstehungsort und -zeit. Außerdem erstellt sie eine kommentierte Bibliographie, die 76 Titel zum Thema umfasst (2008:129-139).[40]
Die spärlichen Versuche die Grammatik zu beschreiben, beschränken sich auf wenige strukturelle Aspekte der Sprache. Darunter im 19. Jahrhundert Göttling in Wied (2001 [1821]:315-318), der bereits erwähnte Ehrenreich (1887; 1896), auf Ehrenreich basierend Müller (2004 [1888]) und im 20. Jahrhundert Marlière (1904), Loukotka (1955), Emmerich und Monserrat (1975), Seki (1985) und Silva (1986). Große Fortschritte bei der Erforschung der Grammatik wurden zuletzt durch Seki (2000c; 2004) erzielt. Für den Bereich der Phonetik und Phonologie ist Pessoa (2012) hervorzuheben. Beide stützen sich auf Sprachmaterial, das in den 1980er Jahren durch Seki unter den Krenák, der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden, gesammelt wurde.
4.2 Die genetische und typologische Klassifikation der Botokudensprache
Verlässliche Aussagen zur genetischen und typologischen Klassifikation der Botokudensprache können nur auf Basis des Krenák erfolgen. Die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden wurde als einzige nach modernen linguistischen Methoden erforscht (Silva 1986; Seki 2000c, 2002, 2004; Pessoa 2012). Aus diesem Grund wird im Folgenden die Bezeichnung Botokudensprache durch Krenák ersetzt. Dies entspricht auch der neueren Literatur: “Krenák (formerly called Botocudo […])” (Rodrigues 1999:167).
Inwieweit das Krenák, welches in den 1980er Jahren dokumentiert wurde, identisch ist mit der Botokudensprache des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, kann nicht abschließend geklärt werden. Um einen Prozess wie den Sprachwandel oder eventuelle dialektale Unterschiede berücksichtigen zu können, reichen die vorhandenen Daten nicht aus.
Loukotka z.B. hielt das “Botocudo” für eine Sprache mit verschiedenen Dialekten, darunter etwa das Krenák oder das Naknenúk (1968:71). Die Existenz von dialektalen Unterschieden zwischen den verschiedenen Subgruppen konnte aufgrund des mangelhaften Sprachmaterials der Wortlisten jedoch weder bestätigt noch widerlegt werden (Emmerich/Monserrat 1975). Seki schreibt:
As fontes históricas mencionam freqüentemente a mútua inteligibilidade entre os vários grupos botocudo ou notam a ausência de differenças lingüísticas “consideráveis” entre os dialetos, sem, contudo, explicitar quais seriam essas diferenças no nível fonológico, gramatical ou lexical.(Seki 2008:127)
Die genetische Klassifikation von Sprachen geschieht aufgrund der Abstammung von gemeinsamen Ursprachen. Um auf eine Ursprache schließen zu können, werden u.a. Wortlisten auf Kognaten und Lautentsprechungen untersucht. Genetisch verwandte Sprachen bilden eine Sprachfamilie. Sprachfamilien können zu größeren genealogischen Einheiten, den Sprachstämmen angeordnet werden.[41]
Das Krenák ist das einzige Mitglied der gleichnamigen Sprachfamilie, die selbst wiederum dem Sprachstamm Macro-Jê angehört (Ribeiro 2006:422). Der Sprachstamm Macro-Jê gehört zu den weniger erforschten Sprachstämmen in Südamerika und wird deswegen auch als „Arbeitshypothese“ betrachtet (Rodrigues 1999:165). Ihm werden je nach Forschungsstand und Ansicht der verschiedenen Wissenschaftler zwischen 12 und 15 Sprachfamilien zugeordnet. Weitgehend akzeptiert ist die genetische Klassifikation nach Rodrigues (1999). Danach umfasst der Sprachstamm Macro-Jê neben dem Hauptmitglied Jê, die verwandten Sprachfamilien Kamakã, Maxakalí, Krenák, Purí, Ofayé, Rikbaktsá, Boróro, Karajá, Karirí, Yatê und Guató. Im Jahre 2010 konnte die Zugehörigkeit der Sprachfamilie Jabutí zum Sprachstamm Macro-Jê nachgewiesen werden (Ribeiro/van der Voort 2010). Die Aufnahme der Sprachfamilien Chiquitano und Otí bleibt hingegen umstritten (Greenberg 1987; Kaufman 1994).
Geografisch verteilen sich die Sprachfamilien des Sprachstammes Macro-Jê hauptsächlich auf die Gebiete Zentral- und Ostbrasiliens. Die Amazonasregion bleibt dabei völlig ausgespart. Aufgrund der großen Ansammlung von Macro-Jê Sprachen in Ostbrasilien, also auch dort, wo das Verbreitungsgebiet der Botokuden lag, kommt der Region wohl eine besondere Bedeutung zu:
É interessante o fato de ter occorido, historicamente, uma tal conçentração de línguas Macro-Jê na parte leste do Brasil, desde o Rio de Janeiro até a Bahia. Essa poderia ser a zona de origem do Macro-Jê, uma especulação que poderia ser iluminada por reconstruções das relações internas entre as famílias Macro-Jê nessa área (Maxakali, Botocudo, Puri e Kamakã). (Urban 1992:91)
Vier der zum Sprachstamm Macro-Jê gehörende Sprachfamilien sind bereits ausgestorben und acht verfügen nur noch über eine einzelne lebende Sprache als Mitglied, darunter das Krenák.[42]
Die typologische Klassifikation von Sprachen geschieht aufgrund grammatikalischer Eigenschaften, d.h. ohne Rückgriff auf historisch-genetische und geografische Zusammenhänge. Die Macro-Jê Sprachen weisen untereinander große typologische Ähnlichkeiten auf. Im Wesentlichen sind dies laut Rodrigues (1999) und Ribeiro (2006, 2010):
a) ein größeres Phoneminventar an Vokalen als an Konsonanten
b) eine im Vergleich zu anderen Sprachstämmen einfache Silbenstruktur
c) ein fester, vorhersagbarer Wortakzent
d) eine relativ einfache Flexionsmorphologie
e) die Stellung des Verbs am Satzende
f) das Auftreten von Postpositionen anstelle von Präpositionen
g) das Auftreten von Nomen und deskriptiven Verben anstelle von Adjektiven
Alle diese Eigenschaften werden bis auf a) auch vom Krenák geteilt. Sie sollen nun zusammen mit einigen anderen Merkmalen dieser Sprache erläutert werden. Obwohl nur wenig über das Krenák bekannt ist, kann hier nur eine Auswahl an Sprachmerkmalen geschildert werden. Eine umfassendere Analyse bietet Silva (1986), Seki (2000c; 2004) und Pessoa (2012).
4.2.1 Phonetische und phonologische Aspekte des Krenák
Das Phoneminventar des Krenák verfügt über 22 Konsonanten und 12 Vokale (Pessoa 2012:103-136). Anders als es für die Mehrheit der Macro-Jê Sprachen typisch ist, überwiegt hier die Zahl der Konsonanten. Zunächst werden die konsonantischen Phoneme und ihre lautlichen Realisierungen zur besseren Übersicht tabellarisch dargestellt:
Tabelle 1: Die 22 konsonantischen Phoneme des Krenák
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Pessoa (2012:103), eigene Darstellung.
Tabelle 2: Die konsonantischen Phone des Krenák
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Pessoa (2012:103), eigene Darstellung.
Das konsonantische Phoneminventar des Krenák ist sogar noch komplexer als das des Kayapó, der Jê Sprache mit dem größten Konsonantensystem (Rodrigues 1999:178f.). Hervorzuheben sind die Klassen der stimmlosen und stimmhaften Plosive sowie die stimmlosen und stimmhaften Nasale, die alle miteinander kontrastieren, wie das folgende Beispiel zeigt:[43]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Überhaupt stellt die Klasse der stimmlosen Nasalkonsonanten [m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊] eine Besonderheit dar, da diese Laute weltweit nur in wenigen anderen Sprachen auftreten (Ladefoged/Maddieson 1996:106-116; Seki 2008:125f.; Pessoa 2012:91-102). Wie einige andere Macro-Jê Sprachen verfügt auch das Krenák über komplexe Phoneme, die nur als Sequenz von Lauten bzw. artikulatorischen Bewegungen realisiert werden. Darunter die stimmhaften Plosive /b d ɡ/, die meist als prä- und postnasalisierte Kontursegmente [mb, nd, ŋɡ] und [bm, dn, ɡŋ] hörbar sind. Ähnlich verhält es sich mit der stimmhaften postalveolaren Affrikate /dʒ/, die nur als pränasales Kontursegment [ndʒ] artikuliert wird (Pessoa 2012:119-124/127).
Die zwölf Vokale des Krenák teilen sich in sieben Oral- und fünf Nasalvokale mit Phonemstatus auf. Sie werden nun zusammen mit ihren lautlichen Realisierungen tabellarisch dargestellt:
Tabelle 3: Die 12 vokalischen Phoneme des Krenák
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Pessoa (2012:135/138), eigene Darstellung.
Tabelle 4: Die vokalischen Phone des Krenák
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Pessoa (2012:136/138/185), eigene Darstellung.
Wie bei den meisten Macro-Jê Sprachen ist auch im Falle des Krenák die Anzahl der Nasalvokale geringer als die der Oralvokale (Rodrigues 1999:172). Das Auftreten von kontrastierenden Nasalvokalen ist typisch für viele Macro-Jê Sprachen. Als Beispiel dienen die Vokale /i ĩ/:
Die Silbenstruktur im Krenák ist relativ einfach und damit typisch für die Sprachen des Macro-Jê Stammes. Sie lässt sich in der Formel (C1) (C2) V (C3) zusammenfassen (Pessoa 2012:148). C1 steht dabei für den Konsonanten im Onset, C2 als zweiter Konsonant in einem verzweigten Onset, V für den Vokal im Nukleus und C3 für den Konsonanten in der Koda. Gemäß den phonotaktischen Beschränkungen des Krenák sind folgende Konsonanten und Vokale zulässig:
- für C1 im einfachen Onset alle Konsonanten p, t, k, ʔ, b, d, ɡ, dʒ, tʃ, m, n, ɲ, ŋ, m̥, n̥, ɲ̊, ŋ̊, ʒ, ɾ, h, w, und j. Dabei tritt ɾ selten auf. Als einzelne Segmente kommen b, d, ɡ, dʒ nur bei nachfolgendem Nasalvokal vor. Folgt ein Oralvokal, sind es die Kontursegmente mb, nd, ŋɡ und ndʒ.
- für C1 als erstes Segment im komplexen Onset p, k, b, ɡ, m̥ und ŋ̊.
- für C2 als zweites Segment im komplexen Onset ɾ, w und j. Dabei treten w und j nur auf, wenn C1 mit p oder k besetzt ist.
- für V im Nukleus alle oralen und nasalen Vokale.
- für C3 in der Koda p, t, k und ʔ. Selten treten w und j auf. Nach nasalem Vokal im Nukleus folgen m, n, ɲ und ŋ, nach oralem die Kontursegmente bm, dn und ɡŋ (Pessoa 2012:146-157).
Insgesamt verfügt das Krenák über sechs Silbentypen, von denen (C1)VC3 im Krenák am häufigsten auftritt (Pessoa 2012:198). Es folgt eine tabellarische Übersicht aller Silbentypen:
Tabelle 5: Die Silbentypen des Krenák
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Pessoa (2012:146).
Der Wortakzent im Krenák ist fest und fällt bei einem frei stehenden Lexem systematisch auf die letzte Silbe. Dies ist typisch für Sprachen des Macro-Jê Stammes. Das Krenák verfügt über Lexeme mit ein, zwei oder drei Silben (Silva 1986:56). Dreisilbige Lexeme erhalten einen sekundären Wortakzent auf der ersten Silbe, wie folgendes Beispiel zeigt:
4.2.2 Morphosyntaktische Aspekte des Krenák
Die Flexionsmorphologie beschreibt die Abwandlung von Wortformen, sodass sie im Satz eine bestimmte Funktion ausdrücken können. Sie ist in den meisten Sprachen des Macro-Jê Stammes kaum ausgeprägt (Rodrigues 1999:180; Ribeiro 2006:424). Dies gilt auch für das Krenák. Friedrich Müller typologisiert „die Sprache der Botocuden“ als „isolirende Sprache mit einzelnen Ansätzen zur Agglutination“ (2004 [1888]:198). Im Krenák können viele grammatische Funktionen nur durch das Anfügen von Affixen sowie durch die Wortstellung ausgedrückt werden oder sind morphologisch gar nicht markiert. Das Nomen im Krenák kann z.B. weder nach den Kategorien Kasus oder Numerus dekliniert werden, noch weist es ein Genus auf (Pessoa 2012:214f.). Es folgt ein Beispiel, das das Fehlen der Kategorie Numerus bei Nomen im Krenák verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einige Verben des Krenák können nicht nach den Kategorien Person, Numerus und Tempus etc. konjugiert werden, sondern bleiben unverändert im Infinitiv (Seki 2004:133). Dennoch lässt sich z.B. das Tempus beim Verb durch Hinzufügen spezieller Marker etwa für das Futur [nɛʔ] ausdrücken. Solche Marker können auch den Kasus anzeigen, wie etwa [pə ~ mbə] den Dativ:
Am deutlichsten manifestiert sich die sonst insgesamt schwach ausgeprägte Flexionsmorphologie im Pronominalsystem des Krenák. Es umfasst eine Reihe von freien und gebundenen Pronomen. Ihre genaue Verwendung und Funktion ist noch nicht völlig geklärt (Pessoa 2012:223). Dies hängt auch mit der hohen Anzahl von Variationen einiger Pronomen zusammen (~).[45] Die folgende Übersicht stellt einen Entwurf zur Systematisierung des Pronominalsystems dar:
Tabelle 6: Das Pronominalsystem des Krenák (Entwurf)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Seki (2004:134), Pessoa (2012:223).
Die freien Pronominalformen können als Subjekte zusammen mit aktiven und deskriptiven Verben auftreten oder auch als Objekte fungieren, siehe Beispiele (6a-b). Außerdem können sie den Possessor ausdrücken, siehe Beispiel (4). Die gebundenen Formen können ebenfalls den Possessor ausdrücken, werden aber an das Possessum als Präfix angehängt. Eine besondere Rolle im Krenák spielt dabei die Klasse der unveräußerlichen Nomen. Sie können nie allein stehen, sondern benötigen zwangsläufig einen Possessor (Seki 2008:126). Nomen, die dieser Klasse angehören, bezeichnen z.B. Körperteile. Scheinbar wird aber auch bestimmten Verben solch eine gebundene Form vorangestellt, um innerhalb des Satzes die Kongruenz bezüglich der Kategorie Person zu wahren. Im Folgenden wird der Gebrauch dieser Nomen und Verben illustriert:
Die Stellung des Verbs am Satzende ist typisch für Macro-Jê Sprachen (Rodrigues 1999:187; Ribeiro 2006:424). Auch im Krenák steht das Verb an letzter Position (Seki 2004:139). Intransitiven Verben, also die, die nur ein Argument verlangen, folgen auf das Subjekt (SV). Transitive Verben, also die, die mehrere Argumente verlangen, stehen hinter dem Subjekt und dem Objekt (SOV). Das indirekte Objekt steht zwischen dem Subjekt und dem direkten Objekt, wie die Beispiele (6a-b) zeigen. Die Satzgliedstellungen (SV) und (SOV) werden nun veranschaulicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Postpositionen nehmen im Krenák u.a. auch Adverbien bzw. Attribute ein, siehe Beispiel (9b). Kasus-, Tempus- und Aspektmarker gehören ebenfalls dazu, siehe Beispiele (6a-b, 7b und 8a). Auch das Morphem zur Verneinung wird seinem Bezugswort (hier das Verb) stets nachgestellt:[47]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Auftreten von Nomen und deskriptiven Verben anstelle von Adjektiven ist eine Charakteristik der Macro-Jê Sprachen (Ribeiro 2006:424). Auch das Krenák besitzt keine Adjektive, sondern drückt deren Bedeutung durch Nomen und intransitive deskriptive Verben aus. Das „Adjektive“ im Krenák der gleichen Kategorie wie Verben angehören, wird an ihrer prädikativen Funktion im Satz deutlich:[48]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erste Hinweise für den Gebrauch von Nomen mit adjektivischer Bedeutung liefert z.B. das Wort /jun/, welches sowohl mit ‚Zahn‘ als auch mit ‚fein, spitz, anspitzen‘ übersetzt wird:[49]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5 Das Wörterbuch der Botokudensprache
In diesem Kapitel werden zunächst das Leben des Autors und der Entstehungskontext seines Werkes dargestellt. Dies geschieht unter der besonderen Berücksichtigung neu erschlossener Quellen. Dann wird untersucht, wie das Wörterbuch in der deutschen und brasilianischen Literatur rezipiert wurde. Es folgt eine metalexikographische Analyse mit speziellem Augenmerk auf den Umfang und die Struktur des Wörterverzeichnisses. Schließlich wird auf die Defizite des Wörterbuchs eingegangen.
5.1 Neue Forschungsergebnisse zum Autor und Entstehungskontext
Der Autor und der Entstehungskontext des Wörterbuchs lagen bisher völlig im Dunkeln. Die wenigen bekannten Informationen beschränkten sich auf Angaben aus dem Vorwort des Herausgebers und der Einleitung des Verfassers. Danach wurde das Wörterbuch von Bruno Rudolph, einem deutschen Apotheker geschrieben, der sich in der Kolonie Teófilo Otoni im Mucuri-Distrikt in Minas Gerais niedergelassen hatte (Seler 1909:IV). Seit der Veröffentlichung des Wörterbuchs im Jahre 1909 konnten diesen Informationen keine neuen Erkenntnisse hinzugefügt werden (vgl. Araújo 1992:37-41). In der vorliegenden Arbeit werden nun erstmals detaillierte Aussagen zum Leben und Wirken Bruno Rudolphs und zur Entstehung des Wörterbuchs getroffen. Dazu wurden neue, von der Forschung unbeachtete Quellen, wie Kirchenbücher, Passagierlisten, Nachlässe, Ortschroniken und Kongressakten erschlossen. Außerdem konnten nach eingehender genealogischer Forschung lebende Nachfahren Bruno Rudolphs in Brasilien ausgemacht und zum Lebenslauf ihres Urgroßvaters befragt werden.[50] Die gewonnenen Informationen sind von Bedeutung, da sie ein genaueres Verständnis des Wörterbuchs und damit der Botokudensprache ermöglichen. Die Ausführungen bilden einen originären Beitrag zur Geschichte der deutsch-brasilianischen Erforschung indigener Sprachen (vgl. Drude 2005).
5.1.1 Der Autor Bruno Rudolph
A autoria de uma obra pode, em certos casos, limitar-se a pormenor bibliográfico. Mas no caso de vocabulário tomado a gentio mal conhecido e quase extinto, de autenticidade difícil, portanto, de verificar-se, torna-se credencial indispensável a garantia das condições intelectuais e dos métodos experimentais do autor. (Maria de Lourdes de Paula Martins, in: Monteiro 1948:13)
Friedrich Albert Gustav Bruno Rudolph wird am 15.09.1844 als Sohn des Ökonomie-Amtmanns Gustav Albert Rudolph und Adelheid Rudolph (geb. Friedrich) in Paplitz bei Ziesar im Königreich Preußen geboren.[51] Er besucht das königliche Domgymnasium zu Magdeburg, studiert Pharmazie an der Universität Leipzig und erlangt im Jahre 1872/73 die Approbation zum Apotheker (Wiggert 1860:41; Blecher/Wiemers 2008:224; Hager 1874:143). Am 10.04.1877 heiratet er Bertha Sophie Louise Reuter.[52] Aus dieser Ehe gehen später die beiden Kinder Else und Lothar Rudolph hervor. Am 21.01.1885 verlässt Bruno Rudolph mit dem Dampfschiff Baumwall den Hamburger Hafen und erreicht 28 Tage darauf Rio de Janeiro.[53] Vier Monate später folgt ihm seine Frau Bertha mit weiteren Familienmitgliedern.[54] Die Motive der Auswanderung sind noch nicht bekannt. Bruno Rudolph verdient seinen Lebensunterhalt in Brasilien zunächst mit dem Sammeln seltener Pflanzen, die er an das botanische Museum der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin-Dahlem schickt (Fr.-W.-Univ. 1891:142; Urban 1917:268). Spätestens im Jahre 1891 hält er sich im Kolonisationsgebiet am Mucuri in Minas Gerais auf. Dort arbeitet er bei der Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas - E.F.B.M. am Bau der Eisenbahnlinie Caravelas – Araçuaí. Seine Aufgabe ist vermutlich die medizinische Versorgung der Arbeiter. Beim Vordringen der Eisenbahn in den Urwald trifft Bruno Rudolph erstmals auf die Botokuden, die er mit Nahrungsmitteln versorgt und gegen die Symptome der Malaria behandelt.[55] In diesem Zusammenhang dokumentiert er vermutlich auch die Sprache der Botokuden. Im Jahre 1899 erreicht die Eisenbahnlinie Teófilo Otoni, den Hauptort des Kolonisationsgebietes am Mucuri (Machado 2010:5). Dort lässt sich Bruno Rudolph mit seiner Familie nieder und vollendet im September des Jahres 1903 die Arbeit am Wörterbuch (Rudolph 1909:VIII).[56] Im Zentrum der Stadt eröffnet er eine Apotheke (Almanak Laemmert 1911:3118/3219). Die Bedeutung Rudolphs als Kolonist der jungen Urwaldsiedlung beschreibt Max Rothe:
[...]
[1] In dieser Arbeit wird, entsprechend ihres Untersuchungsgegenstandes, der Ausdruck Botokuden verwendet, mit dem die indigene Ethnie seit 1760 bezeichnet wird. Obwohl es sich dabei um eine unspezifische Fremdbezeichnung mit pejorativen Konnotationen handelt, findet sich dieser Ausdruck bis heute in der sprachwissenschaftlichen Literatur. Er dient dazu, auf jene historischen Indigenen zu referieren, die einst im Grenzgebiet der heutigen Bundesstaaten Minas Gerais, Espírito Santo und Bahia lebten und heute bis auf die Subgruppe der Krenák ausgestorben sind (vgl. dazu ausführlich Kapitel 3.1 „Namensgebung“, S. 12-16).
[2] Diese Datierung ist allerdings umstritten. Siehe dazu Melatti (2007:18f.).
[3] Dieser Versuch einer Periodisierung ist keinesfalls exhaustiv oder endgültig. Je nach Forschungsperspektive und Gewichtung der einzelnen Akteure kann man auch zu einer anderen Einteilung gelangen. Außerdem lassen sich die Phasen nicht immer klar voneinander trennen, sondern überlappen teilweise.
[4] Als Tapyʔyia‚ ‚Barbar, Fremder‘ (> Tapúya) bezeichneten die Tupí-sprachigen Ethnien der brasilianischen Küste ihre nicht Tupí-sprachigen Feinde. Dies betraf hauptsächlich die Bewohner des Landesinneren, wie z.B. die Botokuden, die sich nicht nur sprachlich sondern auch kulturell deutlich von den Tupí unterschieden (Ribeiro 2009:61). Die Missionare übernahmen diese Sichtweise. Sie hielten das Tupí für den Prototyp indigener Sprachen und würdigten alle anderen Sprachen als „anormal“ herab (Câmara Jr. 1965:99f.; Wright/Carneiro da Cunha 1999:335).
[5] Eine ausführliche und kommentierte Liste von Reisenden und Entdeckern, die Kontakt zu brasilianischen Indigenen hatten, bietet in chronologischer Reihenfolge John Hemming (1995:465-491).
[6] Das SIL ist eine glaubensbasierte Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in den USA. Ihr Ziel ist es u.a. Minderheitensprachen zu erforschen. Online unter: http://www.sil.org/about-sil [07.06.2013].
[7] Einen umfassenden Überblick zur Ausrottung der brasilianischen Indigenen bietet Hemming (1978; 1995). Speziell zur Vernichtung der Botokuden siehe Hemming (1995:351-448) und Langfur (2006).
[8] Betrachtet man die aktuellen Konflikte um indigenes Land, Rechte und Ressourcen, so hält der zerstörerische Einfluss auf indigene Ethnien und Sprachen noch immer an. Beispiele, die in letzter Zeit traurige Berühmtheit erlangten, sind die Auseinandersetzungen um das Reservat Raposa Serra do Sol und der Bau des drittgrößten Wasserkraftwerks der Welt, Belo Monte bei Altamira – Pará.
[9] Abweichend hiervon bezeichneten sich anlässlich des vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) im Jahre 2010 durchgeführten Zensus rund 818 000 Menschen selbst als Indigene (IBGE 2012:8).
[10] Abweichend hiervon gibt die Nationale Gesundheitsstiftung (FUNASA) die Zahl der Krenák im Jahre 2010 mit 350 Personen an (Ricardo/Ricardo 2011:12).
[11] Mehrere indigene brasilianische Sprachen wurden bereits durch diese Initiative dokumentiert und die Daten in digitalen Archiven gespeichert. Online unter: http://www.mpi.nl/dobes [07.06.2013].
[12] Vgl. auch den Abschnitt „Die erste Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen“ in Kapitel 2.2, S. 6.
[13] Die von mir zur besseren Lesbarkeit übersetzten Bedeutungen lauten im portugiesischen Original entsprechend ihrer Reihenfolge “habitantes das brenhas”, “malfeitor” und “aqueles que usam botoques de emburé (barriguda)”.
[14] Kapitanien (capitanias) waren territoriale Verwaltungseinheiten im frühkolonialen Brasilien. Private, oft adelige Kolonisationsunternehmer verpflichteten sich zu ihrer Besiedelung und Verteidigung (Bernecker et al. 2000:36-45).
[15] Vgl. Krenák: [ˈkɾẽn] ‘cabeça’ (Pessoa 2012:111/127).
[16] Nicht verwechseln darf man diese Botokuden mit drei früher ebenfalls so bezeichneten indigenen Ethnien: den Xokléng (Laklãnõ) aus dem Bundesstaat Santa Catarina, den Kaingáng (Kanhgág) aus den Bundesstaaten Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina und São Paulo (beide gehören zur Sprachfamilie Jê) und den Xetá aus dem Bundesstaat Paraná, die der Sprachfamilie Tupí-Guaraní angehören.
[17] Im mündlichen Sprachgebrauch war hingegen die pejorative Fremdbezeichnung Bugre (frz. bougre ‘personne méprisable ou misérable’) gebräuchlich (Ehrenreich 1887:5).
[18] Dort heißt es in Kapitel CXIX/Parenthesis: “Não se comprehende que um botocudo fure o beiço para enfeital-o com um pedaço de páu. Esta reflexão é de um joalheiro” (Assis 1881:313).
[19] Nimuendajú erläutert die Bezeichnungen folgender Subgruppen: “Nak-pie ‘land of labor’, Nak-tuñ ‘land of the ant-hill’, Nak-rehé ‘beautiful land’, Ñgut-krak ‘tortoise rock’, Minyã-yirúgn ‘white water’” (1946:97).
[20] Wied erwähnt z.B. die „Bande des Capitam Jeparack “ (2001 [1821]:74/45). Die Portugiesen bezeichneten die Anführer der Subgruppen der Botokuden als capitão ‚Kapitän, Hauptmann‘. Im Anhang 2, S. A6, ist u.a. ein von Walter Garbe im Jahre 1909 am Rio Pancas und Doce aufgenommenes Foto des Capitão Muin abgebildet.
[21] Vgl. [ˈn̥ak] ‘terra’, [ˈɲĩŋ] ‘nós (inclusivo)’, [ˈnuk] ‘não, NEG’ (Pessoa 2012:117/199/121) und [n̥ãŋ-iuk] ‘3SG-tem/BEN/POSS’ (Pessoa 2012:229). Vgl. auch die Schreibweisen Nimuendajús „Naknyanúk“ (1946:97), Rudolphs „Nak nian nuk“ (1909:5/30) und Loukotkas „Nakyananiuk“ (1968:71).
[22] Siehe dazu die Karten „Verbreitungsgebiet der Botokuden“ im Anhang 1.1-1.3, S. A1-A3.
[23] Ausführliche Informationen zum Autor und dem Entstehungskontext des Wörterbuchs in Kapitel 5.1, S. 31.
[24] Angaben zur aktuellen Bevölkerungs- und Sprecherzahl der Krenák wurden in Kapitel 2.3, S. 10f., gemacht. Ausführliche Informationen zur Lebensweise der Krenák vom Anfang des 20. Jahrhunderts bietet Manizer (1919).
[25] Nach einem Versuch des Indianerschutzdienstes (Serviço de Proteção aos Índios – SPI) die Gutkrák sesshaft zu machen, kam es innerhalb der Subgruppe zu einem Konflikt zwischen Gegnern und Befürwortern dieses Vorhabens. Dies führte dazu, dass sich die Gruppe der Gegner unter der Führung von Capitão Krenák von den Gutkrák lossagte, sie bekämpfte und zurück in die Wälder floh (Estigarribia 1934).
[26] Einen Überblick zur gewaltsamen Verfolgung und Unterdrückung der Krenák sowie eine Beschreibung ihrer Lebenssituation in der zweiten Hälfte des 20. Jh. bieten Marcato (1979), Soares (1992) und Paraiso (1992). Die Auswirkungen der Repression und Akkulturation auf die Sprache der Krenák erläutert Seki (1984; 1985; 2000c).
[27] Mehr zur Aldeia Krenák unter: http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/3736 [07.06.2013].
[28] Das Verbreitungsgebiet der Botokuden ist auf den Karten im Anhang 1.1-1.3, S. A1-A3, abgebildet.
[29] Die Krone hatte die Region zu einer verbotenen Pufferzone erklärt, um den Gold- und Diamantenschmuggel aus dem Minendistrikt nach Osten an die Küste zu verhindern. Erst mit dem Ende des „Zyklus des Goldes“ begannen von 1760 bis 1820 die gewaltsamen Vorstöße in das Botokuden-Territorium (Langfur 2002; 2006).
[30] Wohl in einer Art Initiationsritual bekamen sieben- bis achtjährige Kinder zunächst die Ohrscheiben eingesetzt. Das Durchstechen der Unterlippe erfolgte später. Die Prozedur wurde gemäß den überlieferten Anweisungen ihres höchsten übernatürlichen Wesens, Marét-Khamaknian, durchgeführt (Wied 2001 [1821]:5-9; Paraiso 1992:424). Ein von Walter Garbe 1909 aufgenommenes Foto zeigt im Anhang 2, S. A6, Botokuden-Mädchen mit botoques.
[31] Ein Foto Walter Garbes im Anhang 2, S. A6, zeigt die Botokuden vom Rio Pancas und Rio Doce bei der Jagd.
[32] Ehrenreich liefert die Abbildung einer „Urwaldhütte der Nāk-erehä“ (1887:23) und Seki die Abbildung eines Unterstandes aus den Manuskripten Manizers (2004:148).
[33] Ein Foto einer Botokudin, die ihr Kind auf diese Weise trägt, findet sich im Anhang 2, S. A6.
[34] Nimuendajú gibt für diese oberste Gottheit weitere Bezeichnungen an, wie Borúñ makniám ‘Old Indian’, Yekán kren-yirugn ‘Father White-Head’ oder Borúñ yipakyúe ‘the Great Indian’ (1946:105).
[35] Die Abbildung eines solchen Totempfahls der Botokuden findet sich in Viveiros de Castro (1986:92).
[36] Pessoa (2012) hat gezeigt, wie diese historischen Quellen nutzbar gemacht werden können und beim Verständnis der stark vom Aussterben bedrohten Sprache helfen.
[37] Siehe dazu auch Kapitel 2.2, S. 6.
[38] Manizers Werk ist zu großen Teilen noch unveröffentlicht. Seine Manuskripte lagern in der Kunstkammer Sankt Petersburg. Die hier angegebenen Informationen sind Pessoa (2012), Seki (2008) und Sebestyén (1981) entnommen.
[39] Auch Nimuendajús Werk ist überwiegend noch unveröffentlicht. Seine Manuskripte lagern im Museu Nacional in Rio de Janeiro. Die hier angegebenen Informationen sind Seki (2008) und Nimuendajú (1946) entnommen.
[40] Weitere wichtige Bibliographien zur Botokudensprache sind Fabre (2005), D'Angelis et al. (2002), Welch (1987), Baldus (1954/68), Valle Cabral (1881) und Mattos/Resende (o.J.).
[41] Die Ermittlung von genetischen Verwandtschaftsbeziehungen, die Einteilung von Sprachen in Sprachfamilien und die Rekonstruktion von Ursprachen ist das Ziel der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Ihre Methoden werden in Joseph/Janda (2003) umfassend erläutert. Speziell zur historisch-vergleichenden Forschung unter indigenen brasilianischen Sprachen siehe Urban (1992) und Moore/Storto (2002).
[42] Einen Überblick zur Zusammensetzung des Sprachstammes Macro-Jê und die geographische Verteilung der Sprachfamilien geben die Tabelle und die Karte im Anhang 1.4, S. A4.
[43] Alle Daten zum Krenák sind, sofern nicht anders angegeben, Pessoa (2012) entnommen.
[44] Die Daten für das Beispiel (5) sind Rudolph (1909) und Seki (2004) entnommen.
[45] Siehe auch die Ausführungen Loukotkas zum komplexen Pronominalsystem. Er vergleicht eine Reihe von Quellen zur Botokudensprache und kommt dann zu dem Schluss: “Un vrai chaos règne dans le domaine des pronoms personnels et possessifs figurant dans les dits matériaux” (1955:122).
[46] Die Beispiele (9a-b) sind Seki (2004:137) entnommen.
[47] Das Beispiel (10a) ist Silva (1986:63) entnommen.
[48] Die Beispiele (11a-b) sind Seki (2004:136) entnommen.
[49] Die Daten aus Beispiel (12a) sind Seki (2000c:367; 2002:21) und Silva (1986:83) entnommen. Die Daten aus (12b) stammen aus Rudolph (1909:15/45). Vgl. auch das Swadesh test item Nr. 43 tooth im Anhang 5, S. A78.
[50] In dieser Arbeit wird eine Auswahl der wichtigsten neuen Erkenntnisse zum Leben und Wirken Bruno Rudolphs vorgestellt. Eine Publikation, die sich speziell diesem Thema widmet, befindet sich in Vorbereitung.
[51] Quelle: Auszug aus dem Taufregister der evangelischen Kirchengemeinde Paplitz, Jahrgang 1844, Nr. 18.
[52] Quelle: Kopie aus dem Kopulationsregister der Stadt Grabow (Meckl.), 1877, Nr. 6. Aus diesem Dokument stammt auch die Signatur Bruno Rudolphs, die im Anhang 3.2, S. A7, abgebildet ist.
[53] Quelle: Staatsarchiv Hamburg. Hamburger Passagierlisten, 1850-1934, Band: 373-7 I, VIII A 3 Band 002; S. 25. Ursprüngliche Daten: Staatsarchiv Hamburg, Bestand: 373-7 I, VIII (Auswanderungsamt I). Mikrofilmrollen K 1701 – K 2008, S 17363 - S 17383, 13116 - 13183.
[54] Quelle: Staatsarchiv Hamburg; Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 054 D; S. 658; Mikrofilmnummer; K 1733. Ursprüngliche Daten: Staatsarchiv Hamburg, Bestand: 373-7 I, VIII (Auswanderungsamt I). Mikrofilmrollen K 1701 - K 2008, S 17363 - S 17383, 13116 - 13183.
[55] Mündliche Mitteilung durch Eduardo Vieira Rudolph, dem Urenkel von Bruno Rudolph, am 28.10.2012.
[56] Die Lage der Stadt Teófilo Otoni im Kolonisationsgebiet am Fluss Mucuri verdeutlicht die Karte im Anhang 1.5, S. A5.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Botokuden?
Die Botokuden (Borum) waren eine indigene Ethnie in Brasilien, deren Sprache zur Macro-Jê-Familie gehört und die heute fast ausgestorben ist.
Was ist das "Wörterbuch der Botokudensprache"?
Es ist die umfassendste Quelle dieser Sprache, verfasst vom deutschen Auswanderer Bruno Rudolph um 1900, allerdings in einer linguistisch mangelhaften Form.
Was bedeutet "Restitution" in der Sprachwissenschaft?
Restitution bezeichnet die methodische Wiederherstellung der korrekten phonetischen und phonologischen Form einer Sprache aus fehlerhaft oder laienhaft dokumentierten Quellen.
Warum wird Swadesh’s "basic vocabulary" verwendet?
Die Swadesh-Liste enthält universelle Begriffe (wie "Wasser", "Auge"), die sich gut für den Sprachvergleich und die Rekonstruktion eignen, da sie weniger anfällig für Lehnwörter sind.
Welche Rolle spielt die Sprache Krenák?
Krenák ist die einzige modern erforschte Sprache einer überlebenden Botokuden-Subgruppe und dient als wichtiges Kontrollvokabular für die Restitution.
Was sind die Defizite des Rudolph’schen Wörterbuchs?
Die Defizite liegen vor allem in einer inkonsistenten Graphie, mangelhaften morphologischen Segmentierung und ungenauen semantischen Übersetzungen.
Details
- Titel
- Grundlagen für die Restitution von Swadesh’s "basic vocabulary" im "Wörterbuch der Botokudensprache"
- Hochschule
- Universität zu Köln (Romanisches Seminar der Philosophischen Fakultät)
- Veranstaltung
- -
- Note
- 1,0 (sehr gut)
- Autor
- Matthias Nitsch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 261
- Katalognummer
- V233225
- ISBN (Buch)
- 9783656495796
- ISBN (eBook)
- 9783656495901
- Dateigröße
- 10480 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Auszüge aus den Gutachten der Professoren: "In einem Wort: Die vorliegende Schrift stellt eine in doppelter Hinsicht gewichtige Arbeit dar." "Der Verfasser schafft in denkbar umfassender und sorgfältiger Weise die materiellen Grundlagen für eine linguistische Rekonstruktion der Sprache der Botokuden, einer in Südostbrasilien beheimateten indigenen Ethnie." "Besonders beeindruckt haben mich...: die kritische Analyse des untersuchten Wörterbuchs der Botokudensprache, was mit bemerkenswerten metalexikographischen Reflexionen einhergeht..." "Note sehr gut (1,0)"
- Schlagworte
- Wörterbuch der Botokudensprache Botokuden Restitution Swadesh Macro-Jê Krenak Indigene Sprachen Brasilien Bruno Rudolph dicionário botocudos línguas indígenas Borum
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Matthias Nitsch (Autor:in), 2013, Grundlagen für die Restitution von Swadesh’s "basic vocabulary" im "Wörterbuch der Botokudensprache", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/233225
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-