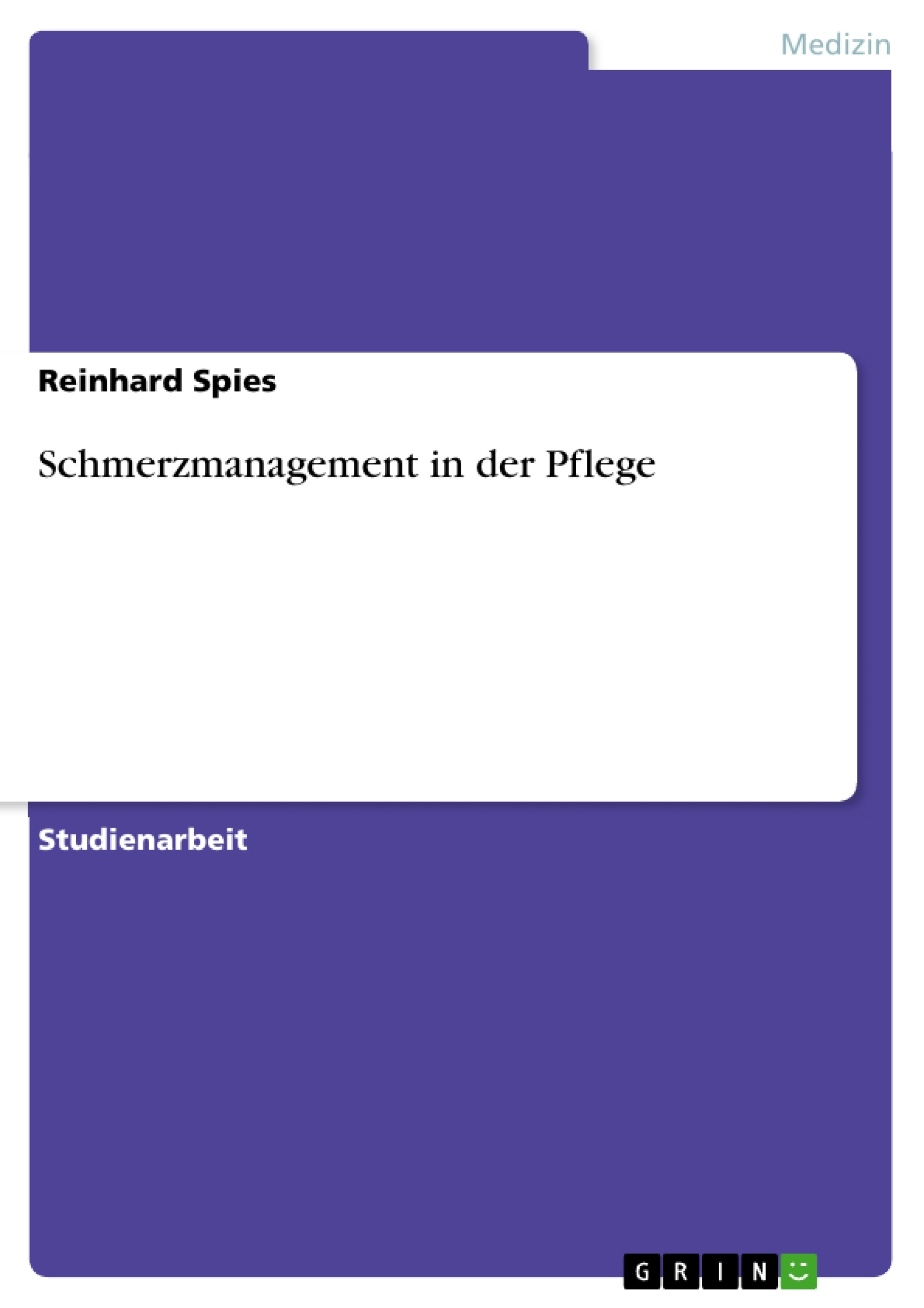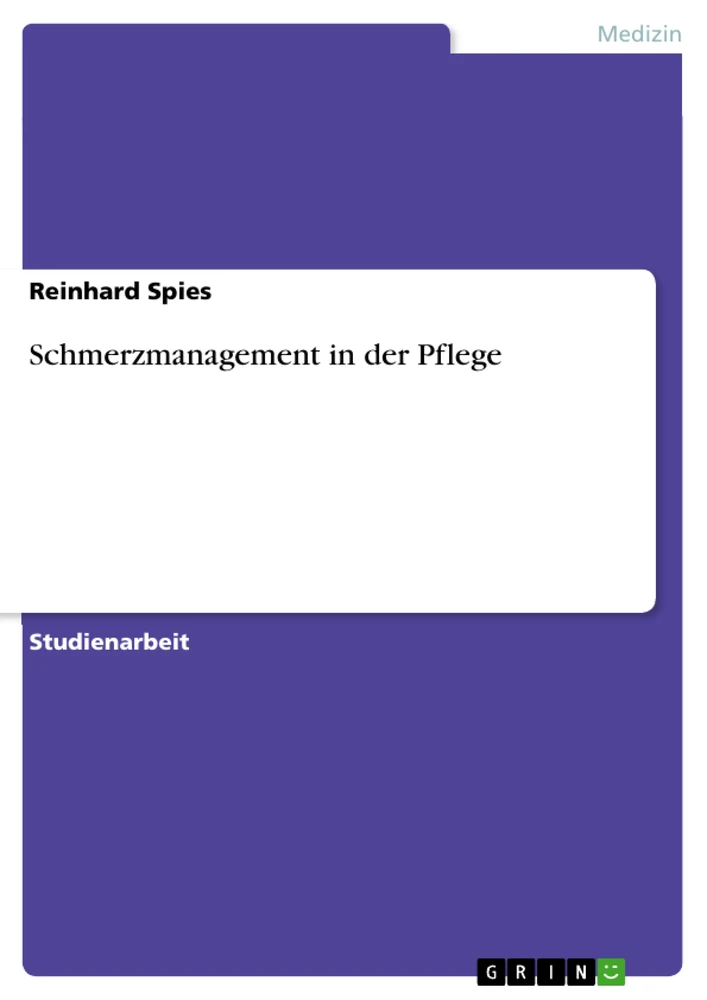
Schmerzmanagement in der Pflege
Studienarbeit, 2012
37 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hintergrund der Studie
- 2 Schmerz und Schmerzmanagement in der Pflege
- 3 Studie zur Zufriedenheit mit dem Schmerzmanagement
- 3.1 Entwicklung der Hypothesen und Festlegung des Studiendesigns
- 3.2 Entwicklung und Erstellung des Fragebogens
- 3.3 Durchführung der Studie
- 4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
- 5 Ergebnisinterpretation und Beantwortung der Hypothesen
- 6 Fazit und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie befasst sich mit der Zufriedenheit von Pflegebedürftigen mit dem Schmerzmanagement in der Pflege. Ziel ist es, die Erfahrungen und Perspektiven von Menschen mit chronischen Schmerzen in Bezug auf die Schmerztherapie und -behandlung in der Pflegeeinrichtung zu erforschen.
- Zufriedenheit mit dem Schmerzmanagement in der Pflege
- Erfahrungen mit chronischen Schmerzen und deren Behandlung
- Faktoren, die die Zufriedenheit mit dem Schmerzmanagement beeinflussen
- Verbesserungsvorschläge für die Schmerztherapie in der Pflege
- Hypothesenentwicklung und -prüfung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Hintergrund der Studie beleuchtet die Relevanz des Themas Schmerzmanagement in der Pflege und skizziert die wissenschaftliche Grundlage der Untersuchung.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel geht auf den Begriff Schmerz und die Bedeutung von Schmerzmanagement in der Pflege ein. Es erläutert die Herausforderungen und Besonderheiten der Schmerzbehandlung in der Pflegepraxis.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der Studie, die Entwicklung der Hypothesen und des Studiendesigns, die Konstruktion des Fragebogens und die Rekrutierung der Studienteilnehmer.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie dargestellt und analysiert. Die Ergebnisse werden mit Grafiken und Tabellen visualisiert und interpretiert.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Studie und beantwortet die im Vorfeld formulierten Hypothesen.
Schlüsselwörter
Schmerzmanagement, Pflege, Zufriedenheit, chronische Schmerzen, Schmerztherapie, Pflegebedürftige, Fragebogen, empirische Studie, Ergebnisinterpretation, Hypothesenprüfung
Details
- Titel
- Schmerzmanagement in der Pflege
- Hochschule
- Hamburger Fern-Hochschule
- Note
- 2,0
- Autor
- Reinhard Spies (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V233571
- ISBN (eBook)
- 9783656505518
- ISBN (Buch)
- 9783656507253
- Dateigröße
- 741 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- schmerzmanagement pflege
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Reinhard Spies (Autor:in), 2012, Schmerzmanagement in der Pflege, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/233571
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-