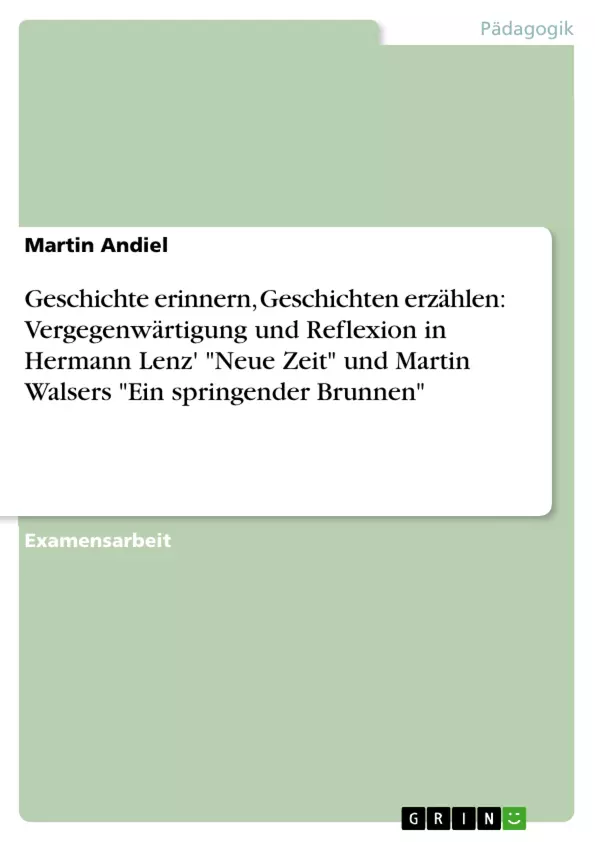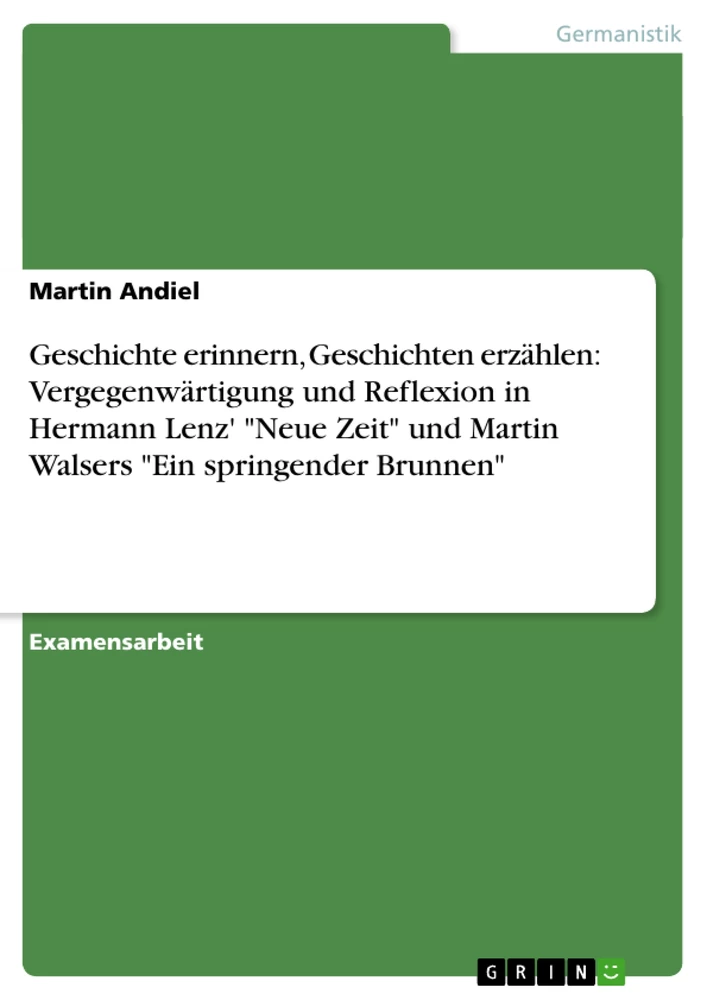
Geschichte erinnern, Geschichten erzählen: Vergegenwärtigung und Reflexion in Hermann Lenz' "Neue Zeit" und Martin Walsers "Ein springender Brunnen"
Examensarbeit, 2003
105 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnern und Vergessen
- „Kulturelles Gedächtnis“
- Israel – „Wenn dich morgen dein Sohn fragt…“
- Katastrophen des Vergessens
- Ertrag: Erinnerung
- Poetik des realistischen Romans
- „…sagen, wie es wirklich ist“ – Bedingungen und Gefahren: Adorno
- Kategorien der Erzählsituation: Gérard Genette
- Modus
- Stimme
- „Fabeln von der Zeit“: Paul Ricoeur
- Mimesis
- Spiele mit der Zeit I
- Spiele mit der Zeit II
- Ertrag: Roman
- Hermann Lenz: „Neue Zeit“
- „Neue Zeit“
- Kontext: Der „Eugen Rapp“-Zyklus
- Passive Distanz zur Zeit: „ohnmächtig sein und gelähmt bleiben“
- Aktive Distanz zur Zeit: „Ich schieß doch auf keinen Verwundeten.“
- Poetik
- Erzählperspektive und Sprechsituation
- Selbstvergewisserung
- Sich dehnende Gegenwart
- Interpretation
- Fokussierung des Schreckens
- Eugen Rapp als Resonanzraum von Geschichte
- Zusammenfassung
- Martin Walser: „Ein springender Brunnen“
- „Ein springender Brunnen“
- Kontext: Ein exzeptionelles Werk
- Die Paradoxie des interessenlosen Interesses an der Vergangenheit
- Landschaft, Geschichte, Sprache
- Poetik
- Präferenz des Erlebens
- Sprache und Sprachkritik
- Interne Fokalisierung
- Interpretation
- Bruchloses Erleben
- Irritationsresistenz
- Resonanzverweigerung
- Zusammenfassung
- Schluss - „Erinnerungsroman“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Geschichte im Roman, insbesondere die Frage, wie historische Ereignisse in literarische Erzählungen Eingang finden und verarbeitet werden. Der Fokus liegt auf der Rolle von Erinnerung und Vergessen in der Konstruktion fiktionaler Welten, die sich auf jüngere Vergangenheit beziehen. Die Arbeit analysiert zwei Romane – Hermann Lenz' „Neue Zeit“ und Martin Walsers „Ein springender Brunnen“ – um diese Thematik anhand konkreter Beispiele zu beleuchten.
- Die Darstellung von Geschichte im Roman
- Die Rolle von Erinnerung und Vergessen in der Literatur
- Vergleichende Analyse zweier Romane zur Thematik der Erinnerung
- Die Beziehung zwischen individueller und kollektiver Erinnerung
- Die Poetik des realistischen Romans im Kontext der Geschichtsdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Wie wird Geschichte in literarische Erzählungen integriert? Sie beleuchtet die Bedeutung von Erinnerung und deren Rolle bei der Darstellung von Vergangenheit in fiktionalen Texten, besonders im Bezug auf jüngere Geschichte, die der Autor selbst miterlebt hat. Die Arbeit setzt sich mit dem Problem des fehlenden „großen deutschen Kriegs- und Nachkriegsepos“ auseinander, wie von W.G. Sebald beschrieben, und analysiert die Ursachen dieses Mangels im Kontext von Arbeitsbelastung, der Ausrichtung auf die Zukunft und dem Schweigen über die Vergangenheit.
Erinnern und Vergessen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte von Erinnerung und Vergessen, beginnend mit dem Konzept des „kulturellen Gedächtnisses“. Es analysiert die israelische Erfahrung im Umgang mit der Vergangenheit und die Gefahren des Vergessens von traumatischen Ereignissen. Der Abschnitt „Katastrophen des Vergessens“ beleuchtet die Folgen des kollektiven Vergessens und die Bedeutung individueller und kollektiver Erinnerungsprozesse. Abschließend fasst der Ertrag die wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels zusammen.
Poetik des realistischen Romans: Dieses Kapitel befasst sich mit der Poetik des realistischen Romans und seiner Fähigkeit, Geschichte darzustellen. Es untersucht die theoretischen Ansätze von Adorno, Genette (Modus und Stimme) und Ricoeur (Mimesis und Spiele mit der Zeit), um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Darstellung von Geschichte in diesem Genre zu analysieren. Die Erörterung von Erzählperspektiven, der Darstellung von Zeit und der Beziehung zwischen Fiktion und Realität bildet den Kern dieses Kapitels.
Hermann Lenz: „Neue Zeit“: Diese Kapitel analysiert Hermann Lenz’ Roman „Neue Zeit“ im Kontext des „Eugen Rapp“-Zyklus. Es untersucht die unterschiedlichen Formen der Distanz zur Vergangenheit, die von passiver Ohnmacht bis zu aktiver Abwendung reichen. Die Analyse der Erzählperspektive, der Selbstvergewisserung des Erzählers und der Darstellung einer sich dehnenden Gegenwart bilden den Schwerpunkt der Interpretation. Der Fokus liegt auf der Fokussierung des Schreckens und der Rolle Eugen Rapps als Resonanzraum von Geschichte.
Martin Walser: „Ein springender Brunnen“: Dieses Kapitel widmet sich Martin Walsers Roman „Ein springender Brunnen“. Es analysiert das Werk im Kontext seiner Besonderheit, der Paradoxie des scheinbar desinteressierten Interesses an der Vergangenheit und dem Verhältnis von Landschaft, Geschichte und Sprache. Die Interpretation fokussiert sich auf das bruchlose Erleben, die Irritationsresistenz der Figuren und die Verweigerung von Resonanz auf die Vergangenheit. Die Analyse der Erzähltechnik und Sprache spielt eine zentrale Rolle.
Schlüsselwörter
Erinnerung, Vergessen, Geschichte, Roman, Realismus, Erzählperspektive, Hermann Lenz, Martin Walser, „Neue Zeit“, „Ein springender Brunnen“, Kulturelles Gedächtnis, Traumatisierung, Zeitdarstellung, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Erinnerungsromanen (Lenz & Walser)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung von Geschichte und die Rolle von Erinnerung und Vergessen in zwei Romanen: Hermann Lenz' „Neue Zeit“ und Martin Walsers „Ein springender Brunnen“. Im Fokus steht, wie historische Ereignisse in literarische Erzählungen Eingang finden und verarbeitet werden, insbesondere im Kontext der jüngeren deutschen Vergangenheit.
Welche Romane werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse von Hermann Lenz' „Neue Zeit“ und Martin Walsers „Ein springender Brunnen“. Beide Romane werden vergleichend untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Darstellung von Geschichte und Erinnerung herauszuarbeiten.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf verschiedene theoretische Ansätze, darunter das Konzept des „kulturellen Gedächtnisses“, die Theorien von Adorno zur „Poetik des realistischen Romans“, Gérard Genettes Kategorien der Erzählsituation (Modus und Stimme) und Paul Ricoeurs Konzepte der Mimesis und der „Spiele mit der Zeit“.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Reihe von Themen, darunter die Darstellung von Geschichte im Roman, die Rolle von Erinnerung und Vergessen in der Literatur, der Vergleich der beiden Romane, die Beziehung zwischen individueller und kollektiver Erinnerung sowie die Poetik des realistischen Romans im Kontext der Geschichtsdarstellung. Es werden auch Aspekte der Traumatisierung und die Schwierigkeiten der Aufarbeitung der jüngeren deutschen Geschichte thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Erinnerung und Vergessen, ein Kapitel zur Poetik des realistischen Romans, Einzelkapitel zu den Romanen von Lenz und Walser sowie einen Schluss. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Es gibt außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Hermann Lenz' „Neue Zeit“?
Die Analyse von „Neue Zeit“ konzentriert sich auf die unterschiedlichen Formen der Distanz zur Vergangenheit, die von passiver Ohnmacht bis zu aktiver Abwendung reichen. Es werden die Erzählperspektive, die Selbstvergewisserung des Erzählers und die Darstellung einer sich dehnenden Gegenwart untersucht. Der Fokus liegt auf der Fokussierung des Schreckens und der Rolle Eugen Rapps als Resonanzraum von Geschichte.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Martin Walsers „Ein springender Brunnen“?
Die Analyse von „Ein springender Brunnen“ untersucht die Paradoxie des scheinbar desinteressierten Interesses an der Vergangenheit und das Verhältnis von Landschaft, Geschichte und Sprache. Die Interpretation fokussiert sich auf das bruchlose Erleben, die Irritationsresistenz der Figuren und die Verweigerung von Resonanz auf die Vergangenheit. Die Analyse der Erzähltechnik und Sprache spielt eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit charakterisieren, sind: Erinnerung, Vergessen, Geschichte, Roman, Realismus, Erzählperspektive, Hermann Lenz, Martin Walser, „Neue Zeit“, „Ein springender Brunnen“, kulturelles Gedächtnis, Traumatisierung, Zeitdarstellung, Identität.
Details
- Titel
- Geschichte erinnern, Geschichten erzählen: Vergegenwärtigung und Reflexion in Hermann Lenz' "Neue Zeit" und Martin Walsers "Ein springender Brunnen"
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Neuere deutsche Literatur)
- Note
- 1,0
- Autor
- Martin Andiel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 105
- Katalognummer
- V24761
- ISBN (eBook)
- 9783638275569
- Dateigröße
- 859 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Sprache Realismus Subjektivität Innerlichkeit Geschichte Erinnerung Gedächtnis Vergessen Hermeneutik Narratologie Erzähltheorie Modus Stimme Mimesis Konfiguration Refiguration 'Pro
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Martin Andiel (Autor:in), 2003, Geschichte erinnern, Geschichten erzählen: Vergegenwärtigung und Reflexion in Hermann Lenz' "Neue Zeit" und Martin Walsers "Ein springender Brunnen", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/24761
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-