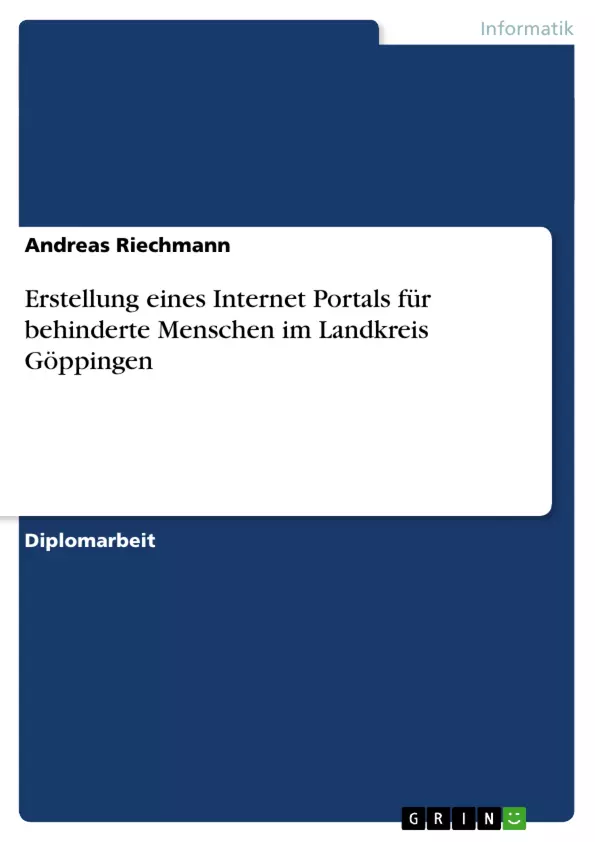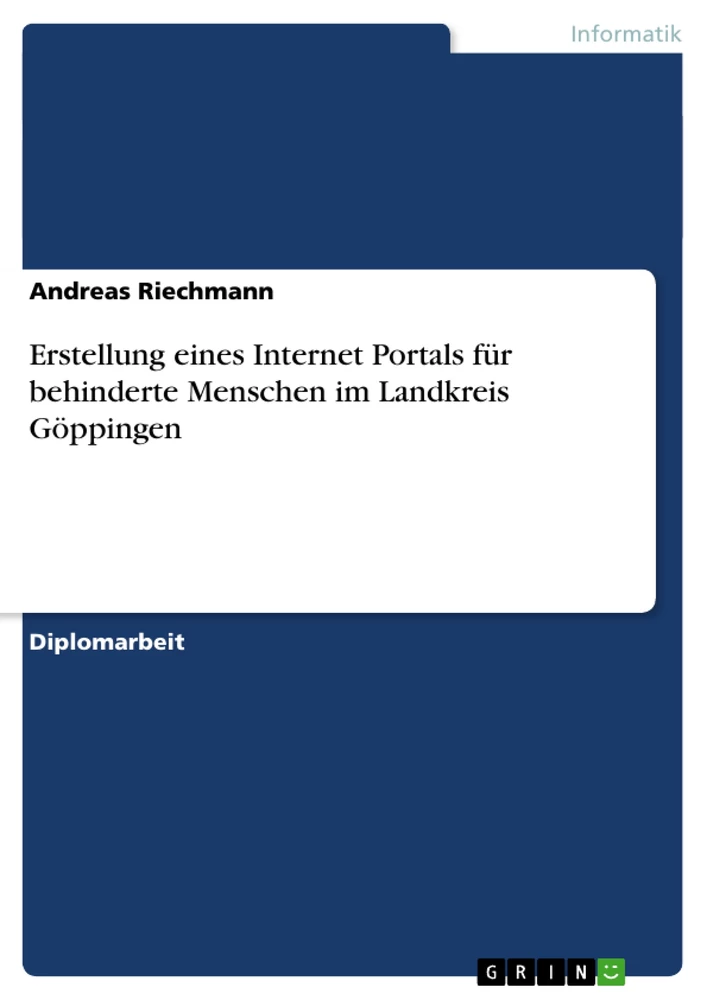
Erstellung eines Internet Portals für behinderte Menschen im Landkreis Göppingen
Diplomarbeit, 2004
137 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung und Auftrag
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Grundlegende Anforderungen zur Erstellung eines Portals
- 2.1 allgemeine Anforderungen an ein Internet Portal
- 2.1.1 Übersichtlich
- 2.1.2 Verständlich
- 2.1.3 Inhalte
- 2.1.4 Navigation
- 2.1.5 Suche
- 2.2 Anforderungen aus Sicht der Skalierbarkeit
- 2.2.1 Module
- 2.2.3 Sprache
- 2.3 Anforderungen an ein Portal aus Sicht der behinderten Menschen
- 2.3.1 Begriff der Behinderung
- 2.3.2 Behindertengleichstellungsgesetz
- 2.3.3 Barrierefreiheit
- 2.4 Anforderungen an den Homepagedienstanbieter
- 2.4.1 allgemeine Anforderungen
- 2.4.2 Technische Anforderungen
- 2.4.3 Rechtliche Anforderungen
- 2.5 Anforderungen durch den Seitenbetreiber
- 2.5.1 Content Management System
- 2.6 Anforderungen an ein Internet Portal für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Göppingen
- 3. Theoretischer Teil
- 3.1 Definition eines Projektes
- 3.2 Projektmanagement
- 3.3 allgemeine Phasenmodelle des Projektmanagements
- 3.3.1 das Wasserfall Modell
- 3.3.2 das Spiral Modell
- 3.3.3 das V-Modell
- 3.4 eigenes Phasenmodell
- 4. Gestaltung und Umsetzung anhand des eigenen Phasenmodells
- 4.1 Benutzeranforderung
- 4.1.1 Benutzer
- 4.1.2 Umfrage
- 4.1.3 Ergebnisse der Anforderungen an Benutzer
- 4.2 Webseitenanforderungen
- 4.2.1 Wahl des Providers
- 4.2.2 Ergebnisse der Anforderungen an die Webseite
- 4.3 Analyse
- 4.3.1 Ansatz
- 4.3.2 Betrachtung
- 4.3.3 Ergebnisse aus der Analyse
- 4.4 Design
- 4.4.1 Corporate Design
- 4.4.2 Design des Moduls: Adressen
- 4.4.3 Design des Moduls: Bildergalerie
- 4.4.4 Re-Design des Moduls: Forum
- 4.4.5 Design des Moduls: Freizeit
- 4.4.6 Design des Moduls: Gästebuch
- 4.4.7 RE-Design des Moduls: Hilfe
- 4.4.8 Design des Moduls: Impressum
- 4.4.9 Design des Moduls: Infocenter
- 4.4.10 Re-Design des Moduls: Kalender
- 4.4.11 Design des Moduls: Kontakt
- 4.4.12 Design des Moduls: Links
- 4.4.13 Design des Moduls: Rechtsprechung
- 4.4.14 Design des Moduls: behindertengerechter Stadtplan
- 4.4.15 Re-Design des Moduls: Suche
- 4.4.15 Design des Moduls: Portal
- 4.4.16 Design weiterer Module
- 4.4.17 Design des Content Management Systems
- 4.4.18 Ergebnisse aus dem Design
- 4.5 Programmierung
- 4.5.1 KCMS
- 4.5.2 Module
- 4.6 Austesten und Hinzufügen des Inhaltes
- 4.7 Einführung der Webseite und Wartung
- 4.7.1 EJMB Abschlussveranstaltung
- 4.7.2 Suchmaschinen
- 4.7.3 Presse
- 5. Kritik und Weiterentwicklung
- 5.1 Module
- 5.2 KCMS
- 6. Fazit und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Erstellung eines Internetportals für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Göppingen. Die Zielsetzung ist es, ein barrierefreies und benutzerfreundliches Portal zu entwickeln, das Informationen, Hilfestellungen und Kommunikationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen bietet.
- Barrierefreie Informationstechnologie
- Benutzerfreundliches Design und Navigation
- Anforderungen an ein Internetportal für Menschen mit Behinderungen
- Projektmanagement und -umsetzung
- Content Management System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Auftrag der Diplomarbeit dar. Sie beschreibt auch die Vorgehensweise bei der Erstellung des Portals. Kapitel 2 behandelt die grundlegenden Anforderungen an ein Internetportal im Allgemeinen, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. Es werden die verschiedenen Anforderungen aus Sicht der Skalierbarkeit, Barrierefreiheit und des Seitenbetreibers betrachtet. Kapitel 3 beleuchtet den theoretischen Teil des Projektes, indem es Definitionen, Projektmanagementmethoden und Phasenmodelle beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Gestaltung und Umsetzung des Portals anhand des entwickelten Phasenmodells. Es beschreibt die Benutzeranforderungen, die Webseitenanforderungen, die Analyse der Anforderungen, das Design des Portals und die Programmierung. Auch die Einführung und Wartung des Portals werden in diesem Kapitel behandelt. Kapitel 5 befasst sich mit der Kritik und Weiterentwicklung des Portals, während Kapitel 6 ein Fazit und ein Schlusswort beinhaltet.
Schlüsselwörter
Barrierefreie Informationstechnik, Behindertengleichstellungsgesetz, Internetportal, Projektmanagement, Content Management System, Design, Programmierung, Benutzeranforderungen, Webseitenanforderungen, Analyse, Umsetzung, Einführung, Wartung, Kritik, Weiterentwicklung, Landkreis Göppingen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Internetportals für den Landkreis Göppingen?
Das Ziel ist die Erstellung eines barrierefreien Portals, das Menschen mit Sinnes- oder körperlichen Behinderungen den uneingeschränkten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen ermöglicht.
Welche gesetzlichen Grundlagen müssen beachtet werden?
Insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) gibt Rahmenbedingungen für die Barrierefreiheit in der Informationstechnik vor.
Was bedeutet Barrierefreiheit im Web-Kontext?
Barrierefreiheit bedeutet, dass Webseiten so programmiert sind, dass sie auch von Blinden (z. B. via Screenreader) oder motorisch eingeschränkten Menschen (ohne Maus) bedient werden können.
Welche Projektmanagement-Methoden wurden angewandt?
Die Arbeit beleuchtet das Wasserfall-Modell, das Spiral-Modell und das V-Modell, bevor ein eigenes Phasenmodell zur Umsetzung genutzt wird.
Welche Module bietet das Portal für behinderte Menschen?
Es umfasst Module wie einen behindertengerechten Stadtplan, Informationen zur Rechtsprechung, ein Forum, eine Adressdatenbank und einen Freizeitkalender.
Details
- Titel
- Erstellung eines Internet Portals für behinderte Menschen im Landkreis Göppingen
- Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen
- Note
- 1,0
- Autor
- Andreas Riechmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 137
- Katalognummer
- V25140
- ISBN (eBook)
- 9783638278560
- Dateigröße
- 9210 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Das praktische Ergebnis dieser Arbeit kann man auf http://www.kreisbehindertenportal-goeppingen.de eingesehen werden.
- Schlagworte
- Erstellung Internet Portals Menschen Landkreis Göppingen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Andreas Riechmann (Autor:in), 2004, Erstellung eines Internet Portals für behinderte Menschen im Landkreis Göppingen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/25140
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-