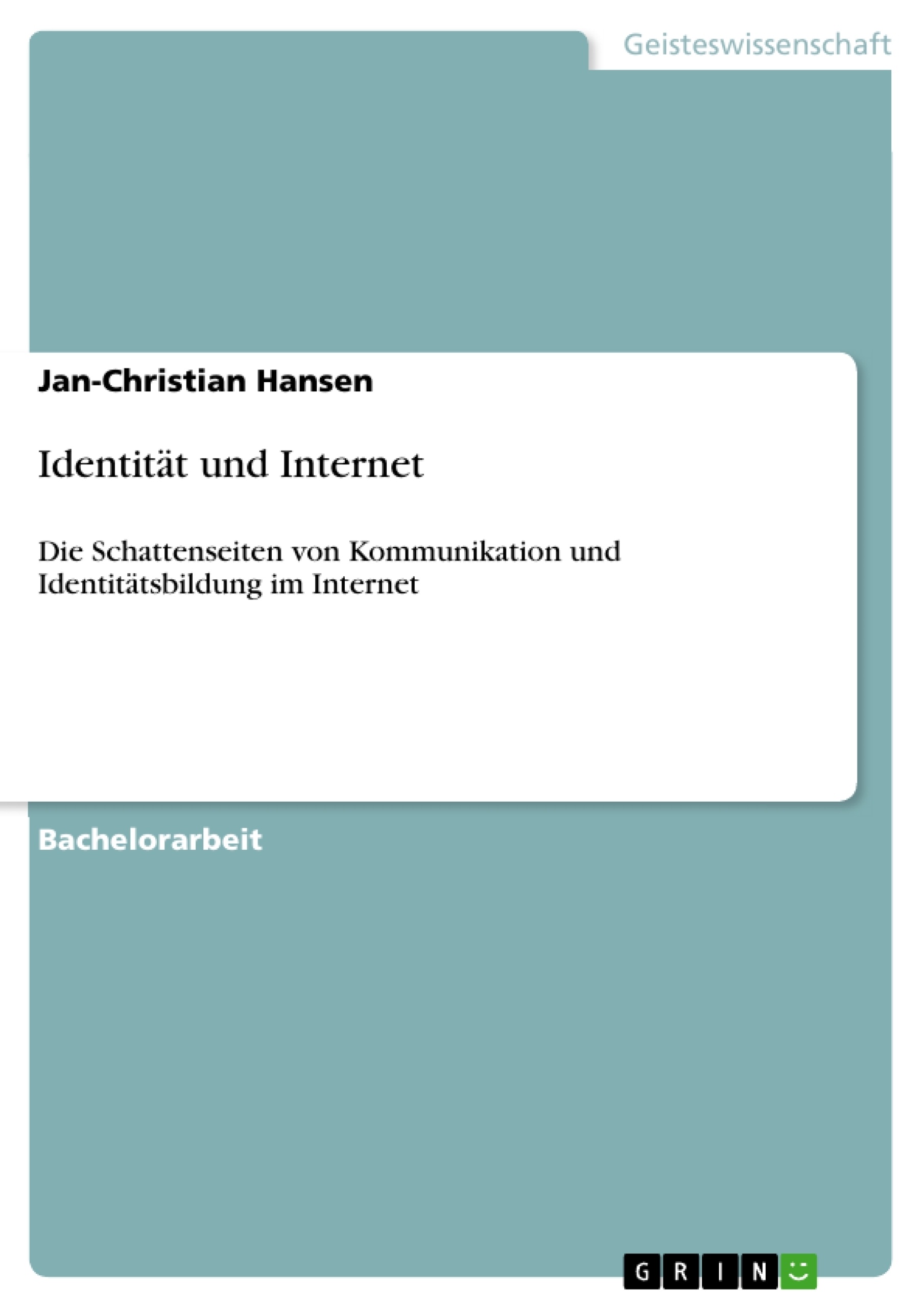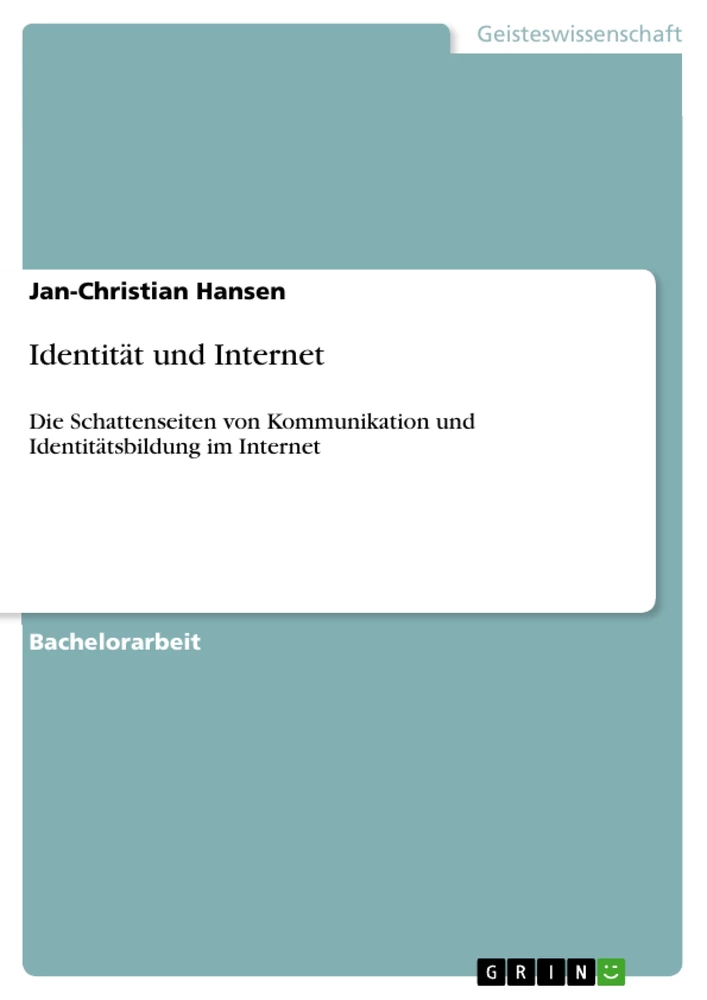
Identität und Internet
Bachelorarbeit, 2013
56 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die (Neu-)Erschaffung der kommunikativen Welt
- 1. Kommunikatives Handeln
- 1.1. Kommunikation vs. kommunikatives Handeln
- 1.2. Habermas Theorie des kommunikativen Handelns
- 1.2.1. Innen- und Außenwelt
- 1.2.2. Mythische Weltbilder
- 1.2.3. offene vs. geschlossene Weltbilder & Lebenswelten
- 1.2.4. Kritik & Anforderungen an das kommunikative Handlungsmodell
- 1.3. Der Wandel der Kommunikation und des kommunikativen Handelns durch das Internet
- 1.3.1. Aus »Face-to-face« wird »Font-to-font«
- 1.3.2. Kommunikation und kommunikatives Handeln offline vs. Kommunikation und kommunikatives Handeln online
- 2. Identität
- 2.1. Identität in Habermas Theorie des Handelns
- 2.2. Identität & Internet — die Folgen einer Nutzung des Internets als dominantes Kommunikationsmedium auf unsere Identitätsbildung
- 3. Das Internet
- 3.1. Wie Google, Facebook & Co. eine zweite Welt erschaffen
- 3.2. Von Vorurteilen, Irrtümern und falschen Denkansätzen
- 4. Ausblick
- 4.1. Identitätsarbeit durch Identitäts- und Internetkompetenz
- Schluss: Der Traum von einer kommunikativen Ideal-Welt
- Literatur / Zitate / Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die Entwicklung des Internets auf die menschliche Kommunikation und Identitätsbildung auswirkt. Sie analysiert die Auswirkungen des Internets auf den Menschen anhand der Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas.
- Kommunikatives Handeln im Vergleich zur normalen Kommunikation
- Die Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas
- Der Wandel der Kommunikation durch das Internet
- Identitätsbildung im Kontext von Internet und Kommunikation
- Die Rolle großer Internetkonzerne in der digitalen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und erläutert die Herausforderungen, die sich aus der digitalen Revolution für die menschliche Kommunikation und Identitätsbildung ergeben. Sie betont die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Internets auf den Menschen.
Kapitel 1 widmet sich dem kommunikativen Handeln und Habermas' Theorie diesbezüglich. Es grenzt kommunikatives Handeln von der normalen Kommunikation ab und analysiert die drei Welten, auf die sich kommunikatives Handeln bezieht: die objektive Welt, die soziale Welt und die subjektive Welt. Das Kapitel beleuchtet außerdem die Bedeutung von Rationalität, Wahrheit und Richtigkeit im kommunikativen Handeln und diskutiert die Kritik an Habermas' Modell.
Kapitel 2 untersucht die Rolle der Identität in Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns. Es beleuchtet die Entstehung von Identität in einer idealen Kommunikationsgemeinschaft und die Bedeutung von Autonomie und Selbstverwirklichung. Das Kapitel analysiert die Auswirkungen des Internets auf die Identitätsbildung und diskutiert die Folgen der Nutzung des Internets als dominantes Kommunikationsmedium.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Internet und seinen Auswirkungen auf die menschliche Kommunikation und Identitätsbildung. Es analysiert die Funktionsweise und das System der digitalen Welt, die von großen Internetkonzernen wie Google und Facebook dominiert wird. Das Kapitel beleuchtet kritisch die Rolle dieser Konzerne in der digitalen Welt und diskutiert die Vorurteile, Irrtümer und falschen Denkansätze, die im Zusammenhang mit dem Internet verbreitet sind.
Der Ausblick in Kapitel 4 skizziert die Herausforderungen, die sich aus der digitalen Revolution für die menschliche Kommunikation und Identitätsbildung ergeben. Es betont die Notwendigkeit einer neuen Theorie, die unsere Wirklichkeit, bestehend aus Off- und Online, hinreichend beschreibt. Das Kapitel plädiert für die Entwicklung von Identitäts- und Internetkompetenz, um die Chancen der digitalen Welt zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Kommunikative Handeln, die Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas, die Identität, die Identitätsbildung, das Internet, die digitale Welt, die Kommunikation, die Online- und Offline-Welt, große Internetkonzerne, Vorurteile, Irrtümer, falsche Denkansätze und die Entwicklung von Identitäts- und Internetkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert das Internet die menschliche Identitätsbildung?
Das Internet fungiert als dominantes Kommunikationsmedium, das durch die Verschiebung von „Face-to-face“ zu „Font-to-font“ neue Bedingungen für die Entwicklung des Selbst schafft.
Welche Rolle spielt Jürgen Habermas in dieser Untersuchung?
Die Arbeit nutzt Habermas’ „Theorie des kommunikativen Handelns“, um den Wandel der Lebenswelten und die Anforderungen an eine rationale Kommunikation im Netz zu analysieren.
Was ist der Unterschied zwischen Kommunikation und kommunikativem Handeln?
Kommunikatives Handeln zielt nach Habermas auf Verständigung und die Anerkennung von Geltungsansprüchen ab, während einfache Kommunikation auch rein instrumentell sein kann.
Wie erschaffen Google und Facebook eine „zweite Welt“?
Durch Algorithmen und soziale Netzwerke entstehen digitale Parallelwelten, die unsere Wahrnehmung der Realität und unsere sozialen Interaktionen massiv beeinflussen.
Was versteht man unter Internetkompetenz im Kontext der Identität?
Es bezeichnet die Fähigkeit, sich kritisch und autonom in der digitalen Welt zu bewegen, um die eigene Identität vor Manipulation und Suchteffekten zu schützen.
Details
- Titel
- Identität und Internet
- Untertitel
- Die Schattenseiten von Kommunikation und Identitätsbildung im Internet
- Hochschule
- Christian-Albrechts-Universität Kiel (Philosophisches Seminar)
- Note
- 2,3
- Autor
- B.A. Jan-Christian Hansen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V262664
- ISBN (eBook)
- 9783656523277
- ISBN (Buch)
- 9783656524045
- Dateigröße
- 925 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Note 2,3 resultiert aus der Tatsache heraus, dass die Bachelorarbeit zu wenig auf die Philosophie und mehr auf die Literaturwissenschaft und Soziologie abgestimmt ist. Mit einer Abgabe in Literaturwissenschaft oder Soziologie wäre die Note bestimmt besser gewesen.
- Schlagworte
- Habermas Kommunikatives Handeln Identität Internet Kommunikation Online Offline soziales Handeln Weltbilder Lebenswelt Kommunikationsarten Medien Google Facebook Internetkompetenz Soziologie Philosophie Weltanschauung Kommunikationswandel Kommunikationsgeschichte Innenwelt Außenwelt Identitätskompetenz Identitätswandel Kommunikationskultur Digitale Identität Mediengesellschaft Virtualität
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- B.A. Jan-Christian Hansen (Autor:in), 2013, Identität und Internet, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/262664
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-