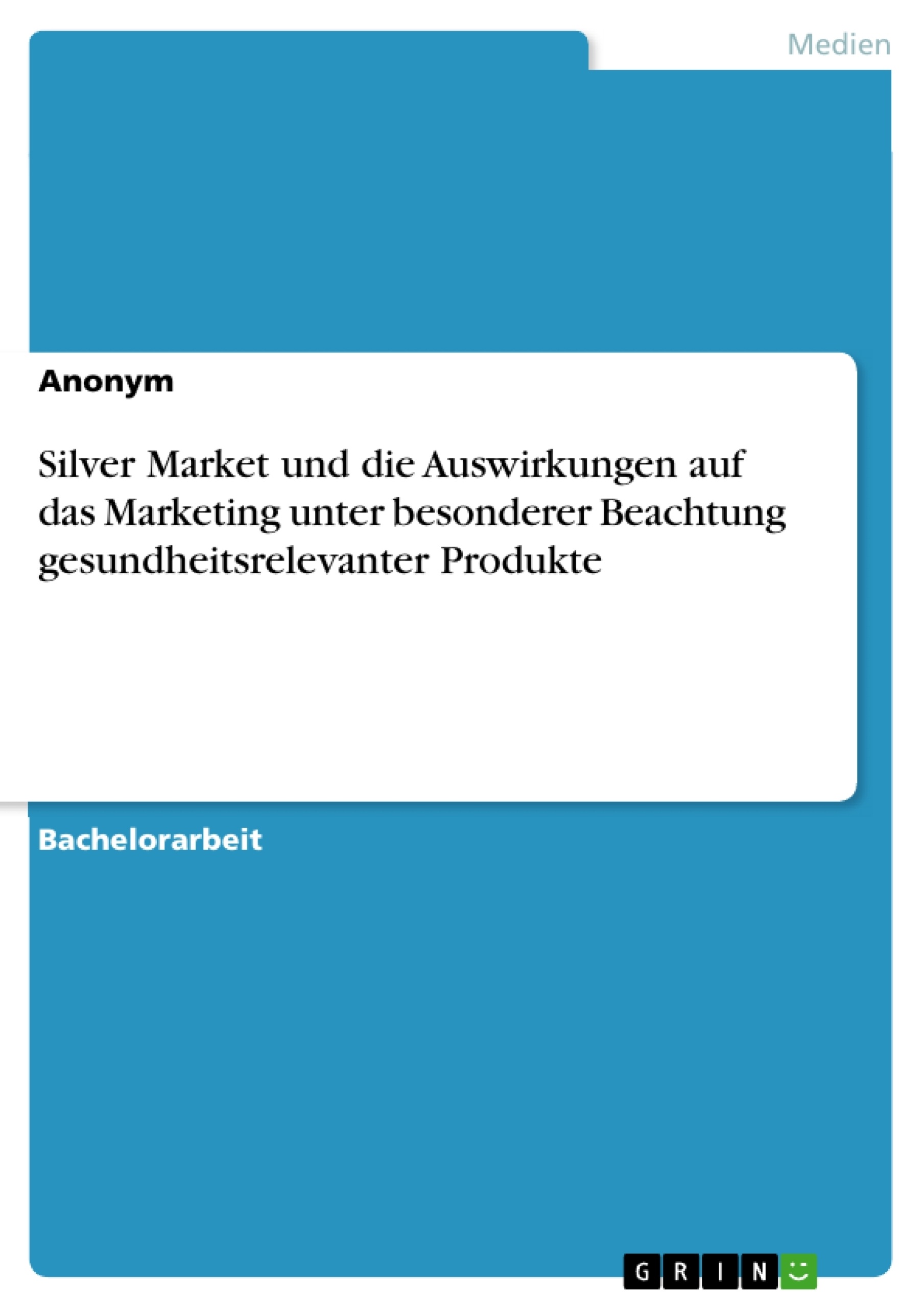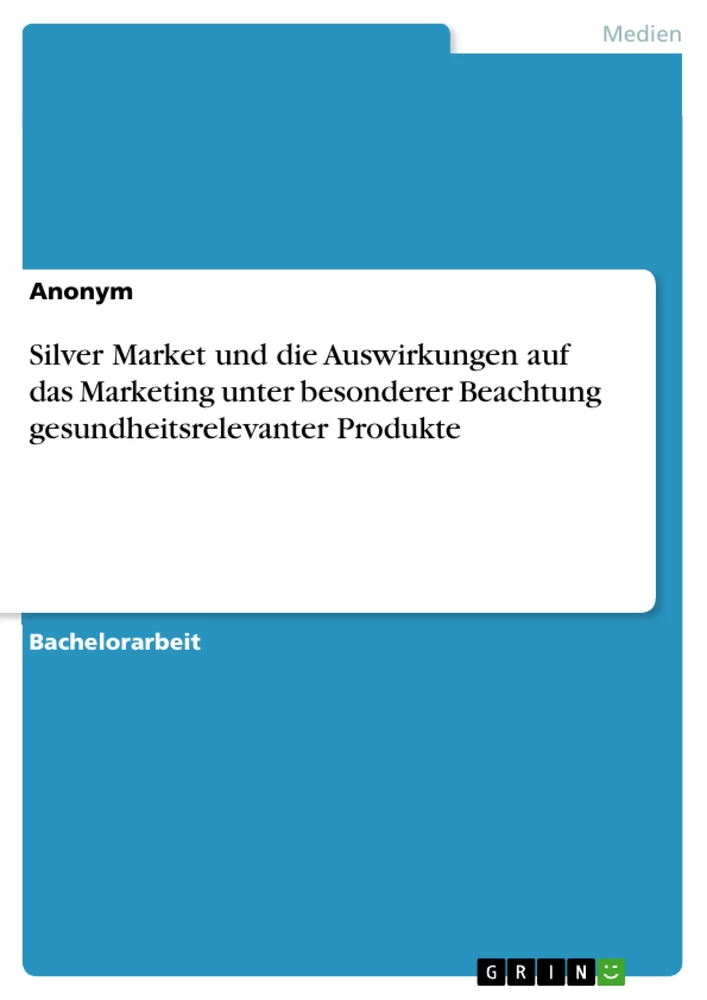
Silver Market und die Auswirkungen auf das Marketing unter besonderer Beachtung gesundheitsrelevanter Produkte
Bachelorarbeit, 2013
54 Seiten, Note: 1,7
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung und Architektur der Arbeit
- Demographischer Wandel in Deutschland
- Bevölkerungsentwicklung und -struktur
- Wertewandel
- Relevanz für das Marktgeschehen
- Der Silver Market und die Besonderheiten von Senioren
- Begrifflichkeiten Silver Market und Senioren
- Altersbedingte Veränderungen von Senioren
- Körperlich
- Kognitiv
- Ansätze zur Marktsegmentierung
- Alter
- Lebenstypologie
- Die Auswirkungen auf den Marketing-Mix im Silver Market
- Produktpolitik
- Kontrahierungspolitik
- Distributionspolitik
- Kommunikationspolitik
- Gesundheitsmärkte und daraus resultierende Produkte für Silver Ager
- Gesundheit und Alter
- Abgrenzung des Gesundheitsmarktes und gesundheitsrelevante Produkte
- Spiegelung des Marktes an altersrelevanten Branchen
- Indikatoren spezifischer Analyse gesundheitsrelevanter Produkte
- Erklärungsansätze zum Branchenwandel
- Schlussbetrachtung und Aussicht
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die wachsenden wirtschaftlichen Potenziale des „Silver Market", mit besonderem Augenmerk auf neu entstehende Gesundheitsmärkte und die daraus resultierenden Produkte. Die Arbeit analysiert den demographischen Wandel in Deutschland, beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse und Werte der alternden Gesellschaft und zeigt die Auswirkungen auf den Marketing-Mix auf.
- Demographischer Wandel in Deutschland und seine Folgen für den Markt
- Bedürfnisse und Werte der älteren Generation
- Marketing-Mix im Silver Market
- Entwicklung und Relevanz von Gesundheitsmärkten
- Analyse von gesundheitsrelevanten Produkten in verschiedenen Branchen
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem demographischen Wandel in Deutschland. Es werden die Bevölkerungsentwicklung, die Altersstruktur und der Wertewandel analysiert, um die wachsenden Potenziale des Seniorenmarktes zu verdeutlichen.
Kapitel 3 erläutert die Begrifflichkeiten „Silver Market" und „Senioren" und untersucht altersbedingte Veränderungen im kognitiven und physiologischen Bereich. Zudem werden Ansätze zur Marktsegmentierung vorgestellt, um die Heterogenität der älteren Generation zu berücksichtigen.
Kapitel 4 zieht aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse auf die Instrumente des Marketing-Mix. Die Produkt-, Kontrahierungs-, Kommunikations- und Distributionspolitik werden im Kontext des Silver Market betrachtet, um die spezifischen Bedürfnisse der älteren Generation zu adressieren.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den neuen Gesundheitsmärkten und -produkten, die im Zuge der alternden Gesellschaft und des wachsenden Gesundheitsbewusstseins entstehen. Es werden die Bereiche Kosmetik, Tourismus, Lebensmittel und Selbstmedikation genauer betrachtet und die Relevanz gesundheitsrelevanter Produkte für die ältere Generation analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Silver Market, den demographischen Wandel, die Bedürfnisse und Werte der älteren Generation, den Marketing-Mix im Kontext des Alterns, die Entwicklung von Gesundheitsmärkten, sowie die Analyse von gesundheitsrelevanten Produkten in verschiedenen Branchen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Silver Market"?
Der Silver Market bezeichnet den Markt für die alternde Gesellschaft (Senioren), die aufgrund des demographischen Wandels eine wachsende und kaufkräftige Zielgruppe darstellt.
Welche Auswirkungen hat das Altern auf das Marketing?
Unternehmen müssen ihren Marketing-Mix anpassen, da kognitive und physiologische Veränderungen der Senioren eine spezifische Produktgestaltung, Kommunikation und Distribution erfordern.
Warum ist der Gesundheitsmarkt für "Silver Ager" so wichtig?
Durch eine höhere Lebenserwartung und ein steigendes Gesundheitsbewusstsein entwickeln sich gesundheitsrelevante Produkte (z.B. in Tourismus, Kosmetik, Lebensmittel) zum wichtigsten Wachstumsfaktor.
Wie unterscheidet sich die heutige Seniorengeneration von früheren?
Die heutige Generation zeichnet sich durch ein wandelndes Bewusstsein, eine bessere finanzielle Situation und einen aktiveren Lebensstil aus, was neue Konsummuster schafft.
Welche Branchen profitieren besonders vom Silver Market?
Besonders die Bereiche Gesundheitstourismus, funktionale Lebensmittel, Selbstmedikation und altersgerechte Dienstleistungen verzeichnen eine steigende Nachfrage.
Details
- Titel
- Silver Market und die Auswirkungen auf das Marketing unter besonderer Beachtung gesundheitsrelevanter Produkte
- Hochschule
- Hochschule Fresenius; Köln
- Note
- 1,7
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V262686
- ISBN (eBook)
- 9783656512455
- ISBN (Buch)
- 9783656512691
- Dateigröße
- 1265 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Marketing OTC Selbstmedikation Gesundheit Gesundheitsprodukte Silver Market Silver Ager Generation 50plus Gesundheitsökonomie Sinus Milieu Gerontologie Alter und Gesundheit gesundes Altern Gesundheitsmarkt Wertewandel Marketing-Mix Gesundheitsgesellschaft Marktsegmentierung Soziologie Demographischer Wandel
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Silver Market und die Auswirkungen auf das Marketing unter besonderer Beachtung gesundheitsrelevanter Produkte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/262686
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-