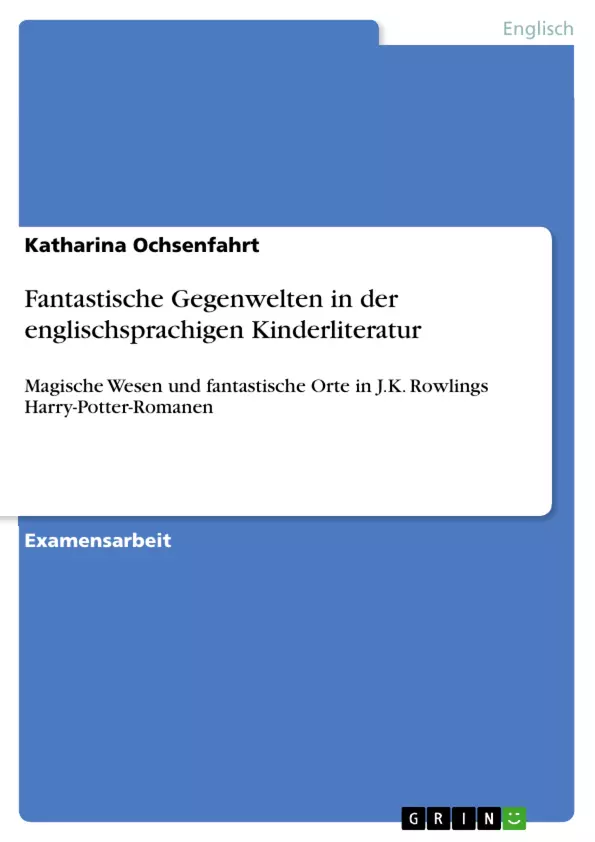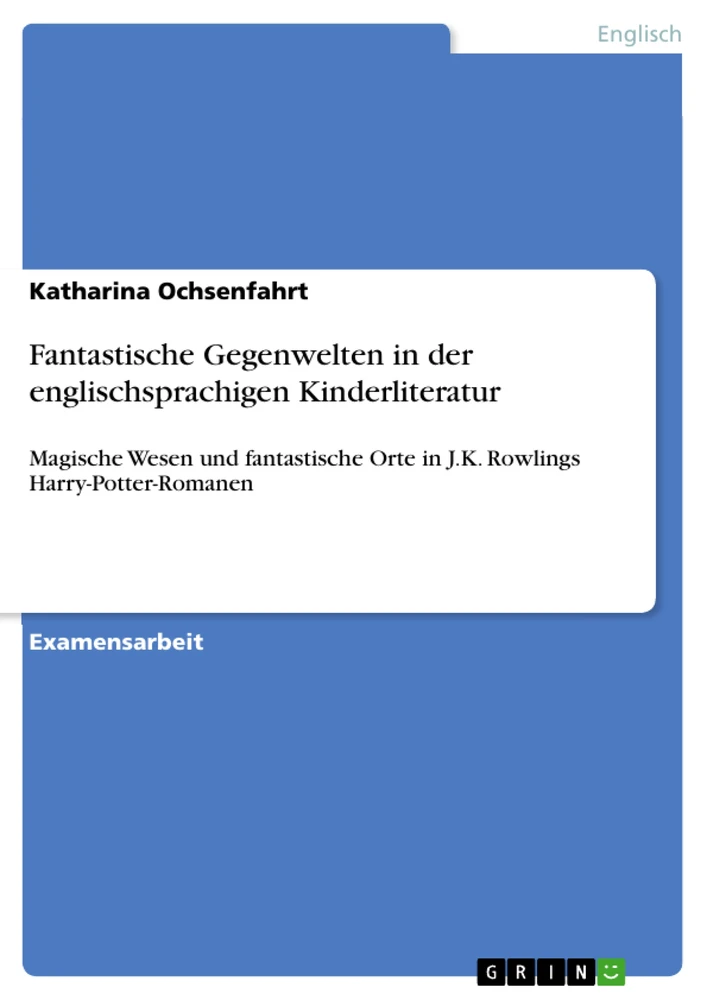
Fantastische Gegenwelten in der englischsprachigen Kinderliteratur
Examensarbeit, 2013
48 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder- und Jugendliteratur
- Englischsprachige Kinder- und Jugendliteratur
- Fantastische Kinder- und Jugendliteratur aus Großbritannien
- Fantastische Kinder- und Jugendliteratur
- Die fantastische Gegenwelt in Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Romanen
- Magische Wesen, fantastische Orte - Die Darstellung der Gegenwelt
- Erfolg wie von Zauberhand
- Die Harry-Potter-Romane als fantastische Kinder- und Jugendliteratur
- Der Weg in die magische Welt
- Die magische Gegenwelt
- Magische Gegenstände
- Geheimnisvolle Kreaturen
- Fantastische Orte
- Zauberer und Hexen – die Menschen in der magischen Welt
- Das Verhältnis der Welten zueinander
- Die Funktion der Gegenwelt
- Magische Wesen, fantastische Orte - Die Darstellung der Gegenwelt
- Der Bezug zu Werken aus anderer Genres
- Intertextualität
- Einflüsse fantastischer Genres
- Einflüsse realistischer Genres
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der fantastischen Gegenwelt in den Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling. Ziel ist es, die Darstellung der magischen Welt in den Harry-Potter-Romanen zu analysieren und ihren Bezug zur Realität, sowie ihre Funktion als narratives Element zu beleuchten. Dabei soll untersucht werden, inwiefern sich die Gegenwelt an ähnlichen Darstellungen in anderen Werken der Kinder- und Jugendliteratur orientiert und welche Eigenheiten sie aufweist.
- Die Darstellung der magischen Gegenwelt in den Harry-Potter-Romanen
- Der Bezug der magischen Welt zur realen Welt
- Die Funktion der Gegenwelt als narratives Element
- Die Verbindung der magischen Welt zu anderen Werken der Kinder- und Jugendliteratur
- Die Besonderheiten der fantastischen Gegenwelt in den Harry-Potter-Romanen im Vergleich zu anderen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der abnehmenden Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen dar und erläutert, wie die Harry-Potter-Romane dazu beitragen können, diese Problematik zu lösen. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition von Kinder- und Jugendliteratur und ihren typischen Merkmalen. Das dritte Kapitel beleuchtet die Besonderheiten der englischsprachigen und der fantastischen Kinder- und Jugendliteratur. Das vierte Kapitel analysiert die Darstellung der magischen Gegenwelt in den Harry-Potter-Romanen, wobei die Darstellung der Welt, ihr Bezug zur Realität und ihre Funktion als narratives Element im Mittelpunkt stehen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Bezug der Harry-Potter-Romane zu anderen Werken aus unterschiedlichen Genres und untersucht die Einflüsse auf die Darstellung der magischen Welt.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, fantastische Gegenwelt, Harry-Potter-Romane, magische Welt, Intertextualität, Genre, Realismus, Fantastik, narratives Element
Details
- Titel
- Fantastische Gegenwelten in der englischsprachigen Kinderliteratur
- Untertitel
- Magische Wesen und fantastische Orte in J.K. Rowlings Harry-Potter-Romanen
- Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena (Anglistik/Amerikanistik)
- Note
- 2,0
- Autor
- Katharina Ochsenfahrt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V263033
- ISBN (eBook)
- 9783656534464
- ISBN (Buch)
- 9783656537564
- Dateigröße
- 609 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- fantastische gegenwelten kinderliteratur magische wesen orte rowlings harry-potter-romanen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Ochsenfahrt (Autor:in), 2013, Fantastische Gegenwelten in der englischsprachigen Kinderliteratur, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/263033
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-