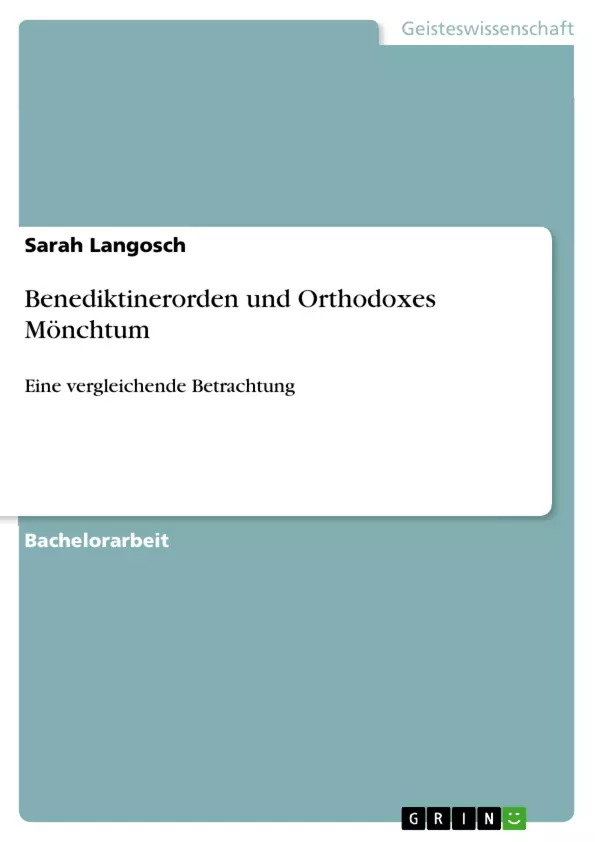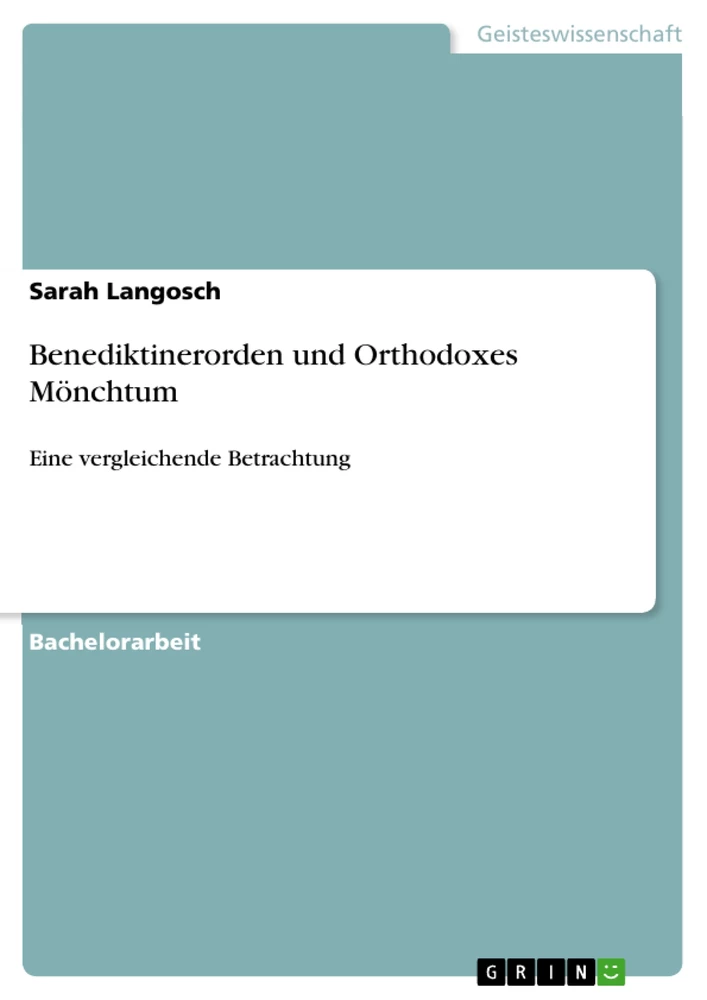
Benediktinerorden und Orthodoxes Mönchtum
Bachelorarbeit, 2013
37 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das abendländische Mönchtum
- Die Entstehung des abendländischen Mönchtums und das Leben der ersten Mönche
- Das Benediktinertum
- Das Leben des heiligen Benedikts von Nursia
- Die Regel des heiligen Benedikts von Nursia
- Das Leben und der Alltag im benediktinischen Kloster
- Das orthodoxe Mönchtum
- Die Entstehung und das Wesen des orthodoxen Mönchtums
- Der heilige Sergij von Radonež
- Das Leben des heiligen Sergij
- Das Wirken des heiligen Sergij
- Das Leben und Wirken der Starzen
- Der Vergleich von Benediktinertum und orthodoxem Mönchtum
- Der Vergleich der Wege verdienter Mönche zum Klosterleben
- Der Vergleich der Spiritualität der Mönche
- Der Vergleich der Gemeinschaft und Autorität im Kloster
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anfänge und Entwicklung des christlichen Mönchtums, indem sie das abendländische (lateinische) und das orthodoxe Mönchtum, insbesondere in Russland, vergleicht. Die Zielsetzung besteht darin, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Formen aufzuzeigen, deren historische Wurzeln zu beleuchten und den Einfluss bedeutender Persönlichkeiten wie des heiligen Benedikt von Nursia und des heiligen Sergij von Radonež zu analysieren.
- Entstehung und Entwicklung des abendländischen Mönchtums
- Entstehung und Entwicklung des orthodoxen Mönchtums
- Vergleich der Lebensweisen und Regeln im benediktinischen und orthodoxen Mönchtum
- Der Einfluss von Benedikt von Nursia und Sergij von Radonež
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen abendländischem und orthodoxem Mönchtum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontrast zwischen dem modernen, oft hektischen Streben nach Reichtum und dem Wunsch nach einem erfüllten Leben in Einklang mit spirituellen Idealen. Sie führt das Mönchtum als eine solche Alternative ein und kündigt den Vergleich zwischen abendländischem und orthodoxem Mönchtum an, wobei die Bedeutung von Benedikt von Nursia und Sergij von Radonež hervorgehoben wird.
Das abendländische Mönchtum: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Mönchtum" und erläutert seine historischen und sprachlichen Wurzeln. Es beschreibt die Rolle des Klosters als abgeschlossene Gemeinschaft und die Entwicklung der Abtsrolle. Geographisch wird der Ursprung des abendländischen Mönchtums im Orient im 3. Jahrhundert n. Chr. lokalisiert, mit Betonung seiner bedeutenden kulturellen Rolle im Mittelalter.
Die Entstehung des abendländischen Mönchtums und das Leben der ersten Mönche: Dieses Kapitel verfolgt die Entstehung des christlichen Mönchtums zurück bis zu den frühen Asketen und Eremiten, die sich aus der Gemeinde zurückzogen, um ein Leben in Vollkommenheit zu führen. Es beschreibt verschiedene Formen des frühen Mönchtums, darunter Eremiten, Kolonien und Koinobiten, mit besonderem Fokus auf Pachomius und seinen Beitrag zur Organisation des klösterlichen Lebens und der Einführung von Regeln und Gehorsam.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Abendländisches und Orthodoxes Mönchtum: Ein Vergleich"
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Vergleich des abendländischen (lateinischen) und orthodoxen Mönchtums, insbesondere in Russland. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Traditionen, ihren historischen Wurzeln und dem Einfluss bedeutender Persönlichkeiten wie des heiligen Benedikt von Nursia und des heiligen Sergij von Radonež.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entstehung und Entwicklung sowohl des abendländischen als auch des orthodoxen Mönchtums. Es werden die Lebensweisen und Regeln im benediktinischen und orthodoxen Mönchtum verglichen, der Einfluss von Benedikt von Nursia und Sergij von Radonež analysiert und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen beiden Traditionen herausgearbeitet.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das abendländische Mönchtum (inkl. Entstehung des abendländischen Mönchtums und das Leben der ersten Mönche und Das Benediktinertum mit Unterkapiteln zu Leben und Regel des hl. Benedikt und dem klösterlichen Alltag), Das orthodoxe Mönchtum (inkl. Entstehung und Wesen des orthodoxen Mönchtums, dem hl. Sergij von Radonež und dem Leben der Starzen), Der Vergleich von Benediktinertum und orthodoxem Mönchtum (inkl. Vergleich der Wege zum Klosterleben, der Spiritualität und der Gemeinschaft/Autorität im Kloster) und Fazit.
Wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten, die im Text behandelt werden?
Die wichtigsten Persönlichkeiten sind der heilige Benedikt von Nursia als zentrale Figur des abendländischen Mönchtums und der heilige Sergij von Radonež als bedeutende Persönlichkeit des orthodoxen Mönchtums in Russland. Ihre Lebenswege, ihr Wirken und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Mönchtums werden im Detail untersucht.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes besteht darin, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem abendländischen und dem orthodoxen Mönchtum aufzuzeigen, ihre historischen Wurzeln zu beleuchten und den Einfluss von Benedikt von Nursia und Sergij von Radonež zu analysieren. Es geht um einen vergleichenden Ansatz, der die verschiedenen Aspekte des Mönchslebens in beiden Traditionen beleuchtet.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist für Leser geeignet, die sich für Geschichte des Christentums, Religionswissenschaft, Kirchengeschichte und den Vergleich religiöser Traditionen interessieren. Er eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von religiösen Themen im historischen Kontext.
Welche Quellen werden verwendet? (Falls im Originaltext angegeben)
Die verwendeten Quellen sind im Originaltext nicht explizit genannt. Weitere Informationen zu den Quellen sind gegebenenfalls separat zu erfragen.
Details
- Titel
- Benediktinerorden und Orthodoxes Mönchtum
- Untertitel
- Eine vergleichende Betrachtung
- Hochschule
- Universität Erfurt
- Note
- 1,7
- Autor
- Sarah Langosch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V263302
- ISBN (eBook)
- 9783656522874
- ISBN (Buch)
- 9783656523796
- Dateigröße
- 545 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- benediktinerorden orthodoxes mönchtum eine betrachtung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Langosch (Autor:in), 2013, Benediktinerorden und Orthodoxes Mönchtum, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/263302
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-