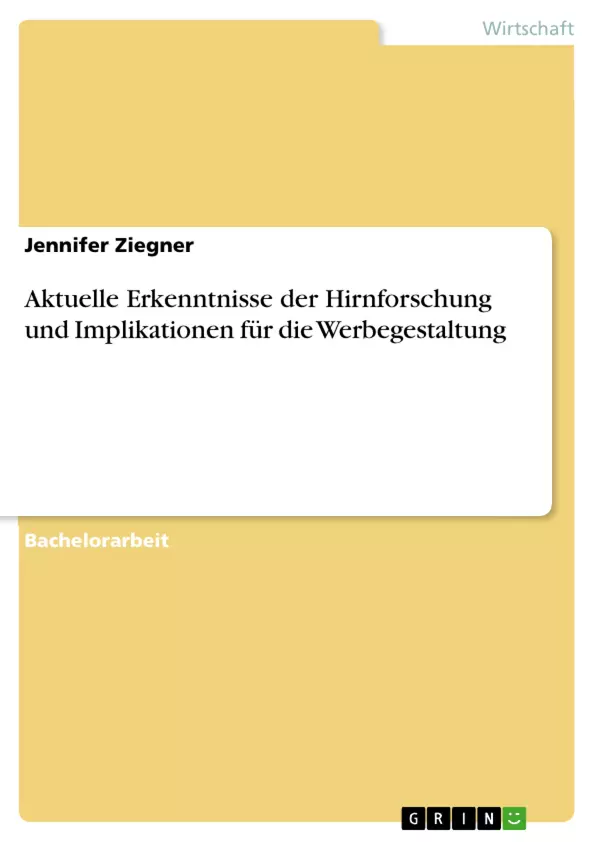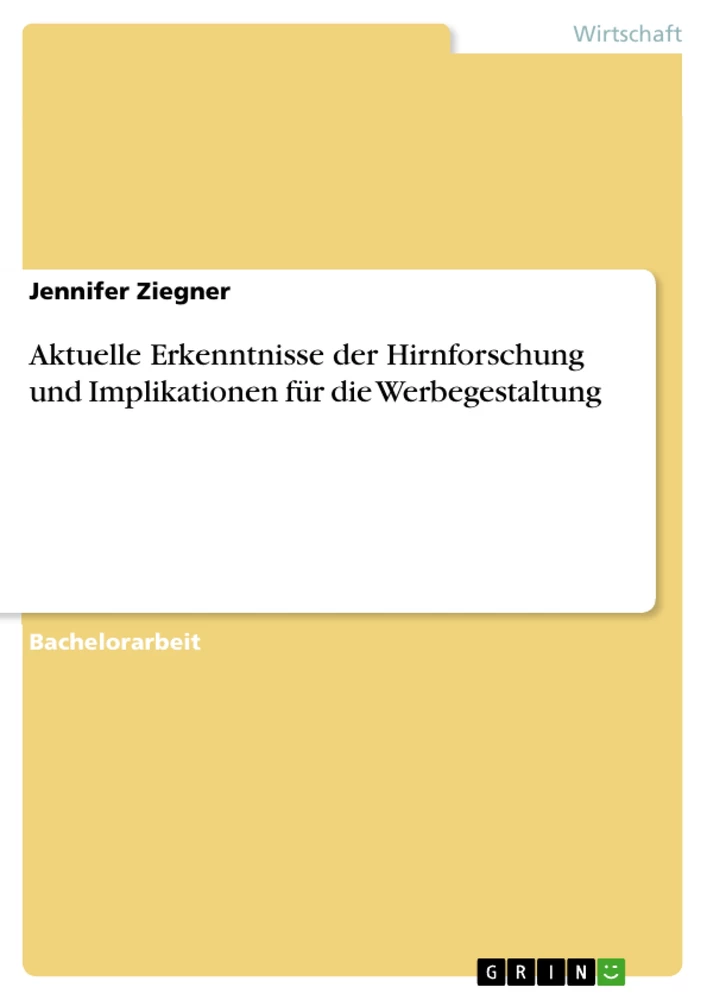
Aktuelle Erkenntnisse der Hirnforschung und Implikationen für die Werbegestaltung
Bachelorarbeit, 2013
54 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ablauf der Arbeit
- Neurologische Grundlagen
- Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Gehirns
- Limbisches System, Cortex und Gedächtnissysteme
- Das Limbische System
- Der Cortex
- Überblick über die Gedächtnissysteme
- Herleitung von Implikationen für die Werbegestaltung aus der Hirnforschung
- Bewusstsein und Unterbewusstsein
- Grundlagen zu Bewusstsein und Unterbewusstsein
- Nutzung des Unterbewusstseins zur Werbegestaltung
- Lernen und Gedächtnis
- Grundlagen des Lernens von Werbung
- Kommunikationsmuster und die Entbehrlichkeit von Logos
- Multisensorische Werbegestaltung
- Das Arbeitsgedächtnis und Bild- und Textgestaltung
- Verarbeitungstiefe und kognitive Verarbeitung von Werbung
- Emotionen und Motive
- Bedeutung von Emotionen und Motiven für die Werbung
- Der First-Choice-Brand-Effect
- Einsatz emotionaler Bilder in der Werbung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Erkenntnisse der Hirnforschung, um daraus Implikationen für die Werbegestaltung abzuleiten. Ziel ist es, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns im Kontext der Werbewirkung zu verstehen und die Erkenntnisse für eine effektive und effiziente Gestaltung von Werbekampagnen nutzbar zu machen.
- Das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein in der Verarbeitung von Werbung
- Die Rolle von Lernen und Gedächtnis für die Werbewirkung
- Der Einfluss von Emotionen und Motiven auf Kaufentscheidungen
- Die Anwendung neurologischer Erkenntnisse für die Gestaltung von Werbeanzeigen und Kampagnen
- Das Potential und die ethischen Herausforderungen von Neuromarketing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit die moderne Gesellschaft durch Werbung manipuliert wird. Das Kapitel erläutert die Relevanz von interdisziplinären Forschungsansätzen und stellt den Wandel vom rationalen zum emotionalen Konsumenten dar.
Das zweite Kapitel widmet sich den neurologischen Grundlagen. Es beleuchtet den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns, mit besonderem Fokus auf das limbische System, den Cortex und die Gedächtnissysteme. Die Erkenntnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage für die Herleitung von Implikationen für die Werbegestaltung.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Implikationen der Hirnforschung für die Gestaltung von Werbung. Es untersucht die Rolle von Bewusstsein und Unterbewusstsein, Lernen und Gedächtnis sowie Emotionen und Motiven bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Werbebotschaften.
Schlüsselwörter
Hirnforschung, Neuromarketing, Konsumentenverhalten, Werbung, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Lernen, Gedächtnis, Emotionen, Motive, Limbisches System, Cortex, Werbewirkung
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen „Kaufknopf“ (Buy-Button) im menschlichen Gehirn?
Nach aktuellem Forschungsstand gibt es keinen einzelnen „Kaufknopf“, jedoch erlaubt die Hirnforschung ein tiefgreifendes Verständnis neuronaler Prozesse, die Kaufentscheidungen beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Neuromarketing und Neuroökonomie?
Neuroökonomie ist das übergeordnete Forschungsfeld, während Neuromarketing die gezielte Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf das Marketing und die Werbegestaltung ist.
Welche Rolle spielt das Unbewusste bei der Werbewirkung?
Emotionale Prägungen und das Unbewusste dominieren das menschliche Verhalten. Werbung nutzt dies, indem sie Botschaften so gestaltet, dass sie unbewusst verarbeitet werden.
Wie beeinflusst das limbische System unsere Entscheidungen?
Das limbische System ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig. Da Emotionen Kaufentscheidungen maßgeblich steuern, ist dessen Verständnis essenziell für effektive Werbung.
Was versteht man unter multisensorischer Werbegestaltung?
Es ist die Ansprache mehrerer Sinne gleichzeitig, um die Einprägsamkeit und emotionale Wirkung einer Werbebotschaft im Gedächtnis zu erhöhen.
Was ist der „First-Choice-Brand-Effect“?
Dies beschreibt das Phänomen, bei dem eine Marke durch starke emotionale Verankerung im Gehirn des Konsumenten automatisch als erste Wahl bevorzugt wird.
Details
- Titel
- Aktuelle Erkenntnisse der Hirnforschung und Implikationen für die Werbegestaltung
- Hochschule
- Westsächsische Hochschule Zwickau, Standort Zwickau
- Note
- 1,0
- Autor
- Jennifer Ziegner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V263500
- ISBN (Buch)
- 9783656558781
- ISBN (eBook)
- 9783656558910
- Dateigröße
- 988 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Marketing Hirnforschung Neuromarketing Konsumentenverhalten Werbung Kommunikation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Jennifer Ziegner (Autor:in), 2013, Aktuelle Erkenntnisse der Hirnforschung und Implikationen für die Werbegestaltung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/263500
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-