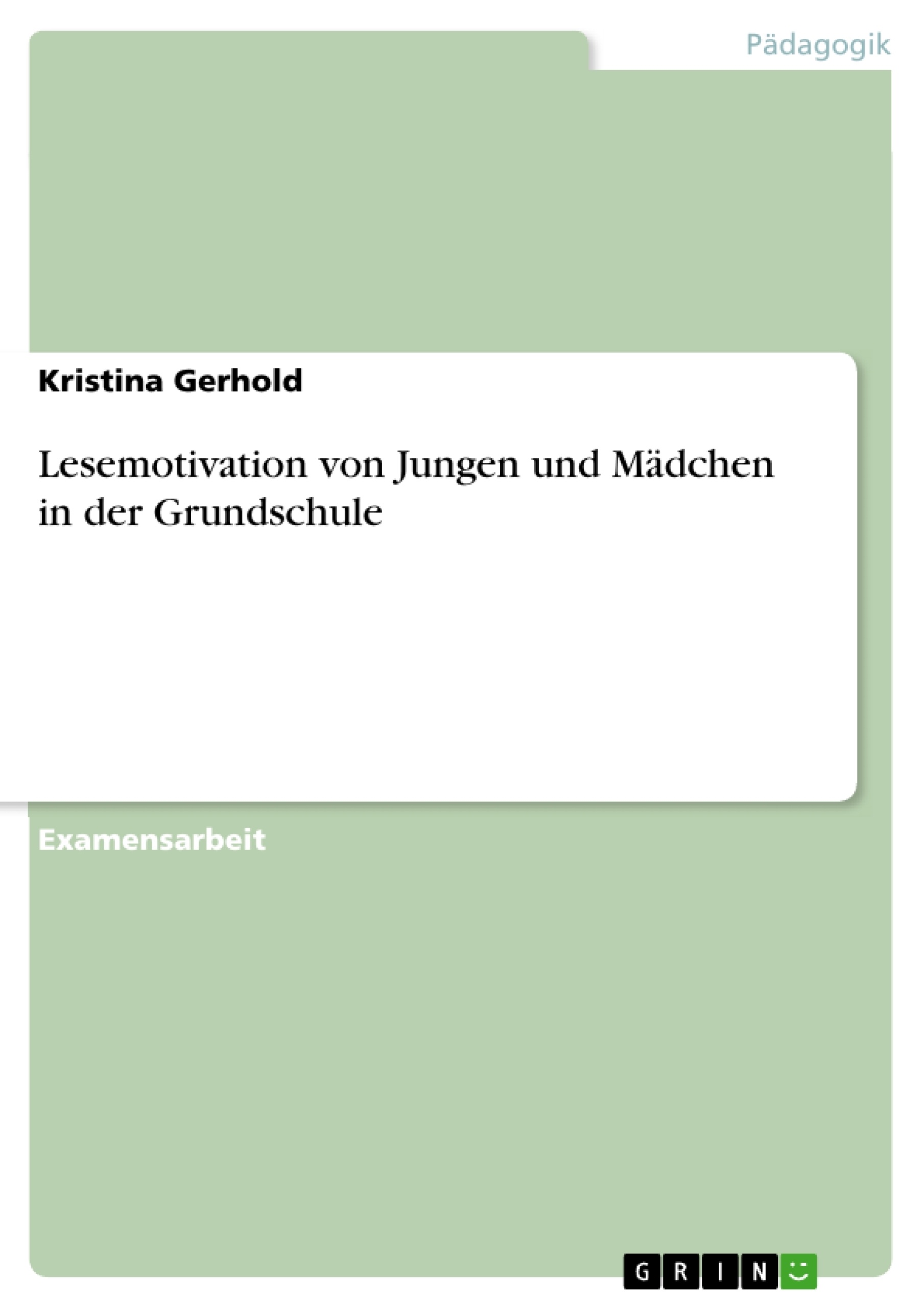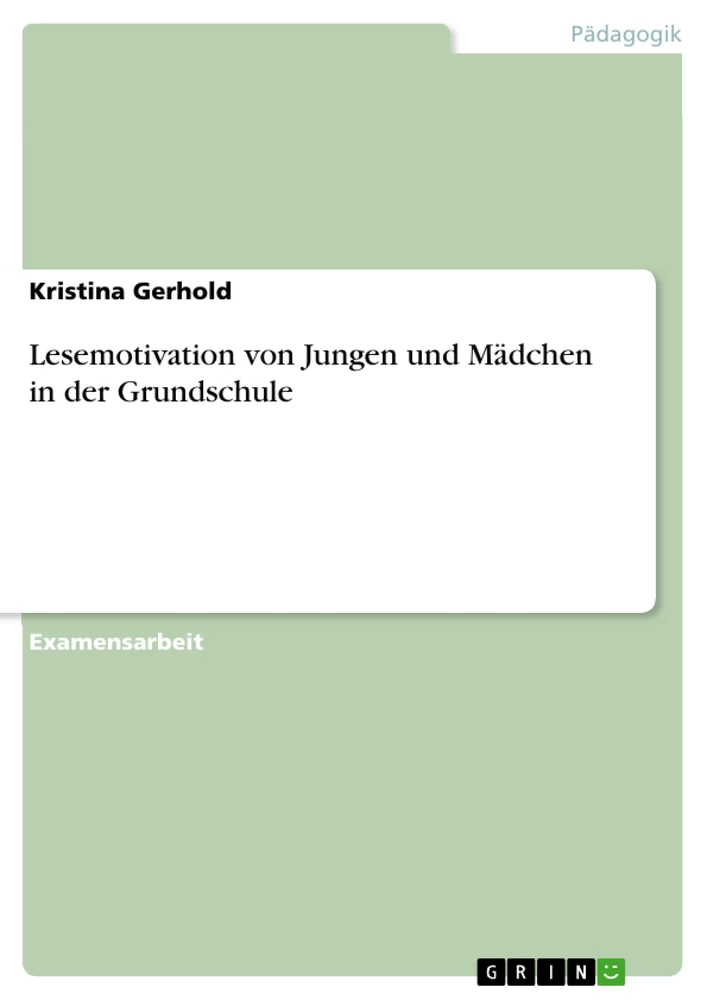
Lesemotivation von Jungen und Mädchen in der Grundschule
Examensarbeit, 2013
50 Seiten, Note: 2,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Der Begriff der Lesemotivatio
2.1.) Das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivatio
3.) Soziale Einflussfaktoren auf die Lesemotivation der Grundschüle
3.1.) Die Bedeutung der Schul
4.) Motivationsprobleme im Leseunterrich
4.1.) Der Deutschunterrich
4.2.) Motivationsprobleme beim Schulanfang und im Erstleseunterrich
4.3.) Woher kommen die Geschlechtsunterschiede
5.) Möglichkeiten zur Lesemotivationsförderung im Unterrich
5.1.) Die anregende Leseumgebung
5.2.) Kinderbücher als Klassenlektür
6.) Spezielle Lesemotivationsförderung für Junge
6.1.) Was ist ein gutes Jungenbuch
7.) Fazi
8.) Literaturverzeichni
9.) Abbildungsverzeichni
10.) Anhang
11.) Paderborner Erklärung
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Jungen oft geringere Lesemotivation als Mädchen?
Die Arbeit untersucht Geschlechtsunterschiede, die oft auf soziale Einflüsse, fehlende männliche Lesevorbilder und eine mangelnde Orientierung des Deutschunterrichts an Jungeninteressen zurückzuführen sind.
Was ist das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation?
Dieses Modell besagt, dass Lesemotivation davon abhängt, wie hoch jemand seine Erfolgsaussichten beim Lesen einschätzt und welchen persönlichen Wert er dem Lesen beimisst.
Wie kann man die Lesemotivation im Unterricht fördern?
Durch eine anregende Leseumgebung, eine freie Auswahl an Klassenlektüren und die Einbeziehung von Medien, die die Lebenswelt der Kinder ansprechen.
Was macht ein „gutes Jungenbuch“ aus?
Gute Jungenbücher enthalten oft mehr Action, Humor, Sachthemen oder Identifikationsfiguren, die den spezifischen Interessen von Jungen in der Grundschule entsprechen.
Welche Rolle spielt die Schule beim Schulanfang?
Besonders im Erstleseunterricht entscheidet sich oft, ob Kinder Freude am Lesen entwickeln oder durch Überforderung und unpassende Texte demotiviert werden.
Details
- Titel
- Lesemotivation von Jungen und Mädchen in der Grundschule
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Note
- 2,7
- Autor
- Kristina Gerhold (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V264188
- ISBN (eBook)
- 9783656533467
- ISBN (Buch)
- 9783656535386
- Dateigröße
- 806 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- lesemotivation jungen mädchen grundschule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Kristina Gerhold (Autor:in), 2013, Lesemotivation von Jungen und Mädchen in der Grundschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/264188
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-