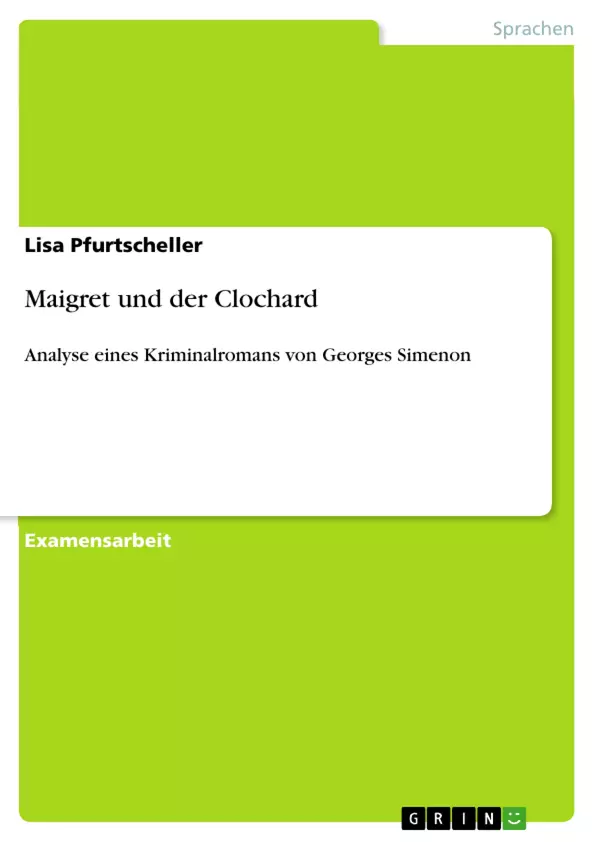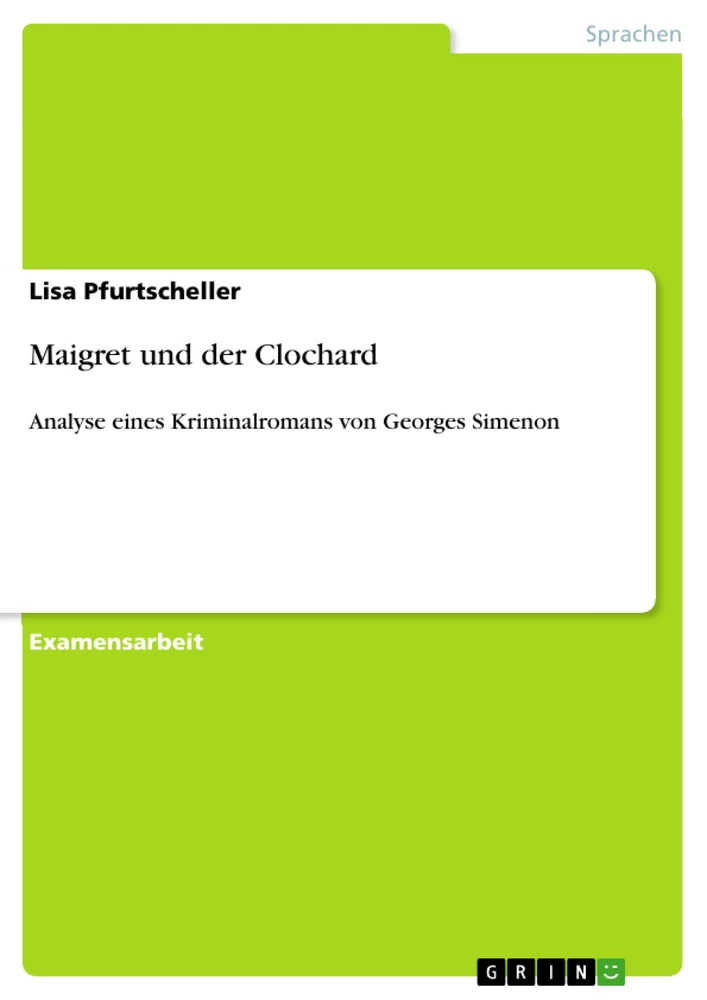
Maigret und der Clochard
Examensarbeit, 2010
25 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsangabe
- Einleitung
- Un bref résumé de l'oeuvre
- Erzähleranalyse
- Der Erzähler
- Erzählerstimme
- Erzählperspektive und Blickwinkel
- Formen der Redewiedergabe
- Formen der Handlungswiedergabe
- Figurenanalyse
- Quantitative und qualitative Figurenkonstellation
- Flat- und Round- Characters
- Der Autor und seine Hauptfigur
- Raumanalyse
- Der Anschauungsraum
- Der Handlungsraum
- Der gestimmte Raum
- Zeitanalyse
- Erzählzeit und erzählte Zeit
- Rhythmuswechsel
- Zeitraffung
- Rückwendungen
- Häufigkeit
- Pausen
- Handlungsanalyse
- Eröffnung und Schluss
- Struktur und Handlung
- Handlungsstränge
- Spannung und Spannungshöhepunkte
- Analyse der symbolischen Kulisse
- Der Vogel
- Die Farben schwarz und weiß
- Die Murmeln
- Schlussfolgerung
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Kriminalroman „Maigret und der Clochard“ von Georges Simenon. Ziel ist es, die Gründe für den Erfolg des Romans und der Figur des Kommissars Maigret zu untersuchen. Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte des Romans, wie die Erzählstruktur, die Figuren, den Raum, die Zeit und die symbolische Kulisse.
- Die Rolle des auktorialen Erzählers und seine Beziehung zur Hauptfigur Maigret
- Die Figurenkonstellation und die Darstellung verschiedener sozialer Schichten
- Die Bedeutung des Raumes als Ausdrucksträger und die Atmosphäre der Großstadt Paris
- Die Zeitanalyse und die Verwendung von Zeitsprüngen, Rückwendungen und Pausen
- Die symbolische Kulisse und die Verwendung von Symbolen wie dem Vogel, den Farben Schwarz und Weiß und den Murmeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Analyse dar. Die Zusammenfassung des Buches „Maigret et le Clochard“ bietet dem Leser einen Überblick über die Handlung und die Hauptfiguren. Die Erzähleranalyse konzentriert sich auf die Rolle des auktorialen Erzählers, seine Perspektive und die Verwendung von Rede- und Handlungswiedergabe. Die Figurenanalyse untersucht die quantitative und qualitative Figurenkonstellation, die Darstellung von Flat- und Round-Characters sowie die Beziehung zwischen dem Autor und seiner Hauptfigur. Die Raumanalyse befasst sich mit dem Anschauungsraum, dem Handlungsraum und dem gestimmten Raum. Die Zeitanalyse analysiert die Erzählzeit und die erzählte Zeit, die Verwendung von Zeitsprüngen, Rückwendungen und Pausen. Die Handlungsanalyse untersucht die Eröffnung und den Schluss des Romans, die Struktur und die Handlungsstränge, sowie die Spannung und die Spannungshöhepunkte. Die Analyse der symbolischen Kulisse befasst sich mit der Verwendung von Symbolen wie dem Vogel, den Farben Schwarz und Weiß und den Murmeln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Kriminalroman, Georges Simenon, Kommissar Maigret, Erzählanalyse, Figurenanalyse, Raumanalyse, Zeitanalyse, Handlungsanalyse, symbolische Kulisse, Erfolg, Einfachheit, soziale Schichten, Dialog, Spannung, Symbol.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Autor von "Maigret und der Clochard"?
Der Roman wurde 1962 von dem berühmten belgischen Schriftsteller Georges Simenon verfasst.
Was zeichnet die Figur des Kommissar Maigret aus?
Maigret ist bekannt für seine Intuition, seine Menschlichkeit und die Fähigkeit, sich in die soziale Kulisse und die Psyche der Beteiligten einzufühlen.
Welche Rolle spielt der Schauplatz Paris in Simenons Romanen?
Paris ist nicht nur Kulisse, sondern ein "gestimmter Raum", der durch Atmosphäre und soziale Milieus die Handlung maßgeblich prägt.
Was wird in der symbolischen Kulisse des Romans analysiert?
Die Arbeit untersucht Symbole wie den Vogel, die Farben Schwarz und Weiß sowie Murmeln als Bedeutungsträger.
Wie unterscheidet sich Maigret von klassischen Detektiven wie Sherlock Holmes?
Während Holmes auf rein logische Deduktion setzt, nutzt Maigret eher Empathie und das Verständnis für menschliche Schwächen.
Details
- Titel
- Maigret und der Clochard
- Untertitel
- Analyse eines Kriminalromans von Georges Simenon
- Hochschule
- Universität Wien (Romanistik)
- Note
- 1,0
- Autor
- MMag. Lisa Pfurtscheller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 25
- Katalognummer
- V265424
- ISBN (eBook)
- 9783656551867
- ISBN (Buch)
- 9783656551904
- Dateigröße
- 632 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- maigret clochard analyse kriminalroman George Simenon Roman
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- MMag. Lisa Pfurtscheller (Autor:in), 2010, Maigret und der Clochard, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/265424
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-