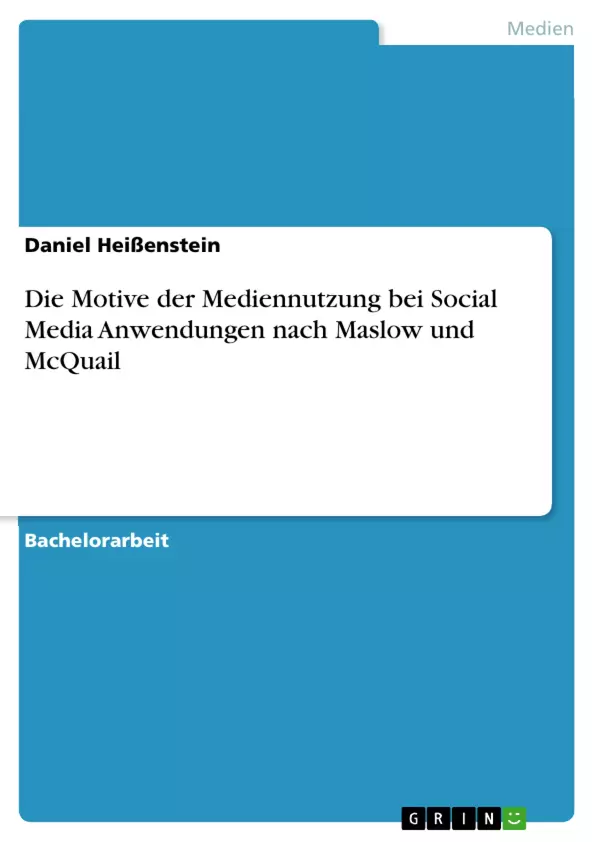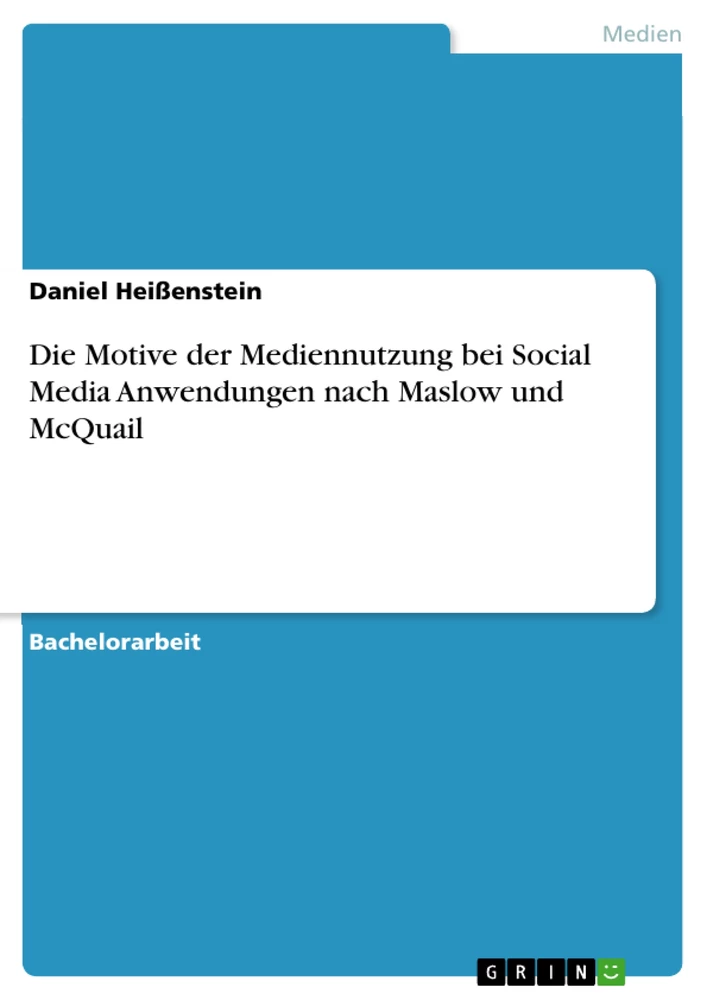
Die Motive der Mediennutzung bei Social Media Anwendungen nach Maslow und McQuail
Bachelorarbeit, 2013
60 Seiten, Note: 2,0
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Uses-and-gratifications approach
- Theorien der Mediennutzung
- Erregungstheorie
- Identitätstheorie
- Einstellungstheorie
- Eskapismustheorie
- Spieltheorie
- Social Media und seine Bedeutung
- Vergleichbare Forschungen
- Motivtheorie nach McQuail
- Motive Mediennutzung bei McQuail
- Bedürfnishierarchie nach Maslow
- Motive Mediennutzung bei Maslow
- Neuere Motive
- Konzeption Fragen und Zuordnung
- Methodische Vorgehensweise
- Auswertung
- Allgemeine Auswertung
- Auswertung Theorien
- Theorie McQuail
- Theorie Maslow
- Analyse Faktorenabhängigkeit
- Geschlecht
- Alter
- Partnerbeziehung
- Test auf soziale Erwünschtheit
- Vergleich Ergebnisse mit Langzeitstudie Massenkommunikation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Abbildungsverzeichms
- Auswertung
- Fragebogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Motiven der Mediennutzung im Bereich der Social Media Anwendungen, insbesondere auf Facebook. Sie verfolgt einen behavioristischen Ansatz, der die Bedürfnisse und Motive der Nutzer als Ausgangspunkt nimmt. Die Arbeit untersucht die Gültigkeit klassischer Motivtheorien von Maslow und McQuail im Kontext der Social Media Nutzung und analysiert neuere Motivdimensionen, um festzustellen, ob die Social Media Nutzung eher durch "klassische" Motive oder neuere Phänomene bestimmt wird.
- Überprüfung der Gültigkeit der Motivtheorien von Maslow und McQuail im Bereich der Social Media Anwendungen.
- Identifizierung relevanter neuerer Motive bei der Social Media Nutzung.
- Ermittlung der wichtigsten Motive und Motivkategorien für die Nutzer von Social Media.
- Analyse des Einflusses von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung und Partnerbeziehung auf die Motive der Social Media Nutzung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Social Media Nutzung ein und stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext des rasanten Wachstums von Social Media Plattformen dar. Es werden die Forschungsfragen definiert, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
Im Kapitel "Begriffsdefinitionen" werden zentrale Begriffe der Arbeit wie Bedürfnisse und Motive definiert und erläutert. Es wird die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Motiven dargestellt.
Das Kapitel "Uses-and-gratifications approach" stellt den behavioristischen Ansatz der Arbeit vor und erläutert die Grundannahmen des Uses-and-gratifications approach, der die aktive Rolle des Rezipienten und die Bedeutung von Bedürfnissen und Motiven für die Mediennutzung betont.
Das Kapitel "Theorien der Mediennutzung" präsentiert verschiedene Theorien, die im Zusammenhang mit Motiven der Mediennutzung relevant sind. Es werden die Erregungstheorie, die Identitätstheorie, die Einstellungstheorie, die Eskapismustheorie und die Spieltheorie vorgestellt.
Das Kapitel "Social Media und seine Bedeutung" erläutert die Bedeutung von Social Media in der heutigen Gesellschaft und beschreibt die verschiedenen Ebenen der Entwicklung von Social Media: die individuelle, die technologische und die sozio-ökonomische Ebene.
Das Kapitel "Facebook" stellt die Social Media Anwendung Facebook vor und beschreibt die wichtigsten Funktionen der Plattform sowie ihre Bedeutung für die Kommunikation und das Marketing.
Das Kapitel "Vergleichbare Forschungen" präsentiert vergleichbare Studien zur Thematik Motive der Mediennutzung, die sich mit den Persönlichkeitseigenschaften von Facebook-Nutzern und deren Motiven für aktive Partizipation beschäftigen.
Das Kapitel "Motivtheorie nach McQuail" stellt die Motivtheorie von Denis McQuail vor, die die Motive der Mediennutzung in vier Kategorien einteilt: Information, Unterhaltung, persönliche Identität und Integration sowie soziale Interaktion.
Das Kapitel "Motive Mediennutzung bei McQuail" beschreibt die einzelnen Motivdimensionen der vier Kategorien von McQuail und stellt diese in Abbildungen dar.
Das Kapitel "Bedürfnishierarchie nach Maslow" präsentiert die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow und erläutert die verschiedenen Bedürfnisstufen, die von physiologischen Bedürfnissen bis hin zur Selbstverwirklichung reichen.
Das Kapitel "Motive Mediennutzung bei Maslow" zeigt die Motivdimensionen der Bedürfnisstufen von Maslow, die für die Untersuchung relevant sind, und stellt diese in Abbildungen dar.
Das Kapitel "Neuere Motive" stellt neuere Motivdimensionen vor, die im Kontext der Social Media Nutzung relevant sein könnten. Diese Motive werden in drei Kategorien eingeteilt: neuere Phänomene, funktionale Gründe und soziale Gründe.
Das Kapitel "Konzeption Fragen und Zuordnung" beschreibt die Übersetzung der Motivdimensionen in Fragen für den Fragebogen, der für die Untersuchung eingesetzt wird.
Das Kapitel "Methodische Vorgehensweise" erläutert die methodische Vorgehensweise der Untersuchung, die auf einer quantitativen Online-Befragung basiert.
Das Kapitel "Auswertung" präsentiert die Ergebnisse der Befragung und analysiert die wichtigsten Motivkategorien, die Motive mit der höchsten und niedrigsten Zustimmung sowie die Faktorenabhängigkeit der Motive von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Partnerbeziehung. Es wird auch ein Test auf soziale Erwünschtheit durchgeführt.
Das Kapitel "Vergleich Ergebnisse mit Langzeitstudie Massenkommunikation" vergleicht die Ergebnisse der Arbeit mit den Ergebnissen der Langzeitstudie Massenkommunikation, die sich mit den Mediennutzungsgewohnheiten im Intermediavergleich beschäftigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Motive der Mediennutzung, Social Media Anwendungen, insbesondere Facebook, die Motivtheorien von Maslow und McQuail, neuere Motivdimensionen, Faktorenabhängigkeit, soziale Erwünschtheit und die Langzeitstudie Massenkommunikation. Die Arbeit analysiert die Nutzung von Social Media und untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Motive der Nutzer. Sie stellt die Relevanz von Social Media in der heutigen Gesellschaft dar und beleuchtet die Veränderungen der Mediennutzung im Laufe der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzen Menschen soziale Medien wie Facebook?
Die Nutzung folgt dem "Uses-and-gratifications approach". Menschen suchen Befriedigung für Bedürfnisse wie Information, Unterhaltung, soziale Interaktion und die Bestätigung der eigenen Identität.
Wie lässt sich die Maslowsche Bedürfnishierarchie auf Social Media übertragen?
Social Media bedient vor allem höhere Bedürfnisse wie soziale Zugehörigkeit (Vernetzung), Anerkennung (Likes/Kommentare) und im digitalen Raum auch Ansätze der Selbstverwirklichung.
Welche vier Motivkategorien definiert McQuail für die Mediennutzung?
Denis McQuail unterscheidet zwischen Information (Lernen), persönlicher Identität (Selbstfindung), Integration und sozialer Interaktion (Beziehungen) sowie Unterhaltung (Eskapismus/Entspannung).
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Facebook-Nutzung?
Studien zeigen oft, dass Frauen soziale Medien stärker zur Pflege von Beziehungen und zur sozialen Interaktion nutzen, während bei Männern teilweise funktionale oder informationsorientierte Motive im Vordergrund stehen können.
Was ist die Eskapismustheorie im Kontext von Social Media?
Eskapismus beschreibt die Flucht aus dem Alltag. Nutzer verwenden soziale Medien, um sich von Problemen abzulenken oder in eine virtuelle Welt einzutauchen, die als weniger belastend empfunden wird.
Details
- Titel
- Die Motive der Mediennutzung bei Social Media Anwendungen nach Maslow und McQuail
- Hochschule
- Universität Trier (Medienwissenschaft)
- Note
- 2,0
- Autor
- Daniel Heißenstein (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V265442
- ISBN (Buch)
- 9783656576938
- ISBN (eBook)
- 9783656576976
- Dateigröße
- 591 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- motive mediennutzung maslow mcquail gültigkeit social media anwendungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Heißenstein (Autor:in), 2013, Die Motive der Mediennutzung bei Social Media Anwendungen nach Maslow und McQuail, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/265442
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-