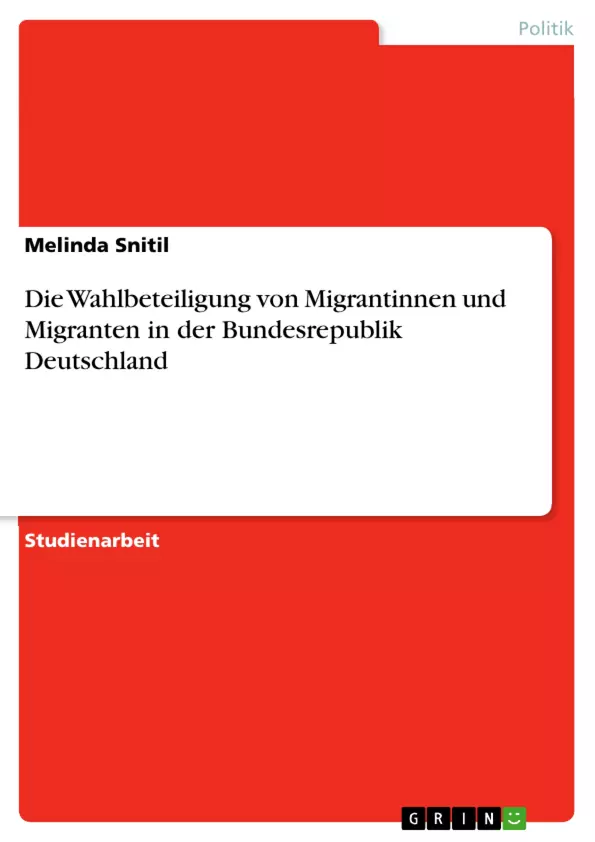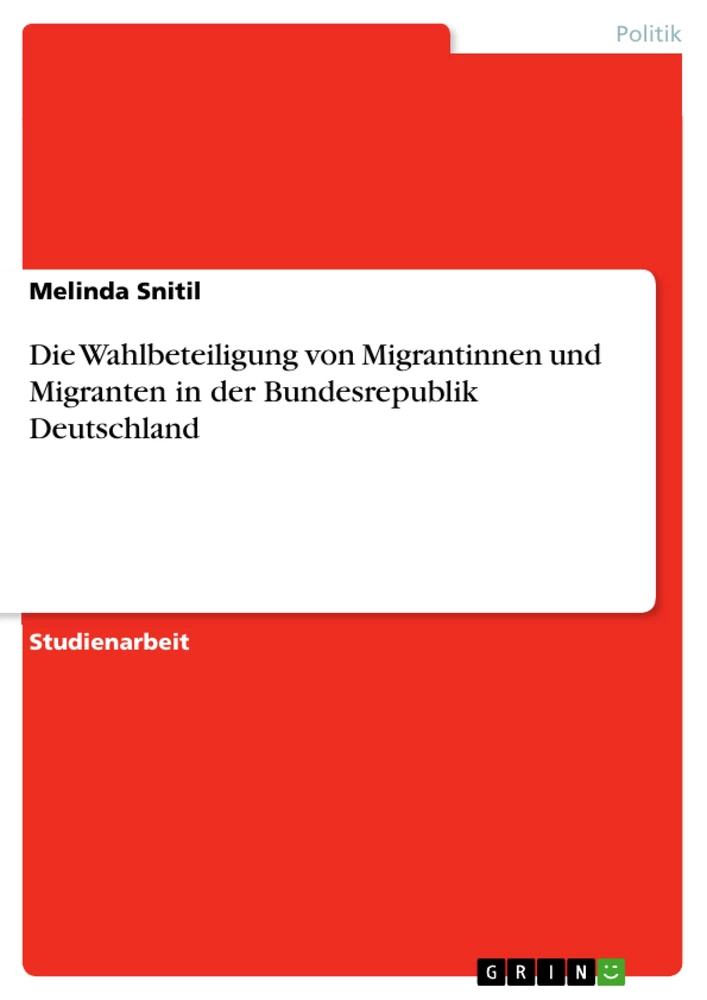
Die Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik Deutschland
Hausarbeit, 2012
18 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Konzepte
- Empirische Wahlforschung
- Wahlbeteiligung/Wahlpartizipation
- Empirie
- Politikwissenschaftliche Erklärungstheorien
- Forschungsstand
- Diskussion und Analyse
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Wahlpartizipation von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob die Kandidatur von Politikern mit Migrationshintergrund die Wahlbeteiligung dieser Gruppe beeinflusst. Die Arbeit zielt darauf ab, die Hypothese zu überprüfen, dass eine höhere Anzahl von Kandidaten mit Migrationshintergrund zu einer gesteigerten Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten führt.
- Wahlverhalten von Migrantinnen und Migranten in Deutschland
- Einfluss von Kandidaten mit Migrationshintergrund auf die Wahlbeteiligung
- Theorien und Modelle der empirischen Wahlforschung
- Analyse von Wahlstudien und Umfragen
- Mobilisierung von Wählern mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Wahlpartizipation von Migrantinnen und Migranten in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Hypothese der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der empirischen Wahlforschung und definiert wichtige Begriffe wie Wahlbeteiligung und Wahlpartizipation. Kapitel 3 untersucht verschiedene politikwissenschaftliche Erklärungstheorien, die das Wahlverhalten von Bürgerinnen und Bürgern erklären, und präsentiert den aktuellen Forschungsstand zur Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten. Kapitel 4 analysiert die Ergebnisse von Studien und Umfragen, die den Einfluss von Kandidaten mit Migrationshintergrund auf die Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wahlpartizipation, Migrantinnen und Migranten, Kandidaten mit Migrationshintergrund, empirische Wahlforschung, politische Integration, Repräsentation, Mobilisierung und Wahlstudien. Die Arbeit analysiert die Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, insbesondere den Einfluss von Kandidaten mit Migrationshintergrund auf diese Gruppe.
Details
- Titel
- Die Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik Deutschland
- Hochschule
- Technische Universität Darmstadt (Institut für Politikwissenschaften)
- Veranstaltung
- Seminar Einführung in die Politikwissenschaft
- Note
- 1,3
- Autor
- Melinda Snitil (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 18
- Katalognummer
- V266362
- ISBN (eBook)
- 9783656560562
- ISBN (Buch)
- 9783656560586
- Dateigröße
- 547 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Politik Wahlen election Wahlbeteiligung Wahlpartizipation Migranten Migrantenwahlrecht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Melinda Snitil (Autor:in), 2012, Die Wahlbeteiligung von Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/266362
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-