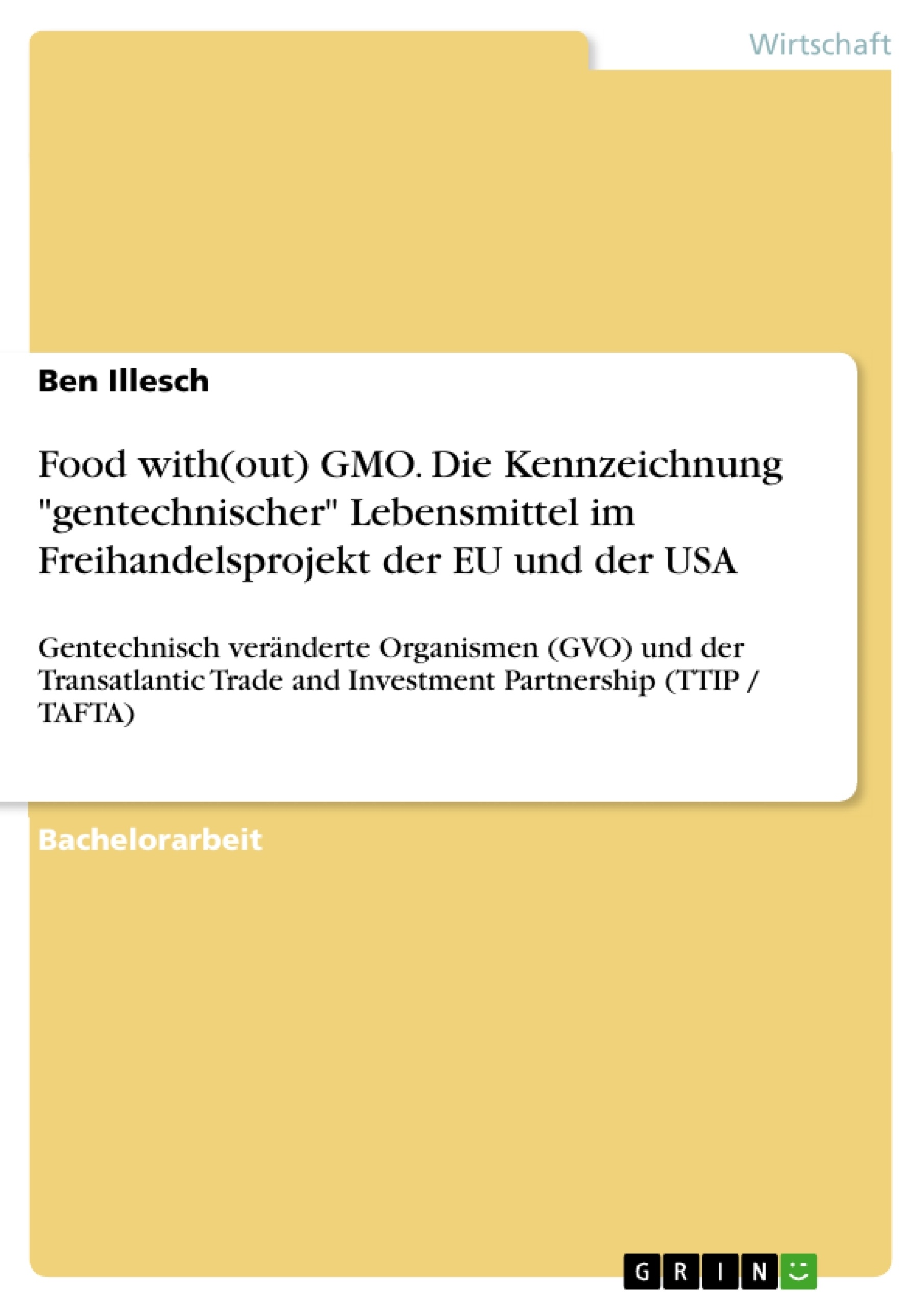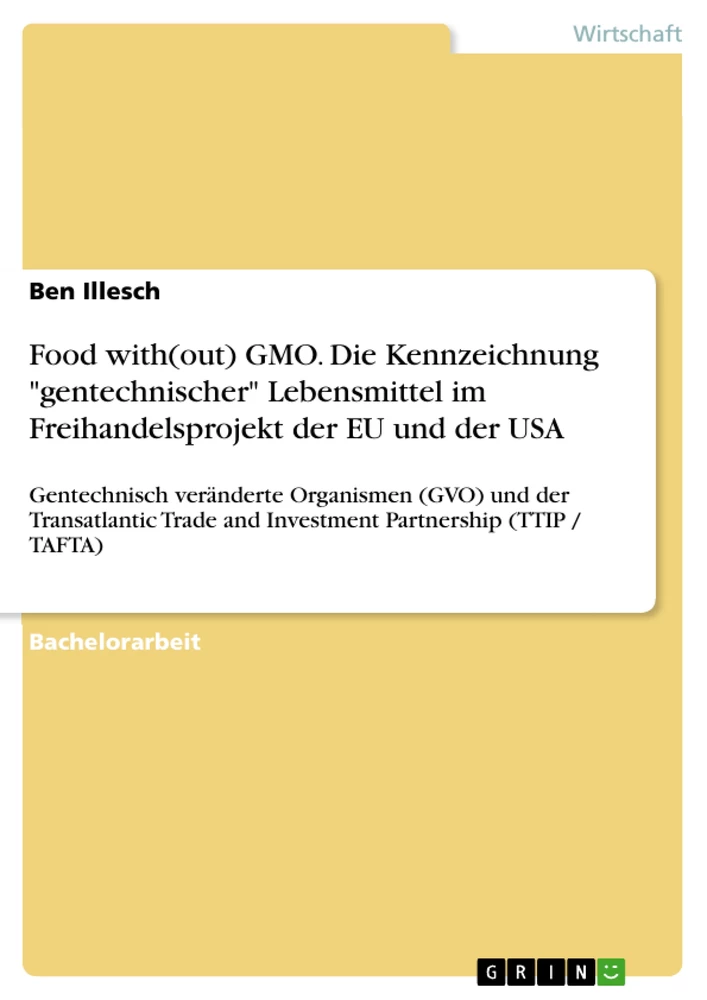
Food with(out) GMO. Die Kennzeichnung "gentechnischer" Lebensmittel im Freihandelsprojekt der EU und der USA
Bachelorarbeit, 2013
79 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gentechnik bei der Lebensmittelherstellung
- 2.1 Terminologie
- 2.2 „Vom Labor auf den Teller“ - Eigenschaften und Anwendungsgebiete von GVO
- 2.3 Das Inverkehrbringen von GVO
- 2.4 Grüne Gentechnik: „Segen oder Fluch?”
- 2.4.1 Der ökonomische Nutzen von GVO
- 2.4.2 Die Risiken von GVO
- 2.5 Der öffentliche Diskurs im transatlantischen Vergleich
- 3 Die Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln
- 3.1 Kennzeichnung in der EU
- 3.1.1 Gründe für die Kennzeichnung
- 3.1.2 Die gesamteuropäische Positivkennzeichnung
- 3.1.3 Die Negativkennzeichnung
- 3.2 Kennzeichnung in den USA
- 3.2.1 Der gesamtamerikanische Rechtsrahmen
- 3.2.2 Industrie vs. Verbraucher“ - Der steinige Weg zur Positivkennzeichnung
- 3.2.3 Freiwillige (nichtstaatliche) Negativ- und Positivkennzeichnung
- 4 GV-Lebensmittel im Freihandelsprojekt TTIP
- 4.1 Der Weg zur größten Freihandelszone der Welt
- 4.2 Was bringt das Abkommen? – Eine Prognose
- 4.2.1 Mögliche Vorteile
- 4.2.2 (Un-)überwindbare Konfliktthemen
- 4.3 Die Kennzeichnungsfrage: Ein alt bekanntes Problem!?
- 4.4 Mögliche Kennzeichnungsszenarien – ein Ausblick
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel im Kontext des geplanten Freihandelsabkommens TTIP zwischen der EU und den USA. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Ansätze beider Wirtschaftsräume und prognostiziert mögliche Auswirkungen des TTIP auf die Kennzeichnungspraxis.
- Die unterschiedlichen Kennzeichnungssysteme der EU und der USA
- Die Rolle der Gentechnik in der Lebensmittelproduktion
- Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von GVO
- Die Herausforderungen der Harmonisierung der Kennzeichnung im Rahmen des TTIP
- Mögliche Konfliktpunkte und Kompromisslösungen im TTIP-Verhandlungsprozess bezüglich der Kennzeichnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beleuchtet das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA als Hintergrund für die Untersuchung der Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel. Es wird auf die Bedeutung des TTIP als größtes bilaterales Handelsabkommen hingewiesen und die potenziellen Herausforderungen bei der Harmonisierung unterschiedlicher Regulierungen, insbesondere im Bereich der Gentechnik, hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert sich auf die Kennzeichnung von GVO als ein zentrales Konfliktthema im TTIP-Verhandlungsprozess.
2 Gentechnik bei der Lebensmittelherstellung: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Gentechnik in der Lebensmittelproduktion. Es definiert relevante Terminologie, beschreibt die Eigenschaften und Anwendungsgebiete gentechnisch veränderter Organismen (GVO), beleuchtet den Prozess des Inverkehrbringens von GVO und diskutiert die umstrittene Frage nach den ökonomischen Vorteilen und Risiken der grünen Gentechnik. Der transatlantische Vergleich des öffentlichen Diskurses zu diesem Thema wird ebenfalls erörtert, um die unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Perspektiven aufzuzeigen.
3 Die Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln: Dieses Kapitel vergleicht die Kennzeichnungssysteme für gentechnisch veränderte Lebensmittel in der EU und den USA. Es analysiert die Gründe für die Kennzeichnungspflicht in der EU, beschreibt die europäische Positiv- und Negativkennzeichnung und setzt diese im Detail mit dem amerikanischen Rechtsrahmen und den dortigen Praktiken der Kennzeichnung (freiwillig und staatlich reguliert) in Beziehung. Die unterschiedlichen Ansätze beider Wirtschaftsräume werden hier detailliert herausgearbeitet und gegenübergestellt.
4 GV-Lebensmittel im Freihandelsprojekt TTIP: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung der Kennzeichnungsfrage im Rahmen des TTIP-Abkommens. Es untersucht den Entstehungsprozess des Abkommens und analysiert potenzielle Vorteile und Herausforderungen für die beteiligten Akteure. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse möglicher Konfliktthemen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Ansätze zur Kennzeichnung von GVO. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf mögliche Kennzeichnungsszenarien nach Inkrafttreten des Abkommens.
Schlüsselwörter
Gentechnik, Gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Lebensmittelkennzeichnung, TTIP, Freihandelsabkommen, EU, USA, Transatlantischer Handel, ökonomische Aspekte, gesellschaftliche Akzeptanz, Risiken, Vorteile, Rechtsrahmen, Harmonisierung, Konfliktpotenzial.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel im Kontext von TTIP
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel (GV-Lebensmittel) im Kontext des geplanten Freihandelsabkommens TTIP zwischen der EU und den USA. Sie analysiert die unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Ansätze beider Wirtschaftsräume und prognostiziert mögliche Auswirkungen des TTIP auf die Kennzeichnungspraxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die unterschiedlichen Kennzeichnungssysteme der EU und der USA, die Rolle der Gentechnik in der Lebensmittelproduktion, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), die Herausforderungen der Harmonisierung der Kennzeichnung im Rahmen des TTIP und mögliche Konfliktpunkte und Kompromisslösungen im TTIP-Verhandlungsprozess bezüglich der Kennzeichnung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Gentechnik in der Lebensmittelherstellung, ein Kapitel zum Vergleich der Kennzeichnungssysteme in der EU und den USA und ein Kapitel zu GV-Lebensmitteln im Kontext von TTIP. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die verwendeten Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel „Gentechnik bei der Lebensmittelherstellung“ behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Gentechnik in der Lebensmittelproduktion. Es definiert relevante Begriffe, beschreibt Eigenschaften und Anwendungsgebiete von GVO, beleuchtet das Inverkehrbringen von GVO und diskutiert die ökonomischen Vorteile und Risiken der grünen Gentechnik. Ein transatlantischer Vergleich des öffentlichen Diskurses wird ebenfalls präsentiert.
Was wird im Kapitel „Die Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln“ behandelt?
Dieses Kapitel vergleicht die Kennzeichnungssysteme für GV-Lebensmittel in der EU und den USA. Es analysiert die Gründe für die Kennzeichnungspflicht in der EU, beschreibt die europäische Positiv- und Negativkennzeichnung und vergleicht diese detailliert mit dem amerikanischen Rechtsrahmen und den dortigen Kennzeichnungspraktiken (freiwillig und staatlich reguliert).
Was wird im Kapitel „GV-Lebensmittel im Freihandelsprojekt TTIP“ behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung der Kennzeichnungsfrage im Rahmen des TTIP-Abkommens. Es untersucht den Entstehungsprozess des Abkommens und analysiert potenzielle Vorteile und Herausforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse möglicher Konfliktthemen bezüglich der Kennzeichnung von GVO. Es schließt mit einem Ausblick auf mögliche Kennzeichnungsszenarien nach Inkrafttreten des Abkommens.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselwörter sind: Gentechnik, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), Lebensmittelkennzeichnung, TTIP, Freihandelsabkommen, EU, USA, transatlantischer Handel, ökonomische Aspekte, gesellschaftliche Akzeptanz, Risiken, Vorteile, Rechtsrahmen, Harmonisierung, Konfliktpotenzial.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln im Kontext des geplanten Freihandelsabkommens TTIP. Sie analysiert die unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Ansätze der EU und der USA und prognostiziert die Auswirkungen des TTIP auf die Kennzeichnungspraxis.
Details
- Titel
- Food with(out) GMO. Die Kennzeichnung "gentechnischer" Lebensmittel im Freihandelsprojekt der EU und der USA
- Untertitel
- Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und der Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP / TAFTA)
- Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
- Veranstaltung
- Volkswirtschaftslehre, Lebensmitteltechnologie, Recht, Außenpolitik, Welthandel, Verbraucherschutz
- Note
- 1,0
- Autor
- Ben Illesch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 79
- Katalognummer
- V266663
- ISBN (Buch)
- 9783656570752
- ISBN (eBook)
- 9783656570769
- Dateigröße
- 2761 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Gentechnisch veränderte Organismen GVO GMO Transatlantic Trade and Investment Partnership Transatlantic Free Trade Agreement TTIP TAFTA VLOG Lebensmittel gentechnisch Gentechnik Verbraucherschutz EU Europa USA Freihandel Free Trade Grüne Gentechnik Kennzeichnung Freihandelszone Handelsbarrieren nicht-tarifäre Außenhandelstheorie Außenhandel Negativkennzeichnung Positivkennzeichnung NGO FFDCA FDA substanzielle Äquivalenz Monsanto Syngenta Bayer Crop genetisch verändert ohne Gentechnik Verbraucher Ethik Konsumenten Resistenz Herbizid Risiko ISAAA greenpeace gv gv-mais Mon 810 Sorten Patent Futtermittel GV-Lebensmittel Gen Nichtrückholbarkeit Kontmination Gesundheit Krankheit Saatgut Inverkehrbringen Landwirtschaft transgen herbizidresitenz roundup Soja Recht VO
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Ben Illesch (Autor:in), 2013, Food with(out) GMO. Die Kennzeichnung "gentechnischer" Lebensmittel im Freihandelsprojekt der EU und der USA, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/266663
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-