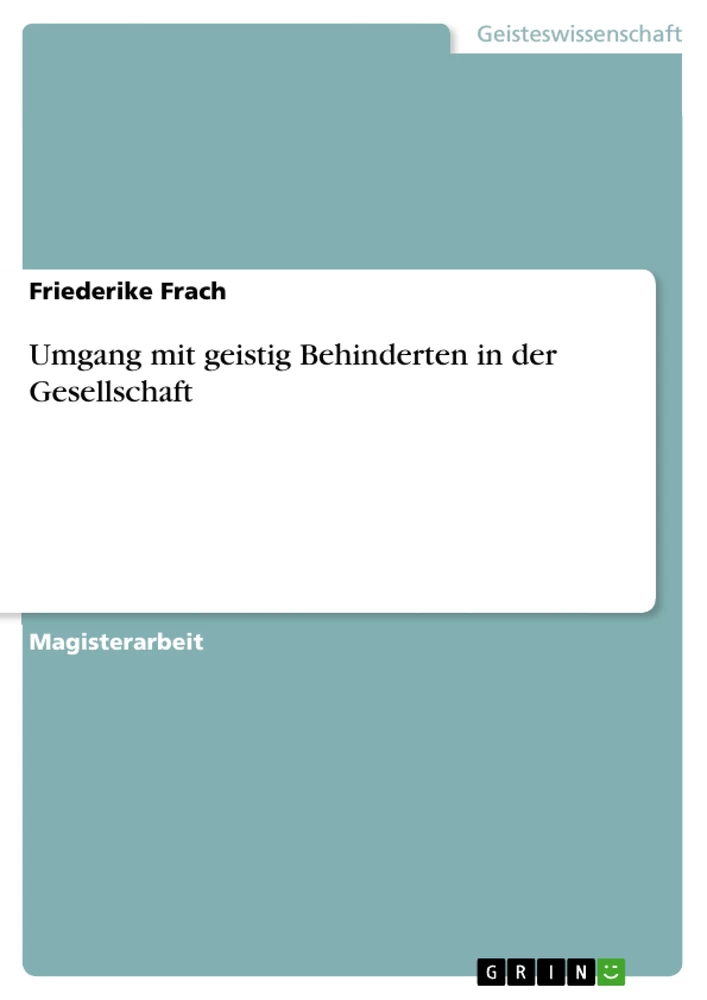
Umgang mit geistig Behinderten in der Gesellschaft
Magisterarbeit, 2003
92 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zur Etymologie des Begriffs Geistige Behinderung
- 1.1 Definition des Begriffs Behinderung
- 1.2 Verbale Kennzeichnung Geistiger Behinderung
- 2. Zur Geschichte des Umgangs mit geistig Behinderten im europäischen Kulturkreis
- 2.1 Die Urzeit
- 2.2 Mesopotamien
- 2.3 Das Alte Ägypten
- 2.4 Griechische Antike
- 2.5 Römisches Reich
- 2.6 Frühes Christentum
- 2.7 Das Mittelalter
- 2.8 Renaissance
- 2.9 Aufklärung
- 2.10 Industrialisierung
- 2.11 20. Jahrhundert
- 3. Die Anderen und das Anderssein. Über den Umgang mit geistig Behinderten in verschiedenen Religionen und Ethnien
- 3.1 Afrika
- 3.1.1 Beispiel Senegal
- 3.2 Amerika
- 3.2.1 Indianische Kulturen
- 3.3 Asien
- 3.3.1 Hinduismus am Beispiel Indien
- 3.3.2 Buddhismus
- 3.3.3 Buddhisten, Christen und Konfuzianer in Süd-Korea
- 3.3.4 Judentum
- 3.3.5 Islam - angesiedelt sowohl in Asien als auch in Nordafrika
- 3.4 Australien
- 3.4.1 Polynesische Kulturen am Beispiel Tonga
- 3.4.2 Polynesische Kulturen am Beispiel Samoa
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.1 Afrika
- 4. Zum Umgang mit Geistiger Behinderung heute. Einstellungen und Verhalten gegenüber geistig Behinderten in der westlichen Kultur
- 5. Bundesrepublik Deutschland
- 5.1 Geistig behinderte Kinder
- 5.1.1 Der Elementarbereich
- 5.1.2 Während der Schulzeit
- 5.2 Geistig behinderte Jugendliche und Erwachsene
- 5.2.1 Zur Wohnsituation
- 5.2.2 Das Arbeitsleben
- 5.2.3 Freizeit im Leben geistig behinderter Menschen
- 5.1 Geistig behinderte Kinder
- 6. Erfahrungen: Der Blick von Innen
- 6.1 Kreative Freizeitgestaltung
- 6.2 Produktives Reisen
- 6.3 Texte und Bilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Umgang mit geistig behinderten Menschen in der Gesellschaft, sowohl historisch als auch im gegenwärtigen Kontext. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Einstellungen und des Verhaltens gegenüber geistig Behinderten zu geben und den "Blick von außen" mit den Erfahrungen Betroffener zu verbinden.
- Historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung
- Kulturelle und religiöse Perspektiven auf geistige Behinderung
- Die Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
- Integrative Projekte und der Versuch der Normalisierung
- Perspektiven der Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die oft unbewusste Vermeidung von Kontakt mit geistig behinderten Menschen in der heutigen Gesellschaft und führt integrative Projekte als Gegenbeispiel an. Sie betont die Notwendigkeit der Normalisierung und verweist auf die eigene Forschungsarbeit, die den "Blick von außen" mit dem Erleben der Betroffenen verbindet, unterstützt durch eine Videodokumentation des Theaterprojekts "RAMBA ZAMBA".
1. Zur Etymologie des Begriffs Geistige Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Behinderung und der sprachlichen Entwicklung des Begriffs "geistige Behinderung". Es analysiert die semantische Entwicklung und die damit verbundenen gesellschaftlichen Konnotationen.
2. Zur Geschichte des Umgangs mit geistig Behinderten im europäischen Kulturkreis: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden historischen Überblick, der vom Umgang mit geistig Behinderten in der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert reicht. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Praktiken in verschiedenen Epochen und Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom, Frühchristentum, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung und Industrialisierung), um die Wandlung der gesellschaftlichen Sichtweise zu dokumentieren. Der Fokus liegt auf den jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Konzepten von Normalität und Abweichung.
3. Die Anderen und das Anderssein: Dieses Kapitel erforscht den Umgang mit geistiger Behinderung in verschiedenen Religionen und Ethnien weltweit. Es präsentiert Fallstudien aus Afrika (Senegal), Amerika (indianische Kulturen), Asien (Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Judentum, Islam) und Australien (polynesische Kulturen), um ein differenziertes Bild der vielfältigen kulturellen Perspektiven und Praktiken zu liefern und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Der Vergleich der verschiedenen Kulturen und ihrer Ansätze verdeutlicht die relative Natur von Konzepten von „Normalität“ und „Anderssein“.
4. Zum Umgang mit Geistiger Behinderung heute: Dieses Kapitel analysiert die aktuellen Einstellungen und das Verhalten gegenüber geistig behinderten Menschen in der westlichen Kultur. Es untersucht die Veränderungen und Kontinuitäten im Umgang mit geistiger Behinderung im Vergleich zu historischen Perspektiven. Es wird der aktuelle Stand der Integration, die Herausforderungen und die notwendigen Veränderungen beleuchtet.
5. Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht die Situation von Kindern im Elementarbereich und während der Schulzeit, sowie die Wohnsituation, die Arbeitsbedingungen und die Freizeitgestaltung von Jugendlichen und Erwachsenen. Der Fokus liegt auf der Integration und den Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Inklusion, Exklusion, Geschichte, Kultur, Religion, Ethnie, Bundesrepublik Deutschland, Integration, Normalisierung, Lebensqualität, Teilhabe, Gesellschaft, Einstellungen, Verhalten, Erfahrungen, Betroffene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Umgang mit Geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht umfassend den Umgang mit geistig behinderten Menschen in der Gesellschaft – historisch betrachtet und im aktuellen Kontext. Sie verbindet den "Blick von außen" (gesellschaftliche Perspektiven) mit den Erfahrungen Betroffener, um ein ganzheitliches Bild zu liefern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung in verschiedenen Kulturen und Epochen (von der Urzeit bis zur Gegenwart), kulturelle und religiöse Perspektiven auf geistige Behinderung weltweit, die aktuelle Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland (inkl. Kinder, Jugendliche und Erwachsene), integrative Projekte und den Prozess der Normalisierung sowie die Perspektiven der Betroffenen selbst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Etymologie des Begriffs "Geistige Behinderung", Historischer Umgang mit geistiger Behinderung im europäischen Kulturkreis, Umgang mit geistiger Behinderung in verschiedenen Religionen und Ethnien weltweit, Umgang mit geistiger Behinderung in der heutigen westlichen Kultur (mit Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland) und schließlich die Erfahrungen Betroffener ("Der Blick von Innen"). Jedes Kapitel bietet detaillierte Analysen und Fallstudien.
Wie wird die historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung dargestellt?
Die Arbeit zeichnet einen umfassenden historischen Überblick nach, beginnend bei der Urzeit und reichend bis ins 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet verschiedene Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom usw.) und Epochen (Frühchristentum, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Industrialisierung), um die Wandlung der gesellschaftlichen Sichtweise auf geistige Behinderung aufzuzeigen und die jeweiligen kulturellen Konzepte von Normalität und Abweichung zu analysieren.
Wie werden kulturelle und religiöse Perspektiven berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht den Umgang mit geistiger Behinderung in diversen Religionen und Ethnien weltweit. Sie präsentiert Fallstudien aus Afrika, Amerika, Asien und Australien, um die Vielfalt kultureller Perspektiven und Praktiken zu zeigen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die relative Natur von Konzepten wie "Normalität" und "Anderssein" zu verdeutlichen.
Wie wird die Situation in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt?
Das Kapitel zur Bundesrepublik Deutschland konzentriert sich auf die Situation geistig behinderter Menschen in Deutschland, untersucht die Lebenssituation von Kindern (Elementarbereich und Schule), Jugendlichen und Erwachsenen (Wohnsituation, Arbeit, Freizeit) und beleuchtet die Integration und Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben.
Welche Rolle spielen die Erfahrungen Betroffener?
Die Arbeit integriert explizit die Perspektive der Betroffenen ("Der Blick von Innen"). Sie präsentiert beispielsweise kreative Freizeitgestaltung, Erfahrungen mit Reisen und persönliche Texte und Bilder, um ein authentisches und umfassendes Bild zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Inklusion, Exklusion, Geschichte, Kultur, Religion, Ethnie, Bundesrepublik Deutschland, Integration, Normalisierung, Lebensqualität, Teilhabe, Gesellschaft, Einstellungen, Verhalten, Erfahrungen, Betroffene.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert historische Analysen mit aktuellen Studien und Fallbeispielen. Sie integriert qualitative Daten (z.B. Interviews, persönliche Berichte) mit quantitativen Daten, um ein umfassendes Bild zu zeichnen. Die Verbindung von "Blick von außen" und den Erfahrungen Betroffener ist ein zentrales Merkmal der Methodik.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen sind im detaillierten Inhaltsverzeichnis der Arbeit enthalten, welches Einleitung, Kapitelübersichten und Schlüsselwörter auflistet. Zusätzlich wird auf eine Videodokumentation eines Theaterprojekts verwiesen.
Details
- Titel
- Umgang mit geistig Behinderten in der Gesellschaft
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Kulturwissenschaften)
- Note
- 1,0
- Autor
- Friederike Frach (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 92
- Katalognummer
- V26766
- ISBN (eBook)
- 9783638290081
- ISBN (Buch)
- 9783640191611
- Dateigröße
- 2165 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Auch für Rehabilitationswissenschaften interessant. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus der schriftlich-theoretischen Arbeit, zum anderen aus einer Videodokumentation über eine Theatergruppe aus Berlin. Es handelt sich um die Gruppe "Ramba Zamba", deren Darsteller geistig behindert sind. Der Film ermöglicht einen sehr speziellen Blick auf das Thema "geistige Behinderung". Achtung! Das Videomaterial ist im Lieferumfang der Arbeit nicht inbegriffen. Auch für Rehabilitationswissenschaften interessant.
- Schlagworte
- Umgang Behinderten Gesellschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- Friederike Frach (Autor:in), 2003, Umgang mit geistig Behinderten in der Gesellschaft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/26766
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









