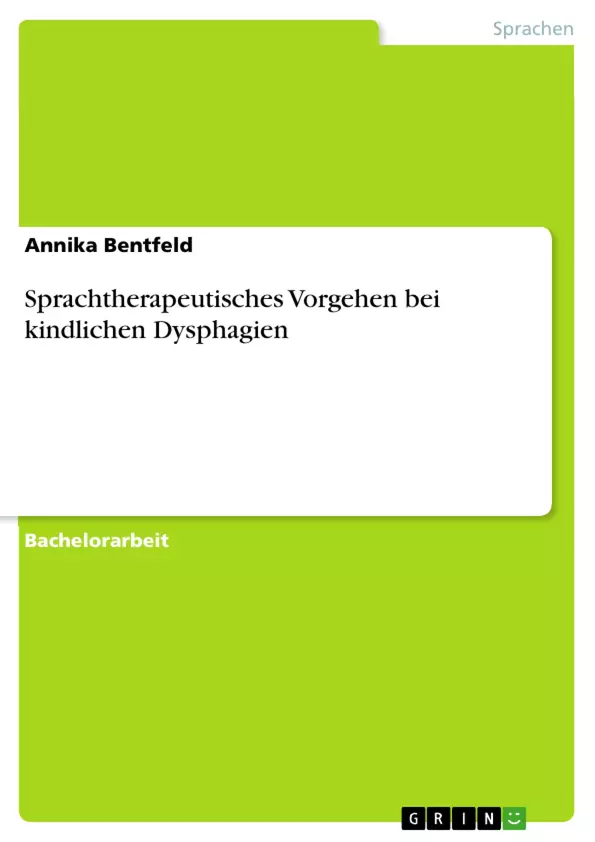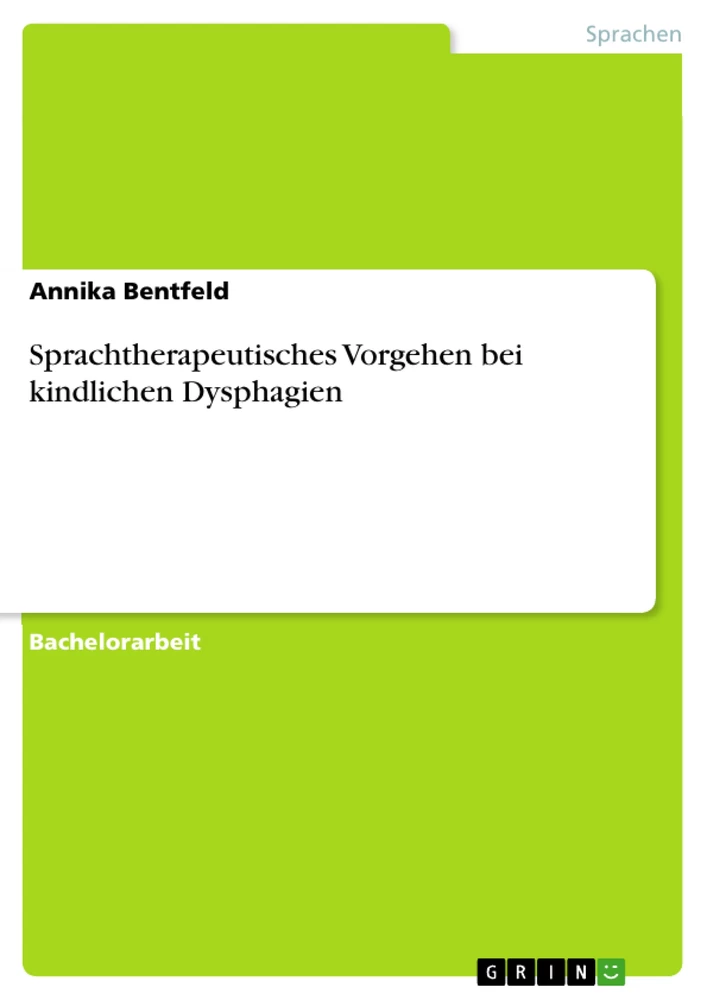
Sprachtherapeutisches Vorgehen bei kindlichen Dysphagien
Bachelorarbeit, 2013
41 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindliche Dysphagien
- Ursachen einer kindlichen Dysphagie
- Symptome einer kindlichen Dysphagie
- Abgrenzung einer kindlichen Dysphagie von einer Fütterstörung
- Die Behandlung von kindlichen Dysphagien
- Die orofaziale Regulationstherapie nach Castillo Morales
- Die neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan
- Das Bobath Konzept
- F.O.T.T. - Therapie des Facio-Oralen Trakts
- Das Pömbacher Therapiekonzept
- Mund- und Esstherapie nach Morris und Klein
- Die Rolle der Eltern in der Behandlung von kindlichen Dysphagien
- Fragestellung
- Kindliche Dysphagien
- Methode
- Ergebnisse
- Schluck für Schluck: Vergleich von drei Einzelfalldokumentationen zum Dysphagiemanagement bei Kindern
- Evaluating service delivery for speech and swallowing problems following paediatric brain injury: an international survey
- Case Studies in Dysphagia after Pediatric Brain Injury
- Specialist Speech Therapy in Poland in Children With Feeding and Swallowing Disorders
- Rehabilitation of Oropharyngeal Dysphagia in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review of the Speech Therapy Approach
- Zusammenfassung
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem sprachtherapeutischen Vorgehen bei kindlichen Dysphagien. Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema zu geben und ein mögliches Vorgehen bei der Behandlung einer kindlichen Dysphagie zu entwickeln. Die Arbeit fokussiert dabei auf die verschiedenen Therapiemethoden und -konzepte, die in der Praxis Anwendung finden.
- Ursachen und Symptome kindlicher Dysphagien
- Verschiedene Therapiemethoden und -konzepte
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Behandlung
- Evidenzbasierte Praxis in der Dysphagietherapie
- Rolle der Eltern in der Behandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der kindlichen Dysphagien vor und erläutert die verschiedenen Ursachen und Symptome, die bei Kindern auftreten können. Darüber hinaus wird die Abgrenzung zu Fütterstörungen diskutiert und die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Behandlung hervorgehoben.
Im Kapitel "Methode" wird die Vorgehensweise der Literaturrecherche beschrieben, die zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen wurde. Es werden die verwendeten Datenbanken und Suchbegriffe sowie die Auswahlkriterien für die relevanten Publikationen erläutert.
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den untersuchten Studien zusammengefasst und die verschiedenen Therapiemethoden und -konzepte, die bei der Behandlung von kindlichen Dysphagien Anwendung finden, vorgestellt.
In der Diskussion werden die Ergebnisse der Literaturrecherche kritisch beleuchtet und die Herausforderungen bei der Auswahl einer geeigneten Therapiemethode für kindliche Dysphagien diskutiert. Es wird auf die Bedeutung der evidenzbasierten Praxis, der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Einbeziehung der Eltern in die Behandlung hingewiesen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen kindliche Dysphagien, sprachtherapeutisches Vorgehen, Therapiemethoden, interdisziplinäre Zusammenarbeit, evidenzbasierte Praxis, Rolle der Eltern, Fütterstörungen, Schluckstörungen, orofaziale Regulationstherapie nach Castillo Morales, neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan, Bobath Konzept, F.O.T.T. - Therapie des Facio-Oralen Trakts, Pömbacher Therapiekonzept, Mund- und Esstherapie nach Morris und Klein.
Details
- Titel
- Sprachtherapeutisches Vorgehen bei kindlichen Dysphagien
- Hochschule
- Technische Universität Dortmund
- Veranstaltung
- Sprachtherapie
- Note
- 1,7
- Autor
- Annika Bentfeld (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V267788
- ISBN (eBook)
- 9783656582830
- ISBN (Buch)
- 9783656583622
- Dateigröße
- 1163 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kindliche Dysphagie Schluckstörung therapeutisches Vorgehen Dysphagie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Annika Bentfeld (Autor:in), 2013, Sprachtherapeutisches Vorgehen bei kindlichen Dysphagien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/267788
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-