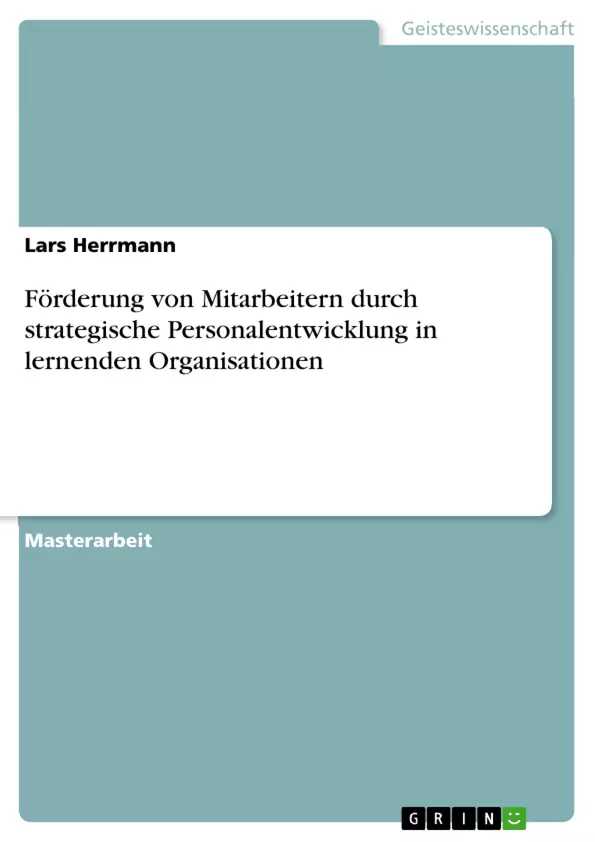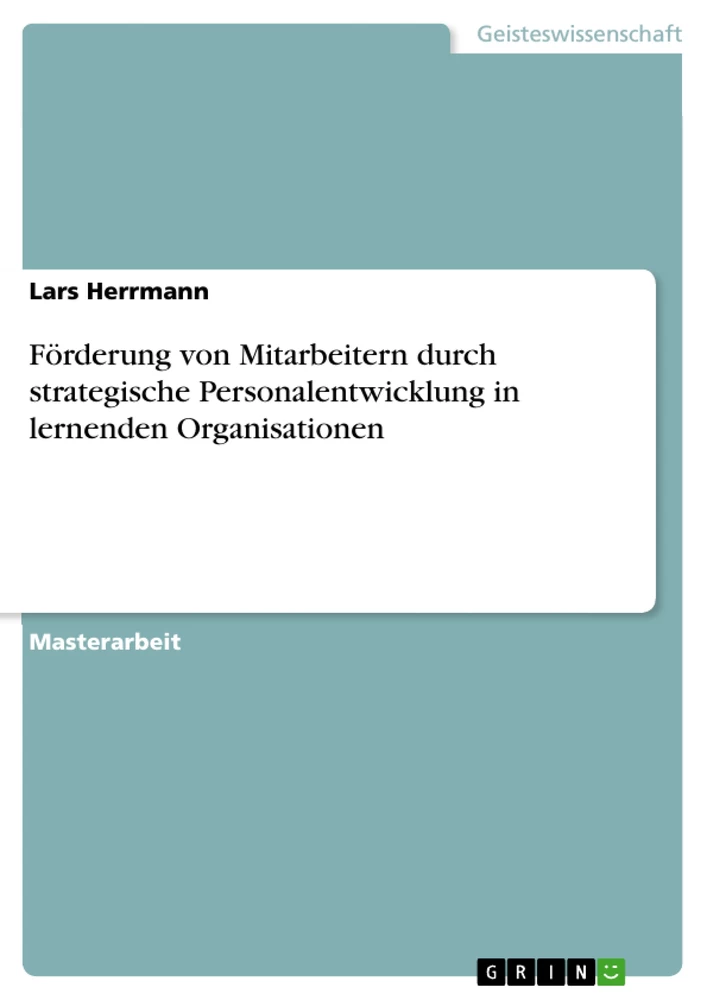
Förderung von Mitarbeitern durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen
Masterarbeit, 2014
74 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau und Thematik der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung und Fokus der Arbeit
- 1.3 Methodik und Gliederung der Arbeit
- 2. Personalentwicklung
- 2.1 Definition und Inhalte der Personalentwicklung
- 2.1.1 Arten von Mitarbeiterförderung
- 2.1.2 Personalentwicklung und Mitarbeiterförderung
- 2.1.3 Faktoren der Mitarbeiterförderung
- 2.1.4 Der Faktor Mensch
- 2.2 Definition und Inhalte der strategischen Personalentwicklung
- 2.2.1 Förderungsstrategien von Mitarbeitern
- 2.2.2 Gegenseitige Zielbestimmungen und Zielbeziehungen
- 2.3 Aufgaben und Inhalte der Mitarbeiterförderung
- 2.4 Definition und Aspekte der lernenden Organisation
- 3. Ziele der Mitarbeiterförderung
- 3.1 Weiterentwicklung der Beschäftigten
- 3.1.1 Stärken der Allgemeinbildung und Erwerb von Schlüsselqualifikationen
- 3.1.2 Beschäftigungsfähigkeit bzw. Employabilität
- 3.2 Erfolgreiche Positionierung des Unternehmens auf dem Markt
- 3.2.1 Zielorientiertes Personalmanagement
- 3.2.2 High Performance HR
- 3.3 Entwicklung und Sicherung von Human Resource Kompetenzen
- 3.3.1 Human Resource Management
- 3.3.2 Kompetenzmanagement
- 3.3.3 Talentmanagement
- 4. Herausforderungen an die Organisation und Mitarbeiter
- 4.1 Aktuelle Rahmenbedingungen
- 4.1.1 Demografischer Wandel
- 4.1.2 Globalisierung
- 4.1.3 Diskontinuität und Wandel der Erwerbsgesellschaft
- 4.2 Organisationale Fähigkeiten
- 4.2.1 Führungskräfteentwicklung
- 4.2.2 Energiemanagement der Organisation
- 4.3 Nachhaltigkeit von Maßnahmen
- 4.4 Change Management, Lernkultur und Lernkulturwandel
- 5. Förderung, strategische Personalentwicklung, lernende Organisation
- 5.1 Wie kann zielgerichtete und nachhaltige Mitarbeiterförderung aussehen?
- 5.2 Einflussfaktoren der strategischen Personalentwicklung
- 5.2.1 Befähigung der Befähiger
- 5.2.2 Talentmanagement als ganzheitlicher Prozess
- 5.2.3 Motivationsaspekte erkennen, benennen und anwenden
- 5.2.4 Durchführung konsequenten Wandels mittels Change Management
- 5.2.5 Commitment
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Wettbewerbsfähigkeit
- 6.2 Nachhaltigkeit
- 6.3 Strategische Personalentwicklung - unabdingbare Managementaufgabe
- 6.4 Win-Win-Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Förderung von Mitarbeitern durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen strategischer Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung und der Lernkultur in Organisationen aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige und zielgerichtete Mitarbeiterförderung zu entwickeln.
- Strategische Personalentwicklung als Instrument der Mitarbeiterförderung
- Die Rolle der Lernenden Organisation für die Mitarbeiterentwicklung
- Herausforderungen durch demografischen Wandel, Globalisierung und gesellschaftlichen Wandel
- Nachhaltigkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine effektive Mitarbeiterförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Mitarbeiterförderung durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen ein. Es beschreibt den Aufbau und die Thematik der Arbeit, die Zielsetzung und den Fokus sowie die Methodik und Gliederung.
2. Personalentwicklung: Dieses Kapitel definiert Personalentwicklung und strategische Personalentwicklung und beschreibt deren Inhalte. Es beleuchtet verschiedene Arten der Mitarbeiterförderung, die beteiligten Faktoren (insbesondere den Faktor Mensch) und die Bedeutung von Zielbeziehungen. Die Definition und Aspekte der lernenden Organisation werden ebenfalls eingeführt, um den Kontext der Arbeit zu setzen.
3. Ziele der Mitarbeiterförderung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zielen der Mitarbeiterförderung, unterteilt in die Weiterentwicklung der Beschäftigten (Stärkung der Allgemeinbildung, Erwerb von Schlüsselqualifikationen, Förderung der Employabilität), die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens am Markt (durch zielorientiertes Personalmanagement und High-Performance-HR) und die Entwicklung und Sicherung von Human-Resource-Kompetenzen (Human Resource Management, Kompetenzmanagement und Talentmanagement).
4. Herausforderungen an die Organisation und Mitarbeiter: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen an Organisationen und Mitarbeiter im Kontext der Mitarbeiterförderung. Es werden aktuelle Rahmenbedingungen wie der demografische Wandel, die Globalisierung und der Wandel der Erwerbsgesellschaft beleuchtet, und die Bedeutung von organisationalen Fähigkeiten (Führungskräfteentwicklung, Energiemanagement) und der Nachhaltigkeit von Maßnahmen sowie der Rolle von Change Management und Lernkultur diskutiert.
5. Förderung, strategische Personalentwicklung, lernende Organisation: Das Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterförderung, strategischer Personalentwicklung und der lernenden Organisation. Es beleuchtet Einflussfaktoren wie die Befähigung der Befähiger, Talentmanagement als ganzheitlichen Prozess, Motivationsaspekte, Change Management und Commitment und zeigt Wege auf, wie eine zielgerichtete und nachhaltige Mitarbeiterförderung gestaltet werden kann.
Schlüsselwörter
Strategische Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung, lernende Organisation, Talentmanagement, Kompetenzmanagement, Nachhaltigkeit, Change Management, demografischer Wandel, Globalisierung, Employabilität, High-Performance-HR.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Strategische Personalentwicklung in Lernenden Organisationen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Förderung von Mitarbeitern durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen strategischer Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung und Lernkultur und entwickelt Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige und zielgerichtete Mitarbeiterförderung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: Strategische Personalentwicklung als Instrument der Mitarbeiterförderung, die Rolle der lernenden Organisation für die Mitarbeiterentwicklung, Herausforderungen durch demografischen Wandel, Globalisierung und gesellschaftlichen Wandel, Nachhaltigkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine effektive Mitarbeiterförderung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Aufbau, Zielsetzung, Methodik), Personalentwicklung (Definitionen, Inhalte, Arten der Mitarbeiterförderung, lernende Organisation), Ziele der Mitarbeiterförderung (Weiterentwicklung der Beschäftigten, Unternehmenspositionierung, Entwicklung von Human Resource Kompetenzen), Herausforderungen an Organisation und Mitarbeiter (Rahmenbedingungen, organisationale Fähigkeiten, Nachhaltigkeit, Change Management), Förderung, strategische Personalentwicklung, lernende Organisation (Zusammenhänge, Einflussfaktoren, Gestaltung einer nachhaltigen Mitarbeiterförderung) und Ergebnisse (Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, strategische Personalentwicklung als Managementaufgabe, Win-Win-Situation).
Was wird unter strategischer Personalentwicklung verstanden?
Die Arbeit definiert und beschreibt strategische Personalentwicklung als ein Instrument zur Mitarbeiterförderung, das eng mit der Lernkultur der Organisation verbunden ist. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte wie Förderungsstrategien, Zielbeziehungen und deren Einfluss auf die Mitarbeiterentwicklung.
Welche Rolle spielt die lernende Organisation?
Die lernende Organisation bildet den Kontext der Arbeit. Die Arbeit untersucht, wie die Prinzipien und Eigenschaften einer lernenden Organisation die Mitarbeiterförderung und die Wirksamkeit der strategischen Personalentwicklung beeinflussen.
Welche Herausforderungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert Herausforderungen wie den demografischen Wandel, die Globalisierung und den Wandel der Erwerbsgesellschaft. Sie untersucht den Einfluss dieser Faktoren auf die Gestaltung und Nachhaltigkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen und die Bedeutung von organisationalen Fähigkeiten wie Führungskräfteentwicklung und Energiemanagement.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit entwickelt Handlungsempfehlungen für eine effektive und nachhaltige Mitarbeiterförderung, die die Zusammenhänge zwischen strategischer Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung und Lernkultur berücksichtigen. Diese Empfehlungen beziehen die analysierten Herausforderungen und Einflussfaktoren mit ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strategische Personalentwicklung, Mitarbeiterförderung, lernende Organisation, Talentmanagement, Kompetenzmanagement, Nachhaltigkeit, Change Management, demografischer Wandel, Globalisierung, Employabilität, High-Performance-HR.
Welche Ziele werden mit der Mitarbeiterförderung verfolgt?
Die Ziele umfassen die Weiterentwicklung der Beschäftigten (Stärkung der Allgemeinbildung, Schlüsselqualifikationen, Employabilität), die erfolgreiche Marktpositionierung des Unternehmens (zielorientiertes Personalmanagement, High-Performance-HR) und die Entwicklung und Sicherung von Human-Resource-Kompetenzen (Human Resource Management, Kompetenzmanagement, Talentmanagement).
Wie wird die Nachhaltigkeit von Maßnahmen sichergestellt?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen und untersucht Faktoren, die zu einer langfristigen Wirkung beitragen. Dies beinhaltet Aspekte wie Change Management, Lernkultur und die Berücksichtigung der organisationalen Fähigkeiten.
Details
- Titel
- Förderung von Mitarbeitern durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen
- Hochschule
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Distance and Independent Studies Center (DISC))
- Veranstaltung
- Human Resources - Personalentwicklung
- Note
- 1,3
- Autor
- Lars Herrmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 74
- Katalognummer
- V269007
- ISBN (Buch)
- 9783656593577
- ISBN (eBook)
- 9783656593584
- Dateigröße
- 712 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Arbeit betrachtet unter Einbezug ausgewählter aktueller Rahmenbedingungen, die ‚Förderung von Mitarbeitern‘ aus verschiedenen Blickwinkeln. Besonderheiten, Chancen, Handlungsoptionen werden aufgezeigt, die sich bei konsequenter Anwendung der Möglichkeiten einer strategischen Personalentwicklung aus dem Themenkomplex der Mitarbeiterförderung zugleich für Beschäftigte und Unternehmen ergeben können. Es wird insbesondere auf die Vorteile in der Praxis, für Organisationen und Beschäftigte eingegangen und dargelegt, warum es in Zeiten des Fachkräftemangels kaum noch Alternativen dazu gibt.
- Schlagworte
- förderung mitarbeitern personalentwicklung organisationen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 25,99
- Preis (Book)
- US$ 36,99
- Arbeit zitieren
- Lars Herrmann (Autor:in), 2014, Förderung von Mitarbeitern durch strategische Personalentwicklung in lernenden Organisationen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/269007
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-