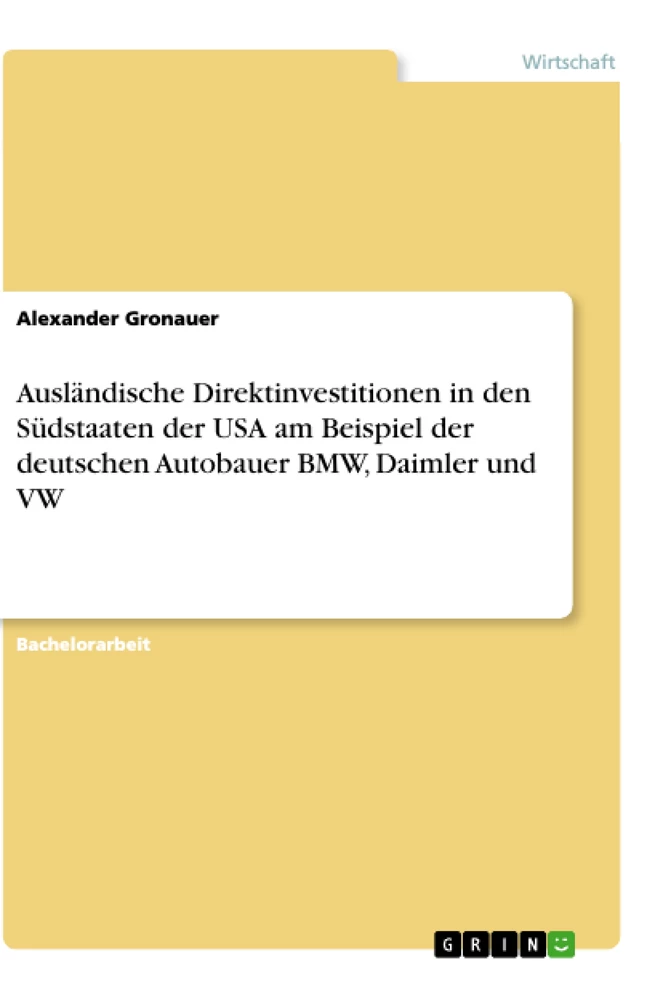
Ausländische Direktinvestitionen in den Südstaaten der USA am Beispiel der deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW
Bachelorarbeit, 2013
39 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Ausländische Direktinvestition (Foreign Direct Investment)
- Definition
- Motive
- Mikroökonomische Betrachtung
- Makroökonomische Betrachtung
- Zusammenhang mit der Globalisierung
- Aktueller Status
- Standortwahl
- Warum USA?
- Standortfaktoren der Südstaaten
- Rolle der Gewerkschaften (organized labor)
- Bemühungen der Autobauer am US-Markt
- Betrachtung des US-Automarkts
- Produktpolitik deutscher Autobauer
- Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- Veränderungen in den Südstaaten der USA durch FDI deutscher Autobauer
- Ökonomische Veränderungen
- Politische Auswirkungen
- Gesellschaftspolitische Veränderungen
- Reformierung der Ausbildung
- Strukturelle Veränderungen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) deutscher Autobauer in den Südstaaten der USA. Sie analysiert die Motive für diese Investitionen, die Standortfaktoren, die Auswirkungen auf die Region und die Bedeutung der Globalisierung für diese Prozesse.
- Die Bedeutung von FDI für die deutsche Wirtschaft und die internationale Präsenz deutscher Unternehmen
- Die Standortwahl der deutschen Autobauer in den Südstaaten der USA
- Die Auswirkungen von FDI auf die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft der Südstaaten
- Die Rolle der Globalisierung und der Wettbewerbssituation im US-Automarkt
- Die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz für die deutschen Autobauer in den USA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, das Ziel der Arbeit und den Aufbau erläutert. Anschließend wird der Begriff der Ausländischen Direktinvestition (FDI) definiert und die Motive, die Mikro- und Makroökonomischen Betrachtungsweisen sowie die Beziehung zur Globalisierung diskutiert.
Im dritten Kapitel wird die Standortwahl analysiert, wobei die Attraktivität der USA im Allgemeinen und der Südstaaten im Besonderen beleuchtet werden. Die Rolle der Gewerkschaften wird dabei ebenfalls berücksichtigt. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Bemühungen der deutschen Autobauer am US-Markt, einschließlich der Betrachtung des US-Automarkts, der Produktpolitik und der Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Das fünfte Kapitel untersucht die Veränderungen in den Südstaaten der USA durch FDI deutscher Autobauer. Hier werden ökonomische, politische, gesellschaftspolitische und strukturelle Auswirkungen analysiert.
Schlüsselwörter
Ausländische Direktinvestitionen, FDI, deutsche Autobauer, BMW, Daimler, VW, Südstaaten der USA, Standortwahl, Globalisierung, US-Automarkt, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ökonomische Auswirkungen, Politische Auswirkungen, Gesellschaftspolitische Auswirkungen, Reformierung der Ausbildung, Strukturelle Veränderungen.
Details
- Titel
- Ausländische Direktinvestitionen in den Südstaaten der USA am Beispiel der deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW
- Hochschule
- Fachhochschule Südwestfalen; Abteilung Meschede
- Note
- 2,3
- Autor
- Alexander Gronauer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V269013
- ISBN (Buch)
- 9783656604235
- ISBN (eBook)
- 9783656604259
- Dateigröße
- 962 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- CD nicht im Lieferumfang enthalten
- Schlagworte
- FDI Foreign Direct Investment Ausländische Direktinvestition USA BMW Daimler VW Südstaaten Globalisierung Investition incentives organized labor Automarkt Produktpolitik Ausbildung Reformierung Gewerkschaften UAW
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Alexander Gronauer (Autor:in), 2013, Ausländische Direktinvestitionen in den Südstaaten der USA am Beispiel der deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/269013
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-



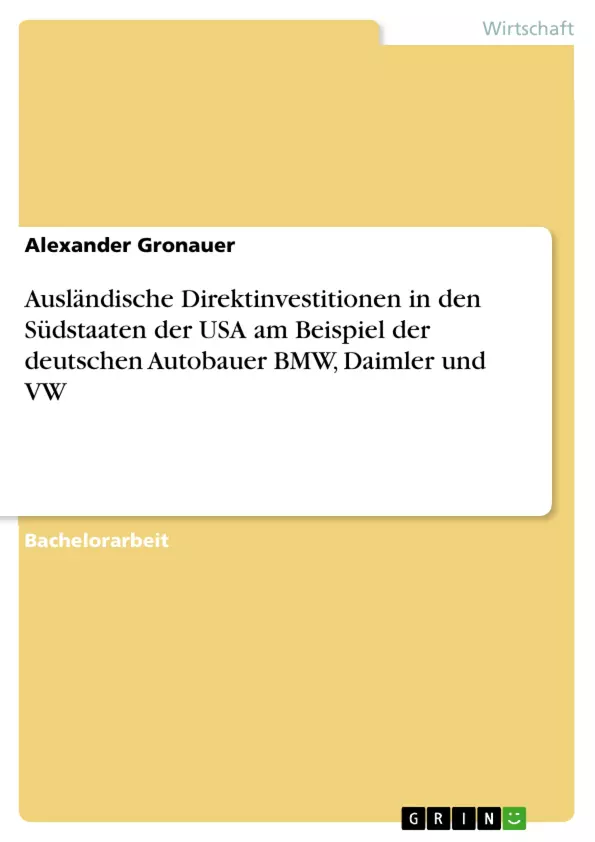






Kommentare