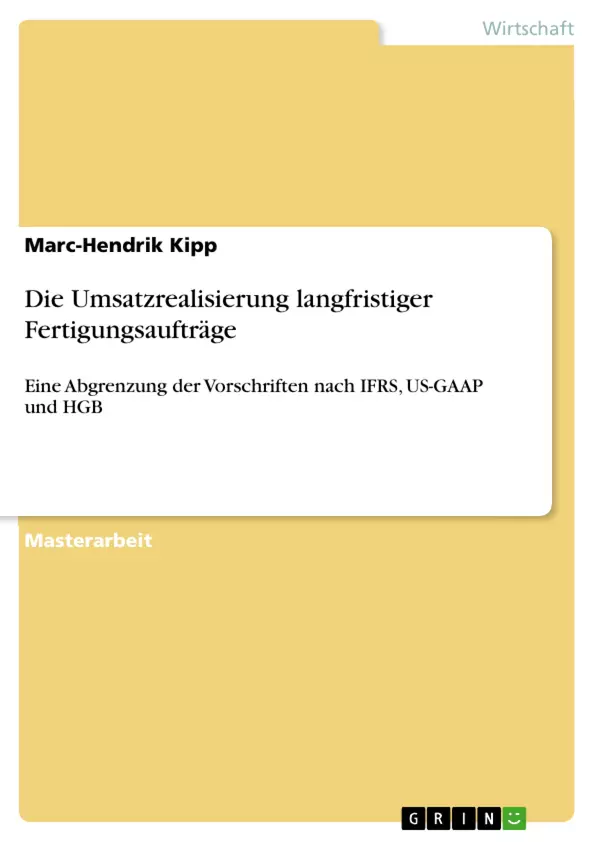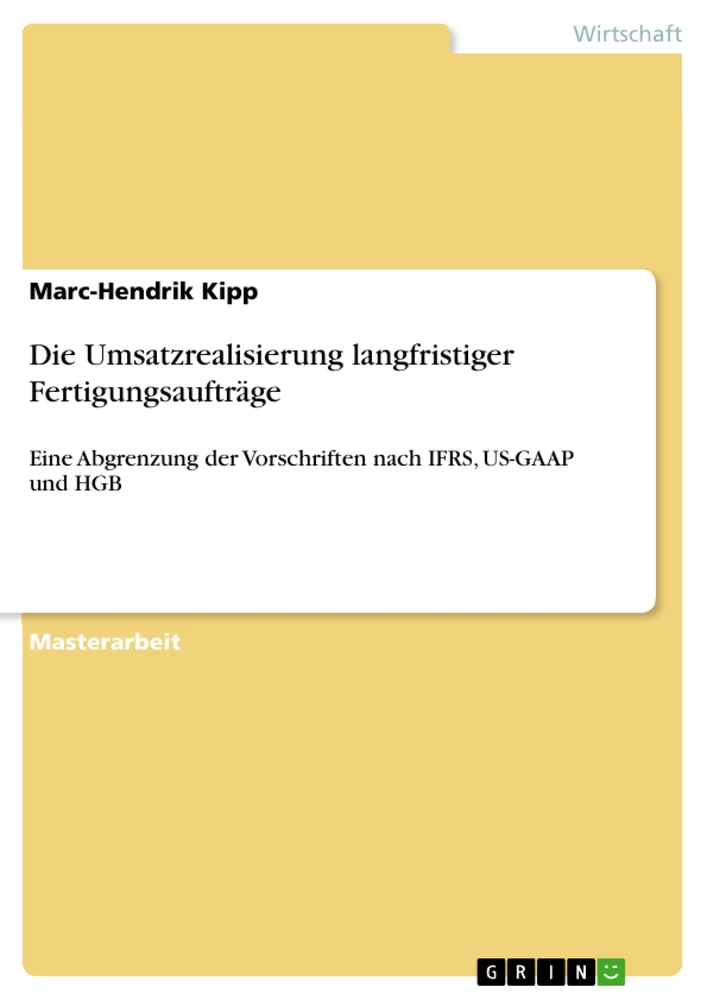
Die Umsatzrealisierung langfristiger Fertigungsaufträge
Masterarbeit, 2013
58 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Historische und politische Einordnung
1.2 Definition von Fertigungsaufträgen
1.3 Problemstellung: Bewertung mehrperiodischer Fertigungsaufträge
2 Umsatzrealisierung von Fertigungsaufträgen
2.1 Nach HGB
2.1.1 Completed-Contract-Methode (CCM)
2.1.1.1 Rechtliche Einordnung
2.1.1.2 Selbstkostenansatz
2.1.1.3 Verlustantizipation
2.1.1.4 Exkurs: Möglichkeit der Teilgewinnrealisierung nach HGB
2.1.1.5 Zusammenfassung
2.2 Nach IFRS
2.2.1 Percentage-of-Completion-Methode (PoCM)
2.2.1.1 Definition
2.2.1.2 Anwendungsvoraussetzungen
2.2.1.3 Bestimmung der zu berücksichtigenden Auftragserlöse
2.2.1.3.1 Exkurs: fair value und Wahrscheinlichkeitsbegriff
2.2.1.4 Bestimmung der geplanten und angefallenen Auftragskosten
2.2.1.5 Ermittlung des Fertigstellungsgrades
2.2.1.5.1 Inputorientierte Verfahren
2.2.1.5.2 Outputorientierte Verfahren
2.2.1.6 Teilgewinnrealisierung und Verlustantizipation bei cost-to-cost Methode
2.2.1.7 Segmentierung und Zusammenfassung von Verträgen
2.2.1.8 Exkurs: Beispielrechnung und Darstellung in der Bilanz
2.2.2 Zero-Profit-Margin -Methode
2.3 Ausblick und zukünftige Entwicklungen
2.4 Abgrenzung der IFRS zu den US-GAAP
2.4.1 Gemeinsamkeiten zwischen IFRS und US-GAAP
2.4.1.1 Bilanzierung nach der PoCM
2.4.2 Unterschiede zwischen IFRS und US-GAAP
2.4.2.1 Erlaubte Anwendung der CCM
2.4.2.2 Bilanzierung von Joint Ventures / Shared Contracts
2.4.2.3 Bilanzierung von Vertragsänderungen
2.4.2.4 Bilanzierung von Vertragsoptionen
2.4.2.5 Bilanzierung von Claims
2.4.3 Vergleich und kritische Würdigung
2.5 Vergleich von HGB und IFRS
2.5.1 Definition von Fertigungsaufträgen
2.5.2 Berücksichtigung erwarteter Verluste
2.5.3 Gewinnrealisierung
3 Umsatzrealisierung eines Beispielauftrages
3.1 Ertragsrealisierung nach IFRS
3.2 Nach HGB
4 Kritische Würdigung und Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen CCM und PoCM?
Die Completed-Contract-Methode (CCM) realisiert Gewinne erst nach Fertigstellung, während die Percentage-of-Completion-Methode (PoCM) Gewinne anteilig nach Fertigstellungsgrad ausweist.
Wann wird die Percentage-of-Completion-Methode nach IFRS angewendet?
Sie wird angewendet, wenn das Ergebnis eines Fertigungsauftrags verlässlich geschätzt werden kann und bestimmte Voraussetzungen zum Fertigstellungsgrad erfüllt sind.
Wie wird der Fertigstellungsgrad bei Langzeitaufträgen ermittelt?
Es gibt inputorientierte Verfahren (z.B. Cost-to-Cost) und outputorientierte Verfahren (z.B. Meilensteine), um den Fortschritt zu messen.
Was ist die Zero-Profit-Margin-Methode?
Wenn das Ergebnis eines Auftrags nicht verlässlich geschätzt werden kann, werden Erlöse nur in Höhe der angefallenen Kosten erfasst, sodass kein Gewinn entsteht.
Wie unterscheidet sich das HGB von den IFRS bei Fertigungsaufträgen?
Das HGB folgt primär dem Realisationsprinzip (Gewinn erst bei Abnahme), während IFRS durch die PoCM eine zeitnähere Information der Investoren anstrebt.
Details
- Titel
- Die Umsatzrealisierung langfristiger Fertigungsaufträge
- Untertitel
- Eine Abgrenzung der Vorschriften nach IFRS, US-GAAP und HGB
- Hochschule
- Fachhochschule Bielefeld
- Note
- 1,3
- Autor
- Marc-Hendrik Kipp (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V270976
- ISBN (Buch)
- 9783656634935
- ISBN (eBook)
- 9783656634966
- Dateigröße
- 807 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- IFRS IAS HGB Rechnungslegung Anlagenbau Fertigungsaufträge US-GAAP Jahresabschluss POC Percentage of Completion Completed Contract
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- Marc-Hendrik Kipp (Autor:in), 2013, Die Umsatzrealisierung langfristiger Fertigungsaufträge, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/270976
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-