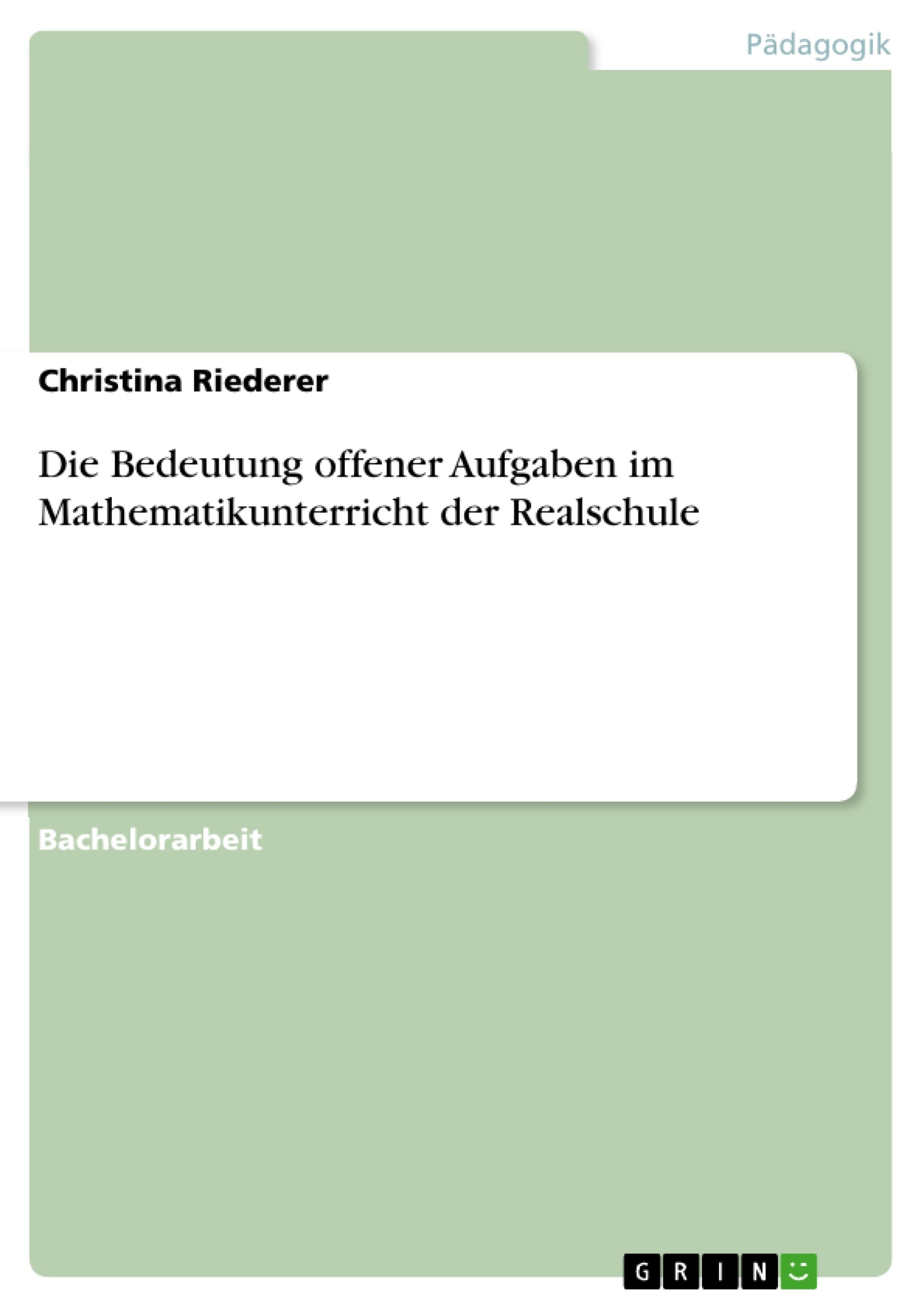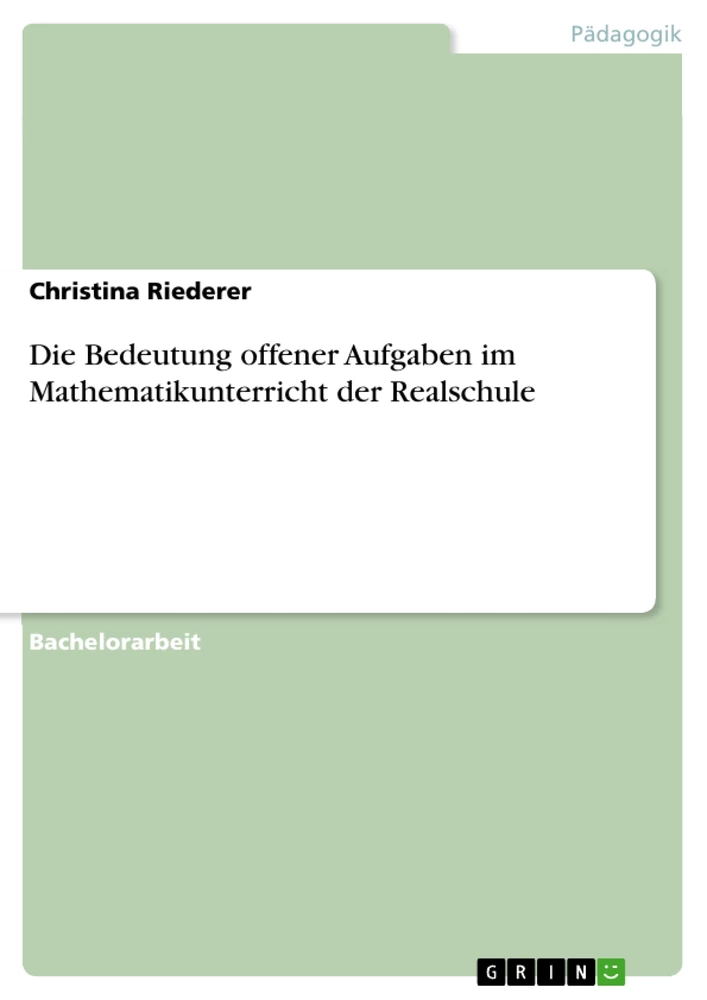
Die Bedeutung offener Aufgaben im Mathematikunterricht der Realschule
Bachelorarbeit, 2013
97 Seiten, Note: 2,00
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. TEIL: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 1. Einleitung
- 2. Qualität im Mathematikunterricht
- 2.1 SINUS – BLK-Modellversuchsprogramm
- 2.2 SINUS-Transfer
- 2.3 PISA-Studie
- 3. Qualitätssteigerung im Mathematikunterricht durch Aufgaben
- 3.1 Die Rolle von Aufgaben im Mathematikunterricht
- 3.2 Was ist eine „gute Aufgabe“?
- 3.2.1 Authentizität
- 3.2.2 Differenzierungsvermögen
- 3.2.3 Offenheit
- 4. Offene Aufgaben im Mathematikunterricht
- 4.1 Begriffserklärung
- 4.2 Aufgabentypen
- 5. Arten von offenen Aufgaben
- 5.1 Fragen stellen
- 5.2 Eigenschaften entdecken
- 5.3 Stellung nehmen
- 5.4 Abschätzen
- 5.4.1 Ein Bild als Ausgangspunkt
- 5.4.2 Informationen weglassen
- 5.4.3 Fermi-Aufgaben
- 5.5 Aufgaben erfinden
- 5.6 Aufgaben variieren
- 6. Modellieren und Problemlösen
- 6.1 Modellieren
- 6.2 Problemlösen
- 7. Chancen und Grenzen offener Aufgaben
- 7.1 Vorteile offener Aufgaben
- 7.2 Nachteile offener Aufgaben
- II TEIL: PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER UNTERRICHTSSTUNDE
- 1. Offene Aufgaben im Unterricht einer 6. Klasse
- 1.1 Lernvoraussetzungen
- 1.1.1 in Bezug auf die Klassensituation
- 1.1.2 in Bezug auf die Arbeits- und Sozialformen
- 1.1.3 in Bezug auf den Leistungsstand
- 1.1.4 in Bezug auf die Inhalte
- 1.2 Sachanalyse
- 1.3 Didaktische Überlegungen
- 1.3.1 Fachrelevanz
- 1.3.2 Schüler- und Gesellschaftsrelevanz
- 1.3.3 Didaktische Analyse in Bezug auf die Stunde
- 1.4 Lernziele
- 1.4.1 Grobziel
- 1.4.2 Feinziele
- 1.5 Methodische Überlegungen
- 1.6 Verlaufsplanung
- 1.7 Reflexion der Stunde
- 2. Gesamtreflexion
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz offener Aufgaben im Mathematikunterricht. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile offener Aufgaben zu beleuchten und deren Eignung zur Verbesserung der Unterrichtsqualität zu evaluieren. Ein praktischer Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde mit offenen Aufgaben in einer 6. Klasse.
- Die Rolle von Aufgaben im Mathematikunterricht
- Merkmale "guter" Mathematikaufgaben (Authentizität, Differenzierung, Offenheit)
- Offene Aufgaben: Definition, Typen und Gestaltungsmethoden
- Modellieren und Problemlösen im Kontext offener Aufgaben
- Chancen und Grenzen offener Aufgaben im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Teil: Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung des Einsatzes offener Aufgaben im Mathematikunterricht. Er analysiert die aktuelle Qualität des Mathematikunterrichts im Kontext internationaler Vergleichsstudien wie TIMSS und PISA, beleuchtet die Bedeutung von Aufgaben im Lern- und Leistungsprozess und definiert verschiedene Merkmale "guter" Aufgaben, darunter Authentizität, Differenzierungsvermögen und Offenheit. Ausführlich werden verschiedene Typen offener Aufgaben vorgestellt und Methoden zur Entwicklung und Öffnung von Aufgaben diskutiert. Schließlich werden die Chancen und Grenzen offener Aufgaben im Mathematikunterricht erörtert.
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungskontext der Arbeit und skizziert die zentralen Fragestellungen. Es wird die Absicht verdeutlicht, offene Aufgaben im Mathematikunterricht zu untersuchen und deren Einfluss auf die Unterrichtsqualität zu analysieren.
2. Qualität im Mathematikunterricht: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Qualität des Mathematikunterrichts in Deutschland vor dem Hintergrund internationaler Vergleichsstudien. Es werden Schwächen im mathematischen Verständnis und im Problemlösevermögen deutscher Schüler aufgezeigt und mögliche Ursachen diskutiert, u.a. der fragend-entwickelnde Unterricht. Initiativen wie SINUS und die PISA-Studie werden vorgestellt, die auf eine Qualitätsverbesserung abzielen.
3. Qualitätssteigerung im Mathematikunterricht durch Aufgaben: Dieses Kapitel betont die zentrale Rolle von Aufgaben im Mathematikunterricht. Es differenziert zwischen Lern- und Leistungssituationen und ihren unterschiedlichen Anforderungen an Aufgaben. Es werden die Merkmale einer „guten Aufgabe“ diskutiert, insbesondere Authentizität und Differenzierungsvermögen. Die Offenheit von Aufgaben wird als wichtiger Aspekt zur Qualitätssteigerung genannt.
4. Offene Aufgaben im Mathematikunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung offener Aufgaben im Vergleich zu geschlossenen Aufgaben. Es werden verschiedene Klassifikationen offener Aufgaben vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert.
5. Arten von offenen Aufgaben: Es werden verschiedene Strategien zur Entwicklung offener Aufgaben aus geschlossenen Aufgaben präsentiert, darunter das Stellen von Fragen, das Entdecken von Eigenschaften, das Stellungnehmen zu Sachverhalten, das Abschätzen von Größen und das Erfinden und Variieren von Aufgaben. Das "Ich-Du-Wir-Prinzip" als methodischer Ansatz wird erläutert.
6. Modellieren und Problemlösen: Dieses Kapitel behandelt die prozessbezogenen Kompetenzen Modellieren und Problemlösen. Es wird der Modellierungsprozess nach Blum und Leiß detailliert erklärt und ein vereinfachter Lösungsplan vorgestellt. Es werden verschiedene Problemlösestrategien nach Pólya und Leuders erläutert.
7. Chancen und Grenzen offener Aufgaben: In diesem Kapitel werden die Vorteile und Nachteile offener Aufgaben im Mathematikunterricht gegeneinander abgewogen. Die Vorteile liegen in der Förderung von Differenzierung, Selbstständigkeit, Problemlösekompetenz und der Motivation der Schüler. Als Nachteile werden die anfängliche Überforderung einiger Schüler, die Zeitintensivität und die Herausforderungen bei der Leistungsbewertung genannt.
II. Teil: Planung und Durchführung der Unterrichtsstunde: Dieser Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer konkreten Unterrichtsstunde in einer 6. Klasse zum Thema Volumenberechnung anhand offener Aufgaben. Er umfasst Lernvoraussetzungen der Schüler, didaktische und methodische Überlegungen, die Verlaufsplanung und eine Reflexion der Stunde.
1. Offene Aufgaben im Unterricht einer 6. Klasse: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde (Klasse, Lernvoraussetzungen der Schüler, etc.) und analysiert das Thema der Stunde (Volumenberechnung, offene Aufgaben). Didaktische und methodische Überlegungen werden dargelegt.
Schlüsselwörter
Offene Aufgaben, Mathematikunterricht, Unterrichtsqualität, Modellieren, Problemlösen, Differenzierung, Kompetenzentwicklung, TIMSS, PISA, Bildungsstandards, SINUS, Heuristische Strategien, Ich-Du-Wir-Prinzip, Volumenberechnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Offene Aufgaben im Mathematikunterricht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz offener Aufgaben im Mathematikunterricht. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile offener Aufgaben und evaluiert deren Eignung zur Verbesserung der Unterrichtsqualität. Ein praktischer Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde mit offenen Aufgaben in einer 6. Klasse.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil analysiert die aktuelle Qualität des Mathematikunterrichts anhand internationaler Vergleichsstudien (TIMSS und PISA). Er behandelt die Bedeutung von Aufgaben im Lernprozess, definiert Merkmale "guter" Aufgaben (Authentizität, Differenzierung, Offenheit) und stellt verschiedene Typen offener Aufgaben vor. Methoden zur Entwicklung und Öffnung von Aufgaben sowie die Chancen und Grenzen offener Aufgaben werden ebenfalls diskutiert.
Welche Aspekte der Aufgabenqualität werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Aspekte Authentizität, Differenzierungsvermögen und Offenheit als Merkmale "guter" Mathematikaufgaben. Es wird erläutert, wie diese Merkmale zu einer Qualitätssteigerung des Mathematikunterrichts beitragen können.
Welche Arten offener Aufgaben werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Arten offener Aufgaben, darunter Aufgaben, die das Stellen von Fragen, das Entdecken von Eigenschaften, das Stellungnehmen zu Sachverhalten, das Abschätzen von Größen, das Erfinden und das Variieren von Aufgaben erfordern. Das "Ich-Du-Wir-Prinzip" als methodischer Ansatz wird ebenfalls erläutert.
Wie werden Modellieren und Problemlösen im Zusammenhang mit offenen Aufgaben behandelt?
Der Zusammenhang zwischen offenen Aufgaben, Modellieren und Problemlösen wird ausführlich behandelt. Der Modellierungsprozess nach Blum und Leiß wird detailliert erklärt, und verschiedene Problemlösestrategien nach Pólya und Leuders werden erläutert.
Welche Chancen und Grenzen offener Aufgaben werden diskutiert?
Die Arbeit wägt die Vorteile und Nachteile offener Aufgaben ab. Vorteile umfassen die Förderung von Differenzierung, Selbstständigkeit, Problemlösekompetenz und Motivation. Nachteile sind die mögliche anfängliche Überforderung einiger Schüler, die Zeitintensivität und die Herausforderungen bei der Leistungsbewertung.
Was beinhaltet der praktische Teil der Arbeit?
Der praktische Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde in einer 6. Klasse zum Thema Volumenberechnung mit offenen Aufgaben. Er umfasst Lernvoraussetzungen der Schüler, didaktische und methodische Überlegungen, die Verlaufsplanung und eine Reflexion der Stunde.
Welche konkreten Lernziele werden in der Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Arbeit beschreibt sowohl ein Grobziel als auch Feinziele für die Unterrichtsstunde. Diese Lernziele sind spezifisch auf die Verwendung offener Aufgaben in der Volumenberechnung in einer 6. Klasse zugeschnitten.
Welche internationalen Studien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf internationale Vergleichsstudien wie TIMSS und PISA, um die Qualität des Mathematikunterrichts in Deutschland zu analysieren und die Notwendigkeit von Verbesserungen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Offene Aufgaben, Mathematikunterricht, Unterrichtsqualität, Modellieren, Problemlösen, Differenzierung, Kompetenzentwicklung, TIMSS, PISA, Bildungsstandards, SINUS, Heuristische Strategien, Ich-Du-Wir-Prinzip und Volumenberechnung.
Details
- Titel
- Die Bedeutung offener Aufgaben im Mathematikunterricht der Realschule
- Hochschule
- Universität Augsburg
- Note
- 2,00
- Autor
- Christina Riederer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V271259
- ISBN (eBook)
- 9783656635109
- ISBN (Buch)
- 9783656635154
- Dateigröße
- 10425 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bedeutung aufgaben mathematikunterricht realschule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Christina Riederer (Autor:in), 2013, Die Bedeutung offener Aufgaben im Mathematikunterricht der Realschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/271259
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-