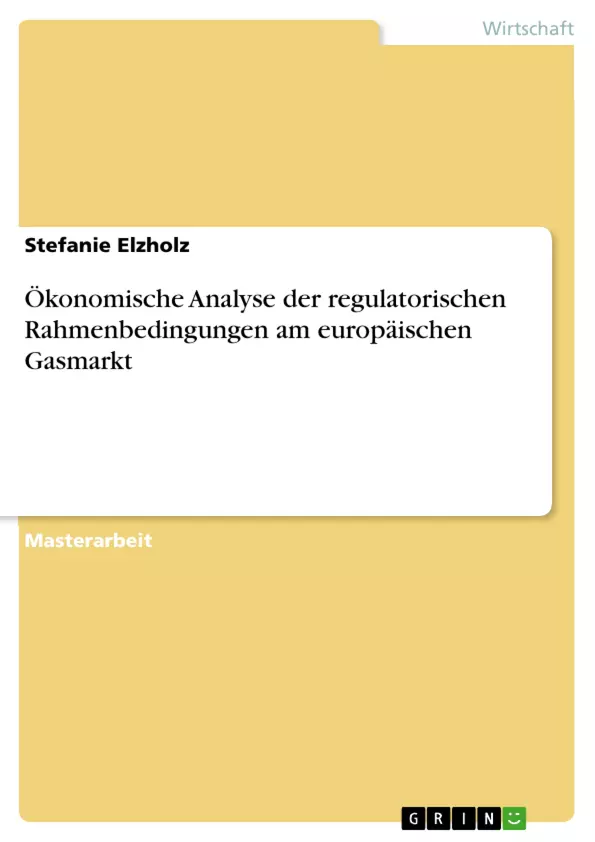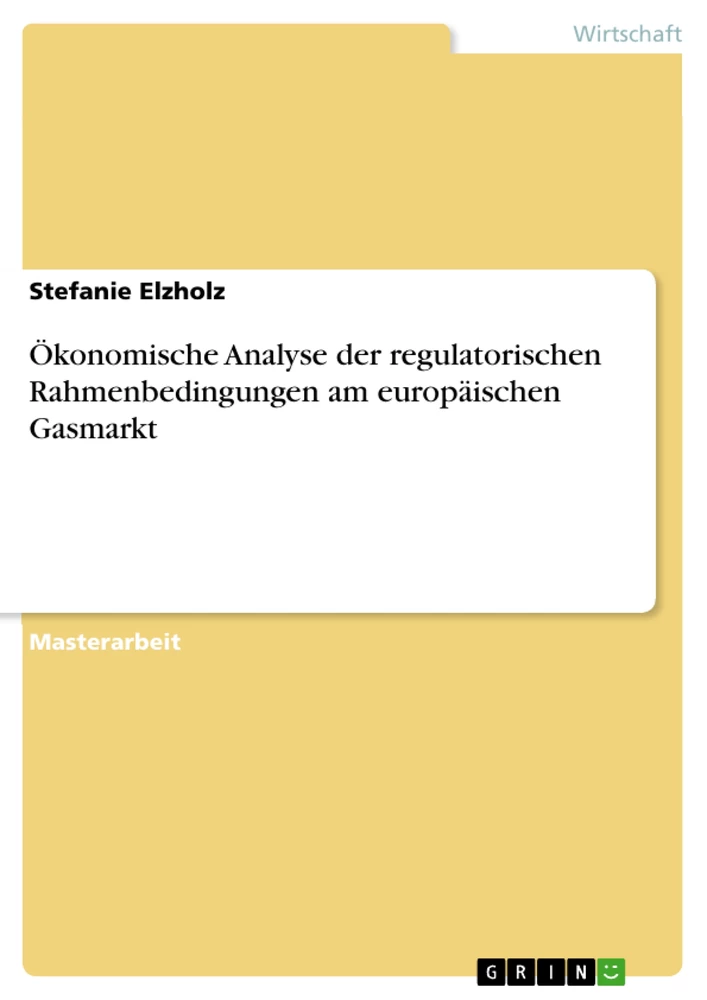
Ökonomische Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen am europäischen Gasmarkt
Masterarbeit, 2013
47 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
1.2 Begriffsabgrenzung
1.3 Ziel und Vorgehensweise der Untersuchung
2 Grundlagen der Erdgasversorgung
2.1 Energieträger Erdgas
2.2 Entwicklung der Gaswirtschaft
3 Regulierung des europäischen Gasmarktes
3.1 Marktmacht und Regulierungsbedarf
3.2 Marktmachtregulierung im liberalisierten Gasmarkt
3.2.1 EU-Ziele für einen europäischen Erdgasbinnenmarkt
3.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Regulierung
4 Regulierungsrahmen am deutschen Gasmarkt
4.1 Netzzugangsregulierung
4.1.1 Grundlagen des Netzzugangs
4.1.2 Vom verhandelten zum regulierten Netzzugangsmodell
4.1.3 Vom Kontraktpfad- zum Entry-Exit-Modell
4.2 Netzentgeltregulierung
4.2.1 Grundsätze der Entgeltregulierung
4.2.2 Von der Kostenregulierung zur Anreizregulierung
4.3 Entflechtungsregulierung
4.3.1 Allgemeine Grundsätze der Entflechtung
4.3.2 Entflechtungsmethoden
4.3.3 Sonderregelungen für Transportnetzbetreiber
5 Ausblick
5.1 Handlungsfelder für Unternehmen
5.1.1 Anforderungen an das Regulierungsmanagement
5.1.2 Herausforderung Anreizregulierung
5.1.3 Unternehmensstrategien
5.2 Herausforderungen für den Regulierer
6 Fazit
Literaturverzeichnis VI
Eidesstattliche Erklärung IX
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Gasmarktregulierung in Europa?
Ziel ist die Schaffung eines funktionierenden Binnenmarktes durch die Trennung von Netzbetrieb und Gasverkauf (Entflechtung) sowie die Regulierung der Netzentgelte.
Was versteht man unter dem "Entry-Exit-Modell"?
Es ist ein Netzzugangsmodell, bei dem Kapazitäten an Einspeise- (Entry) und Ausspeisepunkten (Exit) unabhängig vom physischen Transportweg gebucht werden können.
Was ist der Unterschied zwischen Kosten- und Anreizregulierung?
Während die Kostenregulierung tatsächliche Kosten erstattet, setzt die Anreizregulierung Obergrenzen (Caps), um Unternehmen zu Effizienzsteigerungen zu motivieren.
Warum müssen Netzbetreiber entflochten (unbundled) werden?
Um Diskriminierung zu verhindern. Ein Unternehmen, das sowohl das Netz besitzt als auch Gas verkauft, könnte sonst Wettbewerbern den Zugang zum Netz erschweren.
Gilt Deutschland als Vorreiter bei der Umsetzung der EU-Gasrichtlinien?
Ja, die Arbeit bezeichnet Deutschland als „Musterschülerin der Europa-Klasse“, da es die EU-Vorgaben sehr konsequent in nationales Recht umgesetzt hat.
Details
- Titel
- Ökonomische Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen am europäischen Gasmarkt
- Hochschule
- Universität Leipzig (Institut für Infrastruktur & Ressourcenmanagement)
- Veranstaltung
- Professur für VWL / Institutionenökonomische Umweltforschung
- Note
- 2,3
- Autor
- Stefanie Elzholz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V271432
- ISBN (Buch)
- 9783656729471
- ISBN (eBook)
- 9783656729587
- Dateigröße
- 600 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- ökonomische analyse rahmenbedingungen gasmarkt
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Stefanie Elzholz (Autor:in), 2013, Ökonomische Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen am europäischen Gasmarkt, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/271432
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-