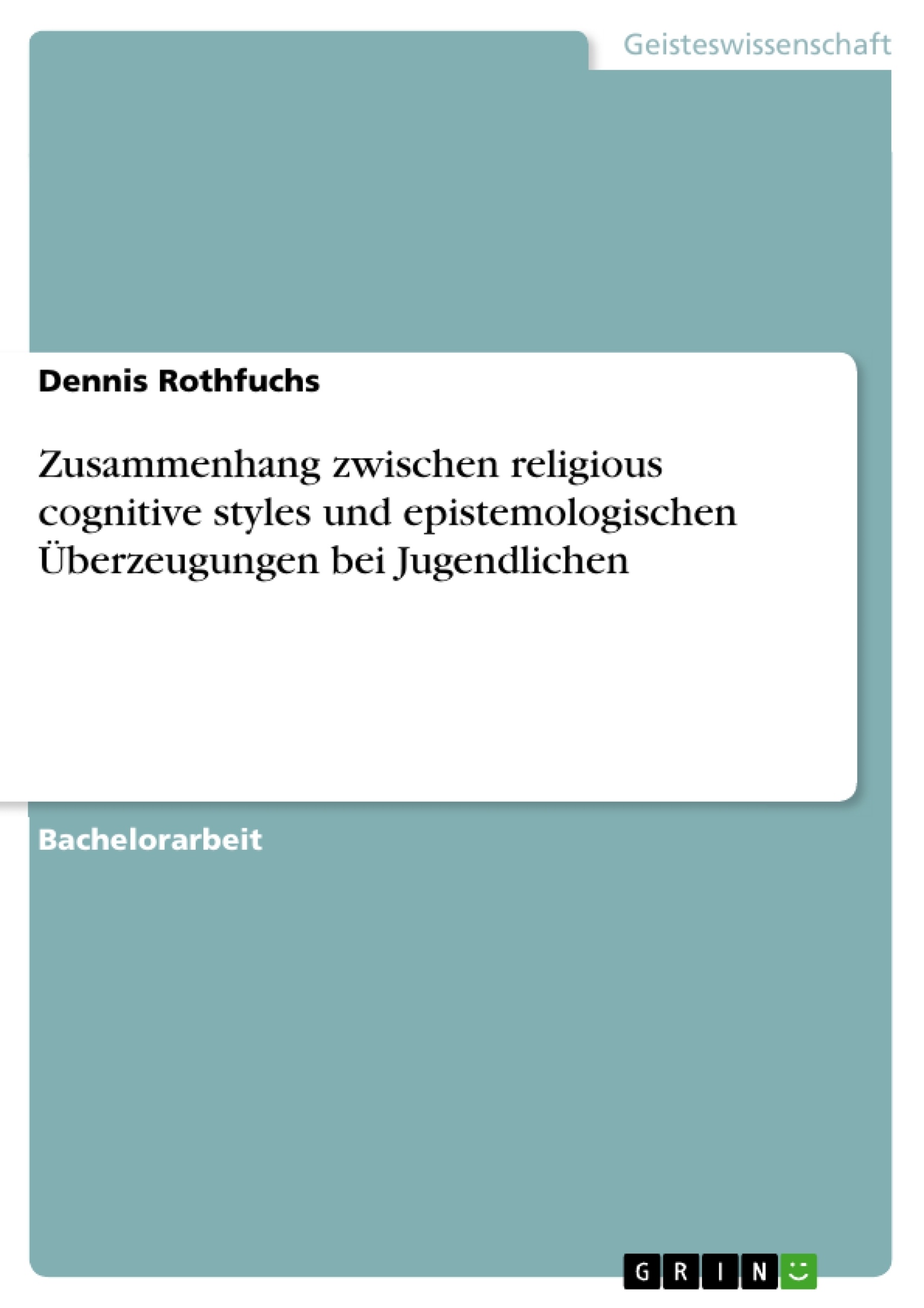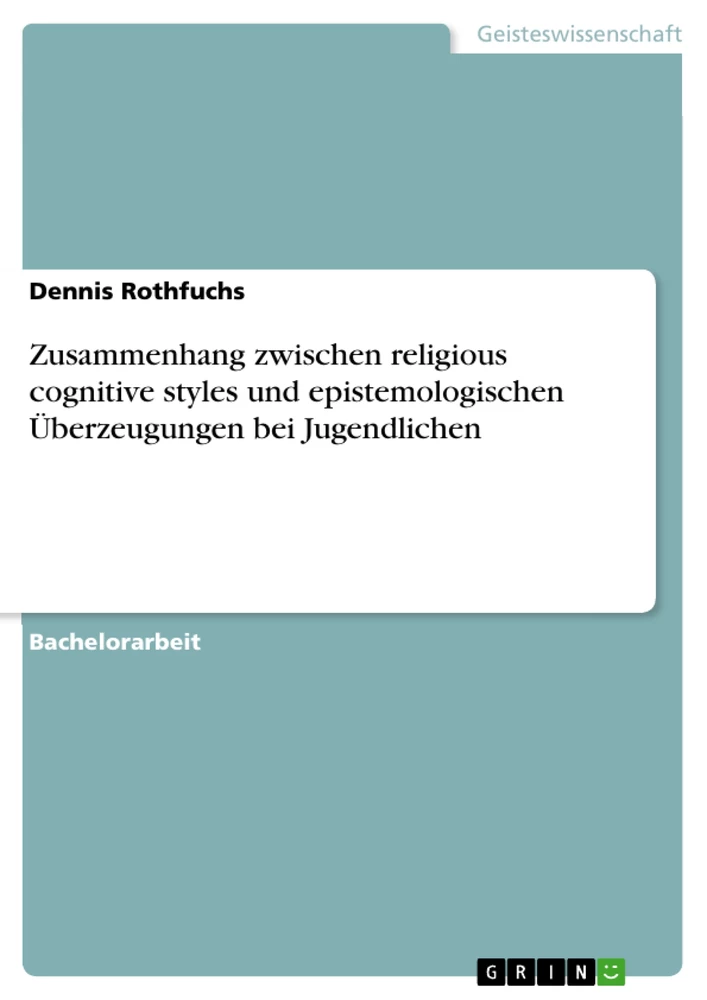
Zusammenhang zwischen religious cognitive styles und epistemologischen Überzeugungen bei Jugendlichen
Bachelorarbeit, 2011
50 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Epistemologische Überzeugungen
- Entwicklungspsychologische und persönlichkeitspsychologische Ansätze zu epistemologischen Überzeugungen
- Epistemologische Überzeugungen im interkulturellen Vergleich
- Religious Cognitive Styles
- Entwicklungsaspekte der religious cognitive styles
- Epistemologische Überzeugungen
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsfragen und Hypothesen
- Zusammenhang zwischen orthodoxy und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen external critique und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen relativism und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen orthodoxy und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen external critique und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen relativism und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Stichprobe
- Materialien
- Durchführung
- Forschungsfragen und Hypothesen
- Darstellung der Befunde
- Reliabilität der Skalen
- Prüfung der Hypothesen
- Zusammenhang zwischen orthodoxy und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen external critique und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen relativism und dem Sicherheitsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen orthodoxy und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen external critique und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusammenhang zwischen relativism und dem Entwicklungsaspekt epistemologischer Überzeugungen
- Zusatzannahmen
- Diskussion
- Methodische Einschränkungen
- Einbettung in den aktuellen Forschungsstand
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anhang A: Post Critical Belief Scale zur Erfassung der religious cognitive styles (Hutsebaut, 1996)
- Anhang B: Skalen zur Erfassung epistemologischer Überzeugungen (Sicherheit und Entwicklung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen religious cognitive styles und epistemologischen Überzeugungen bei Jugendlichen. Ziel ist es, die Beziehung zwischen den kognitiven Strukturen und Denkgewohnheiten eines Individuums in Bezug auf Religion und seinen subjektiven Theorien über die Natur des Wissens und des Wissenserwerbs zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie die verschiedenen religious cognitive styles, die im Jugendalter eine entscheidende Entwicklungsphase durchlaufen, die sich ebenfalls in diesem Lebensalter durch Kontakt mit Bildung ausformenden epistemologischen Überzeugungen beeinflussen.
- Die Entwicklung und Struktur von epistemologischen Überzeugungen bei Jugendlichen
- Die verschiedenen religious cognitive styles und ihre Entwicklung im Jugendalter
- Der Einfluss von religious cognitive styles auf epistemologische Überzeugungen
- Die Rolle von Religion und Kultur im Kontext von epistemologischen Überzeugungen
- Implikationen für die pädagogische Praxis und die Gestaltung von Lehr- und Lernumgebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die Relevanz von Religion in unserer Gesellschaft und den Zusammenhang zwischen religiösen Überzeugungen und kognitiven Strukturen beleuchtet. Sie erläutert die Konstrukte religious orientation und religious cognitive style und stellt die Fragestellung der Arbeit vor.
Das Kapitel "Theoretischer Hintergrund" definiert die beiden zentralen Konstrukte der Arbeit, epistemologische Überzeugungen und religious cognitive styles. Es beleuchtet verschiedene Ansätze zur Entwicklung und Struktur von epistemologischen Überzeugungen, sowohl aus entwicklungspsychologischer als auch aus persönlichkeitspsychologischer Perspektive. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Kultur und Religion im Kontext von epistemologischen Überzeugungen hervorgehoben. Der Abschnitt "Religious Cognitive Styles" beschäftigt sich mit der Definition von Religiosität und Spiritualität und stellt verschiedene Modelle zur Erfassung von religious cognitive styles vor, insbesondere das Modell von Wulff (1991) und die Post Critical Belief Scale von Hutsebaut (1996).
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit sowie die Methode der empirischen Untersuchung. Es stellt die Stichprobe, die Materialien und die Durchführung der Befragung vor.
Das Kapitel "Darstellung der Befunde" präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Reliabilitäten der verwendeten Skalen sowie die Ergebnisse der Korrelationsanalysen zur Überprüfung der Hypothesen dargestellt.
Das Kapitel "Diskussion" diskutiert die Ergebnisse der Arbeit im Kontext des aktuellen Forschungsstandes und der theoretischen Hintergründe. Es werden methodische Einschränkungen der Studie beleuchtet und Implikationen für die weitere Forschung aufgezeigt.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die zentralen Erkenntnisse der Untersuchung dar.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen religious cognitive styles, epistemologische Überzeugungen, Jugend, Religion, Kultur, Entwicklung, Bildung, Lernstrategien, pädagogische Praxis, und wissenschaftliche Erkenntnis. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den Einstellungen eines Individuums gegenüber Religion und seinen subjektiven Theorien über die Natur des Wissens und des Wissenserwerbs, insbesondere im Kontext der Jugendphase. Sie analysiert die verschiedenen religious cognitive styles und deren Einfluss auf die Entwicklung von epistemologischen Überzeugungen, beleuchtet die Rolle von Religion und Kultur in diesem Zusammenhang und diskutiert Implikationen für die pädagogische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was sind epistemologische Überzeugungen?
Dies sind subjektive Theorien eines Menschen darüber, was Wissen ist, wie sicher es ist und wie der Wissenserwerb funktioniert.
Was versteht man unter "religious cognitive styles"?
Es handelt sich um kognitive Denkmuster in Bezug auf Religion, wie zum Beispiel Orthodoxie (fester Glaube), Relativismus oder externe Kritik.
Wie hängen Orthodoxie und Wissen bei Jugendlichen zusammen?
Studien zeigen, dass ein orthodoxer religiöser Stil oft mit einem höheren Sicherheitsaspekt (Wissen als feststehend) bei epistemologischen Überzeugungen einhergeht.
Welchen Einfluss hat ein relativistischer religiöser Stil?
Relativismus korreliert positiv mit dem Entwicklungsaspekt von Wissen, also der Ansicht, dass Wissen dynamisch ist und sich ständig weiterentwickelt.
Warum ist die Untersuchung bei Jugendlichen besonders interessant?
Im Alter von 12 bis 18 Jahren befinden sich sowohl das religiöse Denken als auch die Vorstellungen über Wissen in einer entscheidenden Entwicklungsphase.
Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die Pädagogik?
Lehrkräfte können besser verstehen, wie religiöse Hintergründe die Lernstrategien und das Verständnis von wissenschaftlichen Fakten bei Schülern beeinflussen.
Details
- Titel
- Zusammenhang zwischen religious cognitive styles und epistemologischen Überzeugungen bei Jugendlichen
- Hochschule
- Universität des Saarlandes
- Note
- 1,3
- Autor
- Dennis Rothfuchs (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V271578
- ISBN (eBook)
- 9783656683360
- ISBN (Buch)
- 9783656683490
- Dateigröße
- 1441 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Religionspsychologie Lernpsychologie Entwicklungspsychologie Pädagogische Psychologie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Dennis Rothfuchs (Autor:in), 2011, Zusammenhang zwischen religious cognitive styles und epistemologischen Überzeugungen bei Jugendlichen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/271578
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-