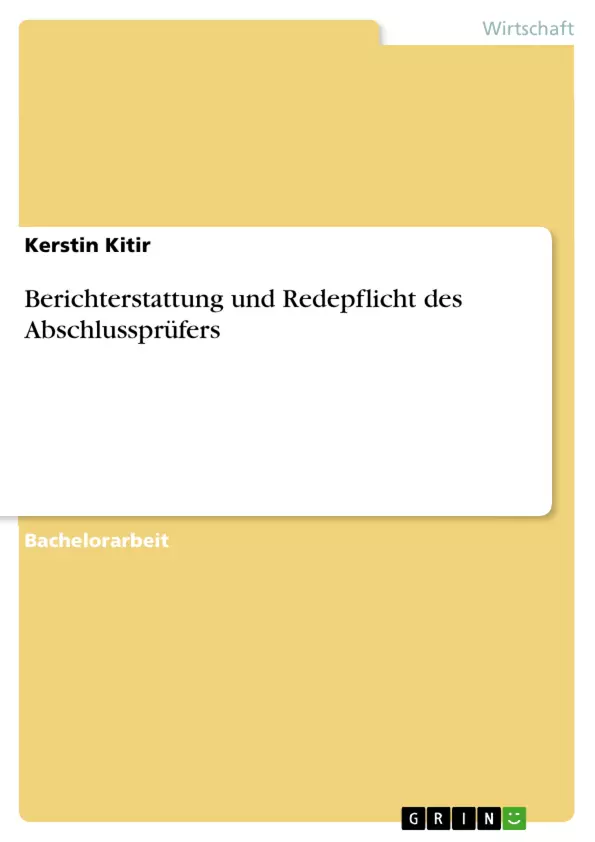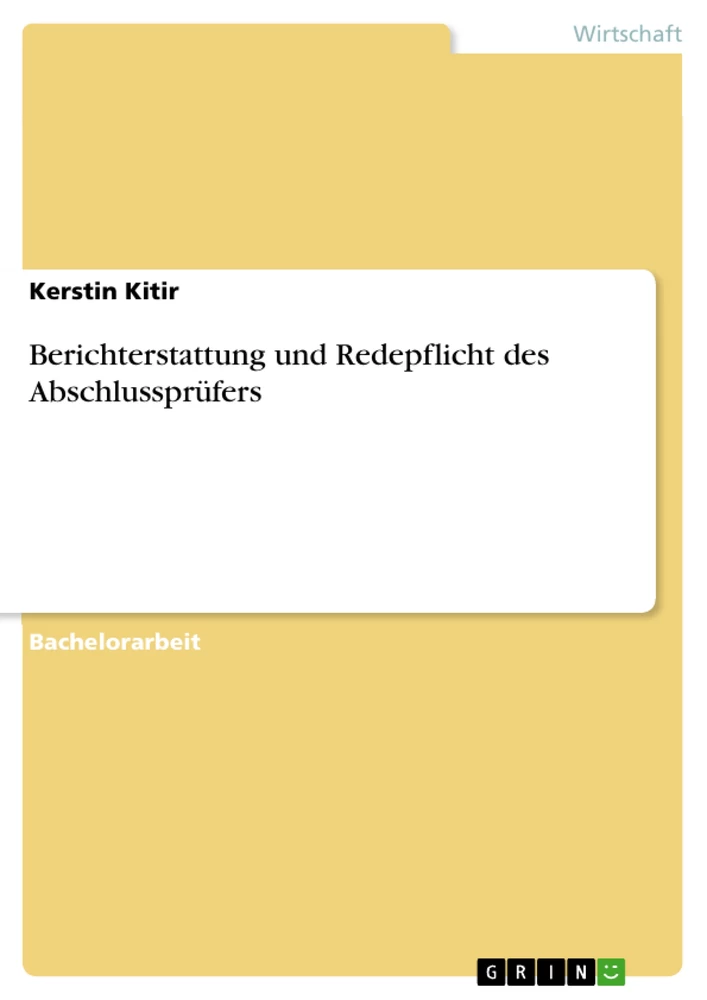
Berichterstattung und Redepflicht des Abschlussprüfers
Bachelorarbeit, 2014
38 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Die Jahresabschlussprüfung
- Zielsetzung und Nutzen der Jahresabschlussprüfung
- Entwicklung der Jahresabschlussprüfung
- Pflicht zur Jahresabschlussprüfung
- Gegenstand und Umfang der Jahresabschlussprüfung
- Der Prüfungsbericht
- Allgemeines
- Form und Inhalt des Prüfungsberichts
- Allgemeine Grundsätze der Berichterstattung
- Adressatenkreis des Prüfberichts
- Die Redepflichten des Abschlussprüfers
- Allgemeines
- Entwicklung der Redepflichten
- Zweck der Berichterstattung
- Zeitpunkt der Berichterstattung
- Die Redepflicht nach S 273 Abs. 2 UGB
- Allgemeines
- Umfang der Berichterstattung
- Gefährdung des Unternehmensbestandes
- Wesentliche Entwicklungsbeeinträchtigung
- Schwerwiegende Verstöße gesetzlicher Vertreter oder Arbeitnehmer
- Wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems
- Die Redepflicht nach S 273 Abs. 3 UGB
- Allgemeines
- Entwicklung der Redepfiicht nach S 273 Abs. 3 UGB
- Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs
- Berechnung der Kennzahlen
- Problematik der URG-Kennzahlen
- Folgen bei Vorliegen eines Reorganisationsbedarfs
- Die Anwendung des S 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB bei Vereinen, Konzernen, Privatstifiungen und freiwilligen Abschussprüfungen
- Vereine
- Allgemeines
- Redepflichten bei der Prüfung von Vereinen
- Wampflicht nach dem Vereinsgesetz
- Konzerne
- Allgemeines
- Aufgabe des Konzernabschlussprüfers
- Redepflichten des Konzernabschlussprüfers
- Privatstiftungen
- Allgemeines
- Aufgabe des Stifiungsprüfers
- Redepflichten des Stiftungsprüfers
- Freiwillige Abschlussprüfungen
- Vereine
- Die Haftung des Abschlussprüfers insbesondere bei Nichtausübung der gesetzlichen Redepflicht
- Zivilrechtliche Haftung
- Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung
- Haftpflichtversicherung
- Haftungssummen
- Strafrechtliche Haftung
- Haftung gegenüber Dritten
- Zivilrechtliche Haftung
- Zusammenfassung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Berichterstattung und Redepflicht des Abschlussprüfers im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Haftungsfragen zu analysieren. Dabei wird insbesondere auf die Unterschiede zwischen der Berichterstattung und der Redepflicht eingegangen und die Anwendung der Redepflicht auf verschiedene Rechtsformen, wie Vereine, Konzerne, Privatstiftungen und freiwillige Abschlussprüfungen, untersucht.
- Prüfungspflicht und deren Zweck
- Redepflichten des Abschlussprüfers
- Zeitpunkt und Umfang der Redepflicht
- Anwendbarkeit der Redepflicht auf verschiedene Rechtsformen
- Haftungsfolgen bei Nichtausübung der Redepflicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Jahresabschlussprüfung und beleuchtet die Zielsetzung und den Nutzen dieser Prüfung. Anschließend wird die Entwicklung der Jahresabschlussprüfung in Österreich dargestellt, wobei die Bedeutung der EU-Richtlinien und die Einführung des Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG) hervorgehoben werden. Im weiteren Verlauf werden die Voraussetzungen für die Prüfungspflicht von Unternehmen erläutert und der Gegenstand sowie der Umfang der Jahresabschlussprüfung näher betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Prüfungsbericht und dessen Bedeutung als Kommunikationsmittel zwischen dem Abschlussprüfer und der Gesellschaft. Hier werden die Form und der Inhalt des Berichts, die allgemeinen Grundsätze der Berichterstattung sowie der Adressatenkreis des Berichts behandelt.
Im vierten Kapitel werden die Redepflichten des Abschlussprüfers im Detail analysiert. Die Arbeit geht dabei auf die Entwicklung, den Zweck und den Zeitpunkt der Redepflicht ein. Besonderes Augenmerk wird auf die Redepflicht nach S 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB gelegt, wobei die verschiedenen Tatbestände, die eine Redepflicht auslösen, wie die Gefährdung des Unternehmensbestandes, die wesentliche Entwicklungsbeeinträchtigung, schwerwiegende Verstöße gesetzlicher Vertreter oder Arbeitnehmer sowie wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems, im Detail betrachtet werden. Zudem wird die Problematik der URG-Kennzahlen und deren Auswirkungen auf die Redepflicht des Abschlussprüfers diskutiert.
Im fünften Kapitel wird die Anwendung der Redepflicht auf verschiedene Rechtsformen, wie Vereine, Konzerne, Privatstiftungen und freiwillige Abschlussprüfungen, untersucht. Die Arbeit zeigt dabei die Besonderheiten der jeweiligen Rechtsformen auf und analysiert die Redepflicht des Abschlussprüfers in diesen Kontexten.
Das sechste und letzte Kapitel befasst sich mit der Haftung des Abschlussprüfers, insbesondere bei Nichtausübung der gesetzlichen Redepflicht. Es werden die Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung, die Haftpflichtversicherung und die Haftungssummen erläutert. Darüber hinaus werden die strafrechtlichen Haftungsfolgen bei Nichtausübung der Redepflicht sowie die Haftung gegenüber Dritten behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Jahresabschlussprüfung, die Berichterstattungspflicht, die Redepflicht des Abschlussprüfers, das Unternehmensgesetzbuch (UGB), die Gefährdung des Unternehmensbestandes, die wesentliche Entwicklungsbeeinträchtigung, schwerwiegende Verstöße gesetzlicher Vertreter oder Arbeitnehmer, wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems, die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs, das Unternehmensreorganisationsgesetz (URG), die Haftung des Abschlussprüfers, die zivilrechtliche Haftung, die strafrechtliche Haftung und die Haftung gegenüber Dritten. Der Text beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen der Berichterstattung und Redepflicht des Abschlussprüfers und analysiert die damit verbundenen Haftungsfragen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Berichterstattung und Redepflicht?
Während die Berichterstattung den allgemeinen Prüfungsbericht umfasst, bezieht sich die Redepflicht auf die sofortige Informationspflicht bei bestandsgefährdenden Tatsachen.
Wann muss ein Abschlussprüfer gemäß § 273 Abs. 2 UGB Bericht erstatten?
Die Redepflicht tritt ein bei Gefährdung des Unternehmensbestandes, wesentlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen, schwerwiegenden Verstößen oder Schwächen im internen Kontrollsystem.
Welche Rolle spielt das Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)?
Das URG definiert Kennzahlen, bei deren Unterschreitung ein Reorganisationsbedarf vermutet wird, was wiederum die Redepflicht des Prüfers auslösen kann.
Welche Haftungsfolgen drohen dem Abschlussprüfer?
Bei Nichtausübung der Redepflicht drohen zivilrechtliche Haftung gegenüber der Gesellschaft und Dritten sowie unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen.
Gilt die Redepflicht auch für Vereine und Stiftungen?
Ja, die gesetzlichen Bestimmungen zur Redepflicht finden unter Berücksichtigung spezifischer Gesetze (z.B. Vereinsgesetz) auch bei diesen Rechtsformen Anwendung.
Details
- Titel
- Berichterstattung und Redepflicht des Abschlussprüfers
- Hochschule
- Fachhochschule Wien (Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen)
- Note
- 1
- Autor
- Kerstin Kitir (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V271796
- ISBN (Buch)
- 9783656638957
- ISBN (eBook)
- 9783656638988
- Dateigröße
- 442 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Abschlussprüfer Wirtschaftsprüfer Stiftungsprüfer Redepflicht Redepflichten Berichterstattung Jahresabschlussprüfung Privatstiftung Jahresabschluss Verein freiwillige Abschlussprüfung Konzern Konzernprüfer Haftung Abschlussprüfer IKS internes Kontrollsystem Prüfungspflicht URÄG 2008 RLG 1990 Abschlussprüferrichtlinine Insolvenzrechtsänderungsgesetz PSG Privatstiftungsgesetz Rechnungslegungsgesetz Unternehmensreorganisationsgesetz Vereinsgesetz § 221 UGB Größenklassen Aufgabe des Abschlussprüfers Erwartungslücke Testat des Abschlussprüfers Adressaten des Jahresabschlusses Prüfungsbericht Sonderbericht unverzügliche Berichterstattung Bestätigungsvermerk Management Letter schriftliche Berichterstattung Grundsatz der Vollständigkeit Grundsatz der Wahrheit Grundsatz der Klarheit Grundsatz der Unparteilichkeit gesetzliche Vertreter Berichtsadressaten Treuepflicht des Abschlussprüfers Berichtsempfänger § 273 Abs 2 UGB § 273 Abs 3 UGB Negativvermerk Unverzüglichkeit Prüfungshandlungen Erweiterung der Prüfungshandlungen prüfende Gesellschaft Gefährdung des Unternehmensbestandes Entwicklungsbeeinträchtigung wesentliche Entwicklungsbeeinträchtigung schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter wesentliche Schwächen im internen Kontrollsystem Prüfungsumfang berichtspflichtige Tatsachen prophylaktische Ausübung der Redepflicht Ausübung der Redepflicht Verschwiegenheitspflicht drohende Zahlungsunfähigkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Kerstin Kitir (Autor:in), 2014, Berichterstattung und Redepflicht des Abschlussprüfers, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/271796
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-