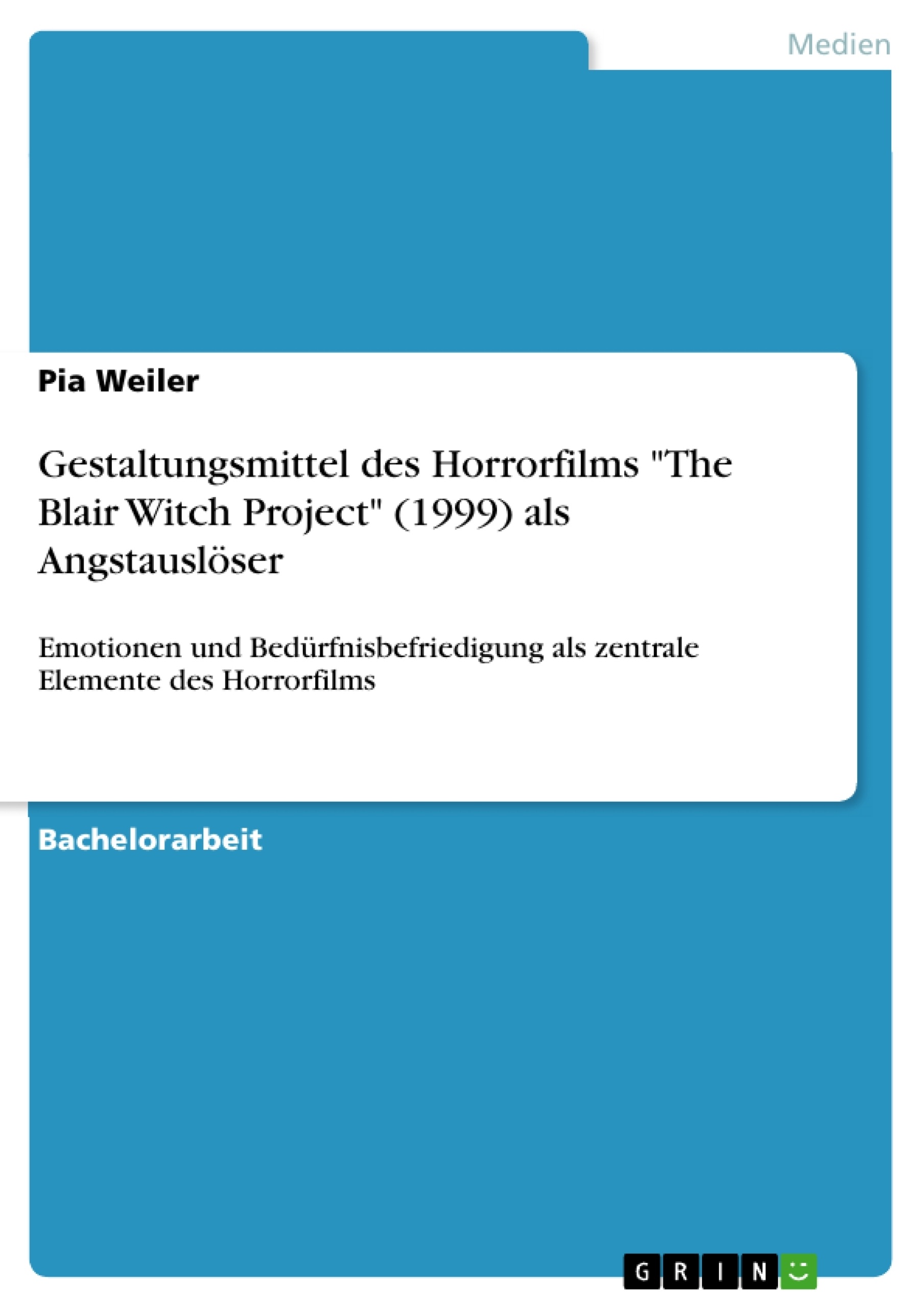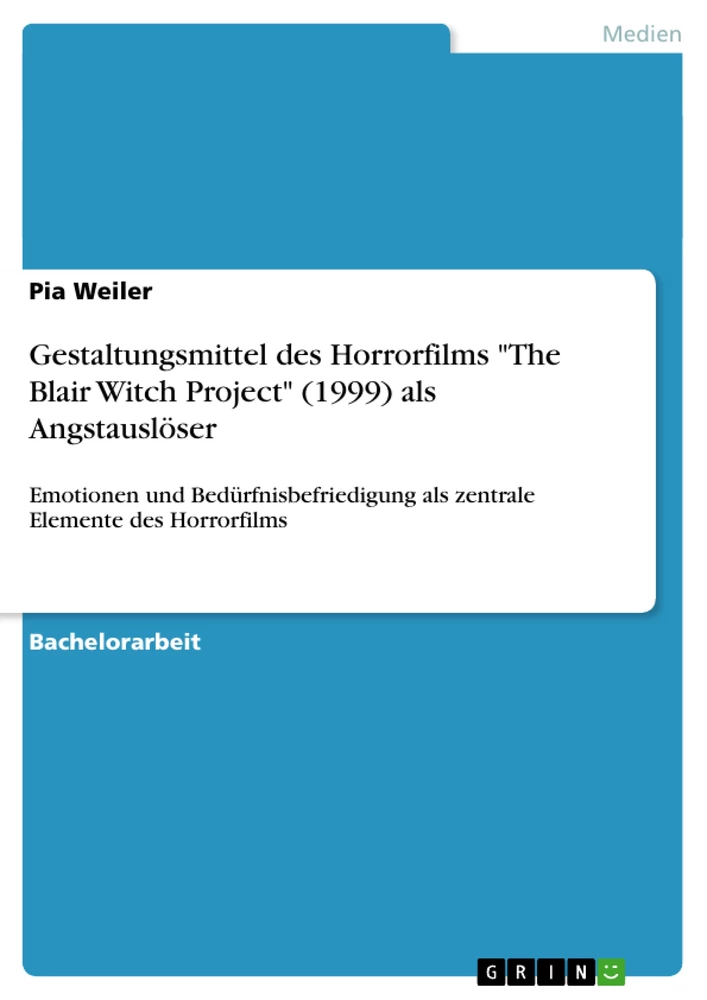
Gestaltungsmittel des Horrorfilms "The Blair Witch Project" (1999) als Angstauslöser
Bachelorarbeit, 2014
84 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.2 Historische Entwicklung des Horrorgenres
- 3. Der Film The Blair Witch Project
- 3.1 Handlung
- 3.2 Entstehungs- und Erfolgsgeschichte des Films
- 3.3 Produktions- und Vertriebsphase
- 4. Theorie: Emotionen und Bedürfnisbefriedigung als zentrale Elemente des Horrorfilms
- 4.1 Uses-and-Gratifications Ansatz
- 4.2 Historische Auseinandersetzung mit dem Angstbegriff und Erkenntnisse daraus für den Film
- 4.3 Emotionen im Film
- 4.4 Psychologie der Angst
- 4.5 Meta-Emotionen
- 5. Methode: Qualitative Inhaltsanalyse
- 5.1 Narration und Dramaturgie
- 5.2 Ästhetik und Gestaltung
- 5.2.1 Kamera
- 5.2.2 Licht, Ton und Schnitt
- 6. Ergebnisse und Interpretation
- 6.1 Narration und Dramaturgie des Films und Auswirkung auf das Angstempfinden
- 6.2 Ästhetik und Gestaltung des Films und Auswirkung auf das Angstempfinden
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gestaltungsmittel des Horrorfilms The Blair Witch Project und deren Potential, Angst beim Zuschauer auszulösen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern besitzen Gestaltungsmerkmale des Horrorfilms The Blair Witch Project das Potential Angst auszulösen? Die Arbeit analysiert den Film mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse, fokussiert auf Narration/Dramaturgie und Ästhetik/Gestaltung. Theoretische Grundlagen bilden der Uses-and-Gratifications-Ansatz, die Psychologie der Angst und das Konzept der Meta-Emotionen.
- Angstvermittlung im Horrorfilm
- Wirkung von Gestaltungsmitteln (Kameraführung, Licht, Ton, Schnitt)
- Uses-and-Gratifications Ansatz und Bedürfnisbefriedigung
- Analyse von The Blair Witch Project als Fallbeispiel
- Psychologische und filmwissenschaftliche Perspektiven auf Horror
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Horrorfilm The Blair Witch Project als außergewöhnliches Beispiel des Genres vor, das auf konventionelle Elemente verzichtet und stattdessen die Phantasie des Zuschauers nutzt, um Angst zu erzeugen. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die methodische Vorgehensweise skizziert, welche eine qualitative Inhaltsanalyse des Films beinhaltet, die auf den Arbeiten von Lothar Mikos aufbaut.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über grundlegende Begriffe des Horrorgenres, wie z.B. die Definition von Horror und Angst. Die historische Entwicklung des Genres wird beleuchtet, beginnend mit den frühen Filmen bis hin zu den modernen Found-Footage-Filmen, zu denen The Blair Witch Project gehört. Die unterschiedlichen theoretischen Perspektiven auf die Rezeption von Horrorfilmen werden diskutiert.
3. Der Film The Blair Witch Project: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des Films The Blair Witch Project, einschließlich Handlung, Entstehungsgeschichte, Erfolgsfaktoren und Marketingstrategie. Es wird hervorgehoben, wie die Pseudo-Dokumentation und die Verwendung von Handkameras zum Erfolg des Films beigetragen haben.
4. Theorie: Emotionen und Bedürfnisbefriedigung als zentrale Elemente des Horrorfilms: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Der Uses-and-Gratifications-Ansatz wird erläutert, um das Bedürfnis der Zuschauer nach Angsterfahrungen zu erklären. Die historische Auseinandersetzung mit dem Angstbegriff, die Psychologie der Angst und das Konzept der Meta-Emotionen werden vorgestellt, um ein Verständnis für die emotionalen Prozesse bei der Rezeption von Horrorfilmen zu entwickeln.
5. Methode: Qualitative Inhaltsanalyse: In diesem Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit detailliert beschrieben. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Lothar Mikos wird als Methode der Filmanalyse vorgestellt, wobei der Fokus auf den Ebenen Narration und Dramaturgie sowie Ästhetik und Gestaltung liegt. Das verwendete Sequenzprotokoll wird ebenfalls erläutert.
6. Ergebnisse und Interpretation: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse von The Blair Witch Project. Die Analyse der Narration und Dramaturgie zeigt, wie der Film durch die Inszenierung von Unsicherheit und drohender Gefahr Angst erzeugt. Die Analyse der Ästhetik und Gestaltung befasst sich mit der Wirkung von Handkameraaufnahmen, Licht, Ton und Schnitt auf das Angstempfinden des Zuschauers. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorgestellten Theorien interpretiert.
Schlüsselwörter
Horrorfilm, The Blair Witch Project, Angst, Emotionen, Uses-and-Gratifications-Ansatz, Handkamera, Found-Footage, Qualitative Inhaltsanalyse, Filmanalyse, Narration, Dramaturgie, Ästhetik, Gestaltung, Meta-Emotionen, Spannung, Suspense, Authentizität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von "The Blair Witch Project"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Horrorfilm "The Blair Witch Project" und untersucht, wie seine Gestaltungsmittel beim Zuschauer Angst auslösen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern besitzen Gestaltungsmerkmale des Films das Potential, Angst zu erzeugen?
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Lothar Mikos, die sich auf die Ebenen Narration/Dramaturgie und Ästhetik/Gestaltung konzentriert. Es wird ein Sequenzprotokoll verwendet.
Welche theoretischen Ansätze werden angewendet?
Die theoretischen Grundlagen umfassen den Uses-and-Gratifications-Ansatz, die Psychologie der Angst und das Konzept der Meta-Emotionen. Diese Ansätze helfen, das Bedürfnis des Zuschauers nach Angsterfahrungen und die emotionalen Prozesse während des Filmerlebens zu verstehen.
Welche Aspekte des Films werden analysiert?
Die Analyse fokussiert auf die Narration und Dramaturgie des Films, sowie auf die Ästhetik und Gestaltung, einschließlich Kameraführung, Licht, Ton und Schnitt. Es wird untersucht, wie diese Elemente zur Angstvermittlung beitragen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Begriffsbestimmungen und historische Entwicklung des Horrorgenres), Beschreibung von "The Blair Witch Project", Theorie (Emotionen, Bedürfnisbefriedigung, Angstpsychologie), Methode (Qualitative Inhaltsanalyse), Ergebnisse und Interpretation, sowie Fazit und Ausblick.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen, wie die Narration, Dramaturgie und die ästhetischen Gestaltungsmittel von "The Blair Witch Project" (insbesondere die Verwendung der Handkamera, Licht, Ton und Schnitt) zum Angstempfinden des Zuschauers beitragen. Diese Ergebnisse werden im Kontext der vorgestellten Theorien interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Horrorfilm, "The Blair Witch Project", Angst, Emotionen, Uses-and-Gratifications-Ansatz, Handkamera, Found-Footage, Qualitative Inhaltsanalyse, Filmanalyse, Narration, Dramaturgie, Ästhetik, Gestaltung, Meta-Emotionen, Spannung, Suspense, Authentizität.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Angstvermittlung in "The Blair Witch Project" zu verstehen und zu erklären, indem sie die Wirkung der Gestaltungsmittel auf den Zuschauer analysiert. Es geht darum, den Erfolg des Films im Hinblick auf seine Angsterzeugung zu untersuchen.
Wie wird der Film "The Blair Witch Project" in der Arbeit dargestellt?
Der Film wird als außergewöhnliches Beispiel des Horrorgenres dargestellt, das auf konventionelle Schockeffekte verzichtet und stattdessen die Phantasie des Zuschauers nutzt, um Angst zu erzeugen. Seine Entstehungsgeschichte, Erfolgsfaktoren und Marketingstrategie werden ebenfalls beleuchtet.
Wo kann ich mehr über die qualitative Inhaltsanalyse nach Lothar Mikos erfahren?
Die Arbeit baut auf den Arbeiten von Lothar Mikos zur qualitativen Inhaltsanalyse auf. Weitere Informationen zu seiner Methode sind in entsprechenden wissenschaftlichen Publikationen zu finden.
Details
- Titel
- Gestaltungsmittel des Horrorfilms "The Blair Witch Project" (1999) als Angstauslöser
- Untertitel
- Emotionen und Bedürfnisbefriedigung als zentrale Elemente des Horrorfilms
- Hochschule
- Universität Salzburg (Gesellschaftswissenschaften)
- Veranstaltung
- Kino und Film
- Note
- 1,0
- Autor
- Pia Weiler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 84
- Katalognummer
- V272423
- ISBN (Buch)
- 9783656646754
- ISBN (eBook)
- 9783656646761
- Dateigröße
- 1034 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gestaltungsmittel horrorfilms blair witch project angstauslöser emotionen bedürfnisbefriedigung elemente
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Pia Weiler (Autor:in), 2014, Gestaltungsmittel des Horrorfilms "The Blair Witch Project" (1999) als Angstauslöser, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/272423
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-