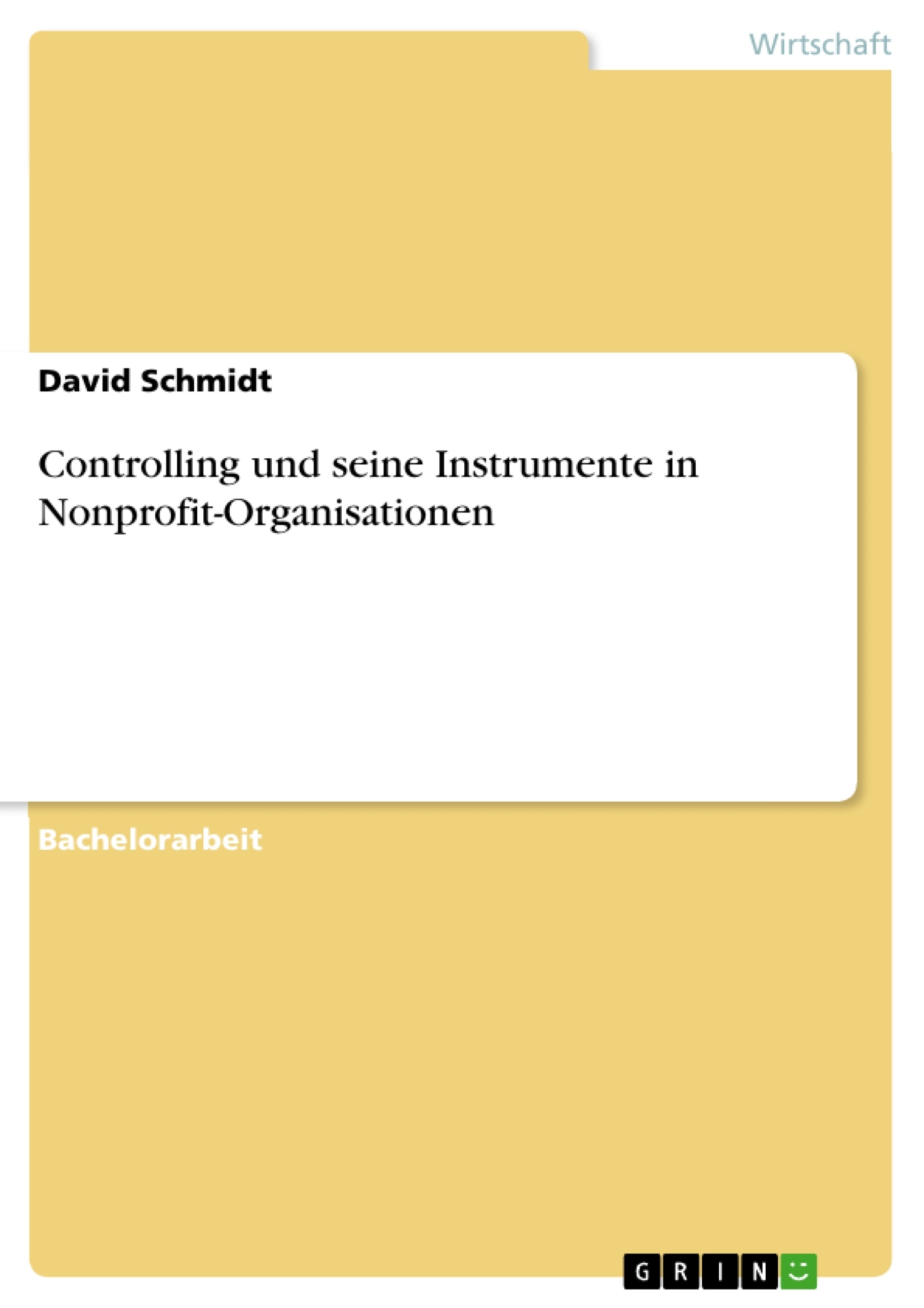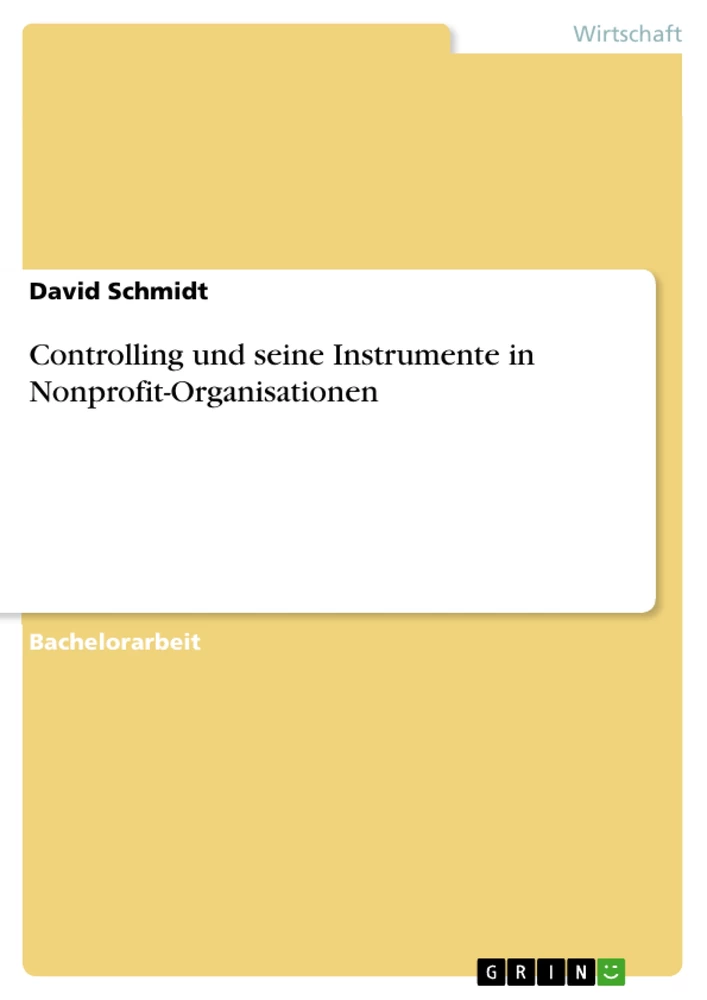
Controlling und seine Instrumente in Nonprofit-Organisationen
Bachelorarbeit, 2013
54 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Controlling
2.1 Geschichtliche Entwicklung des Controlling
2.2 Entwicklungsschritte des Controlling in Deutschland
2.3 Controlling-Konzeptionen
2.4 Begriffsbestimmung
2.5 Verschiedene Definitionen
2.6 Funktionales und Institutionelles Controlling
2.7 Funktionen des Controlling
2.7.1 Koordinationsfunktion
2.7.2 Steuerungs- und Regelungsfunktion
2.7.3 Informationsfunktion
2.8 Operatives und strategisches Controlling
2.9 Ausgewählte Instrumente des Controlling
3 Nonprofit-Organisationen
3.1 Einleitung
3.2 Begriffsbestimmung und Abgrenzung
3.3 NPOs als ›Dritter Sektor‹
3.4 Der Nonprofit-Sektor in Deutschland
3.4.1 Einleitung
3.4.2 Organisations- und Rechtsformen
3.4.3 NPO-spezifische Traditionen und Veränderungen
3.4.4 Nonprofit-Sektor in Deutschland - ein quantitatives Bild
3.4.5 Trends und Entwicklungen
4 Controlling und Rechnungswesen in NPOs
4.1 Einleitung
4.1.1 Controlling in NPOs
4.1.2 Rechnungswesen in NPOs
4.2 Herausforderungen durch Controlling und Rechnungswesen in NPOs
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigen Nonprofit-Organisationen (NPOs) ein Controllingsystem?
NPOs stehen vor Herausforderungen wie Globalisierung, wirtschaftlicher Instabilität und wachsender Konkurrenz. Controlling hilft ihnen, ihre langfristige Existenz zu sichern und Ressourcen effizient zu steuern.
Was sind die Hauptfunktionen des Controllings in NPOs?
Zu den Kernfunktionen gehören die Koordination, die Steuerung und Regelung sowie die Informationsversorgung für Entscheidungsträger.
Was ist der Unterschied zwischen operativem und strategischem Controlling?
Das operative Controlling konzentriert sich auf die kurzfristige Planung und Wirtschaftlichkeit, während das strategische Controlling die langfristige Ausrichtung und Existenzsicherung im Blick hat.
Welche Rolle spielt der "Dritte Sektor" in Deutschland?
NPOs bilden den Dritten Sektor zwischen Staat und Privatwirtschaft und erfüllen wichtige soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aufgaben in der Gesellschaft.
Welchen Stellenwert hat das Rechnungswesen im NPO-Controlling?
Das Rechnungswesen liefert die notwendigen Daten und Kennzahlen, auf denen das Controlling aufbaut, um die Zielerreichung der Organisation zu messen.
Details
- Titel
- Controlling und seine Instrumente in Nonprofit-Organisationen
- Hochschule
- Fachhochschule Stralsund
- Note
- 1,7
- Autor
- David Schmidt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V272680
- ISBN (Buch)
- 9783656650348
- ISBN (eBook)
- 9783656650355
- Dateigröße
- 1614 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- controlling instrumente nonprofit-organisationen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- David Schmidt (Autor:in), 2013, Controlling und seine Instrumente in Nonprofit-Organisationen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/272680
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-