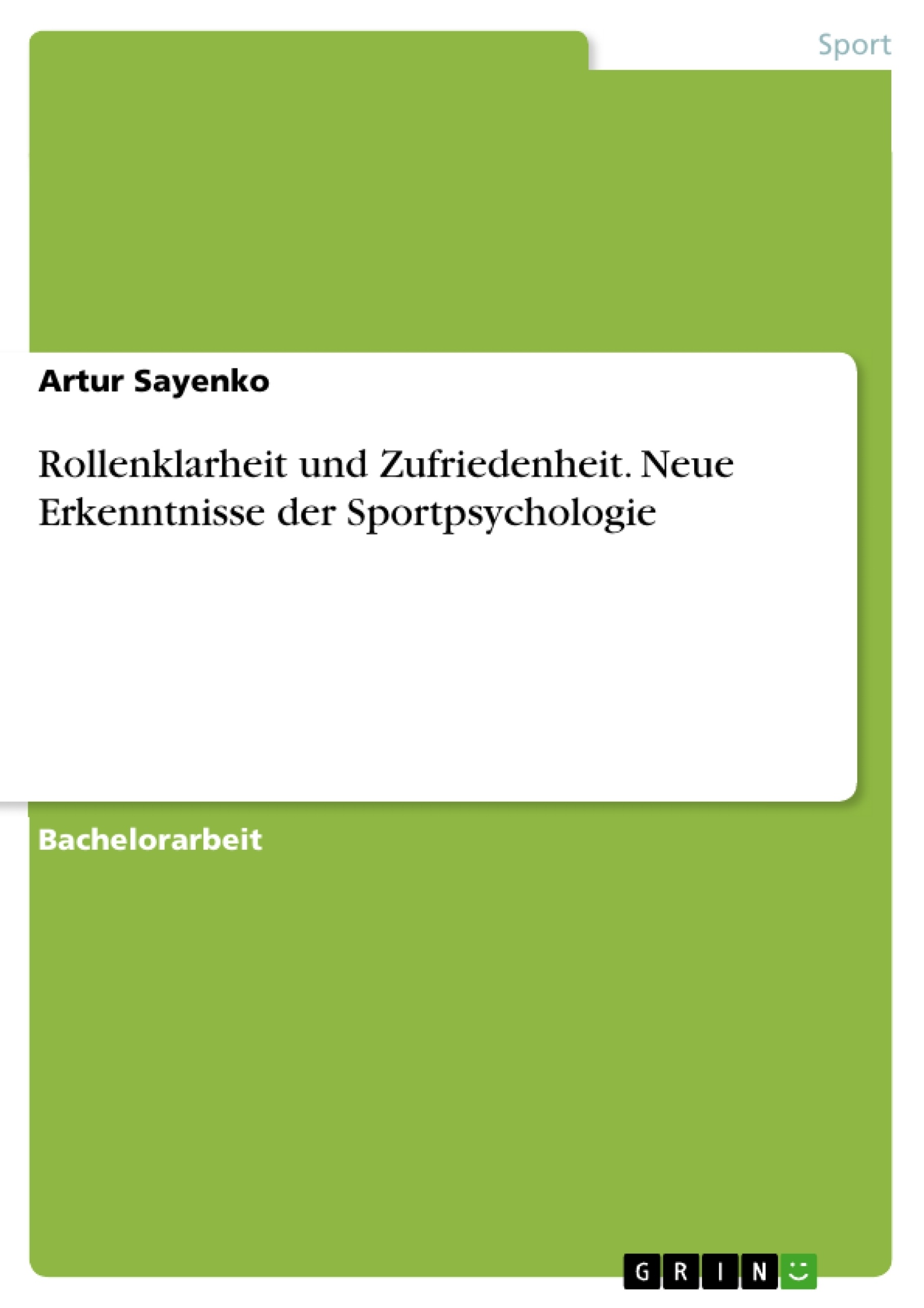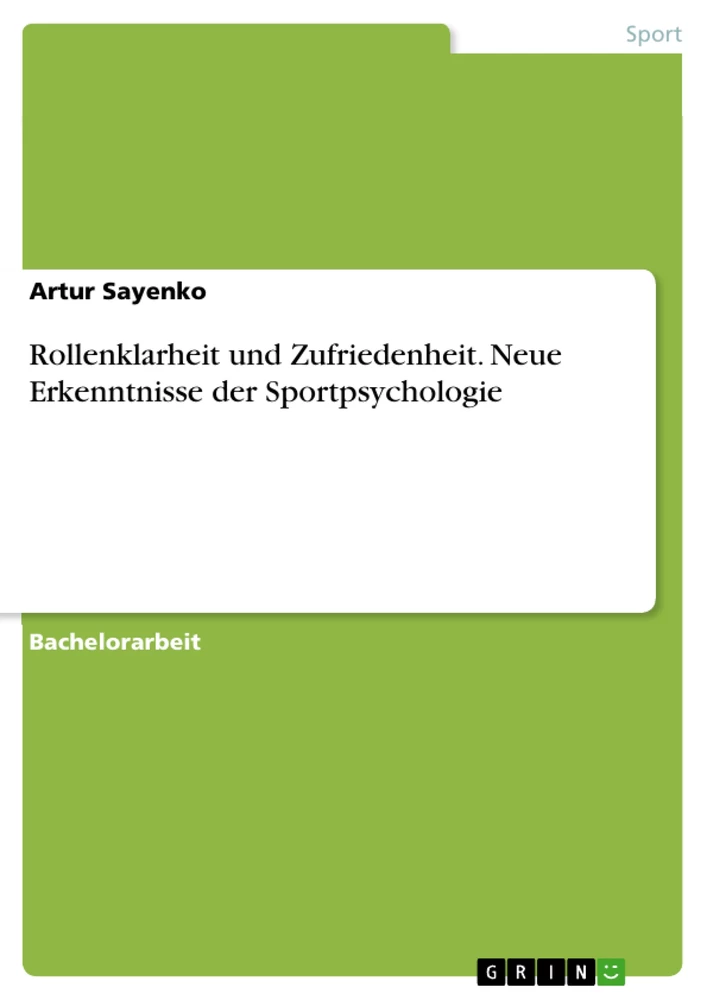
Rollenklarheit und Zufriedenheit. Neue Erkenntnisse der Sportpsychologie
Bachelorarbeit, 2014
46 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Einführung in die Rollentheorie
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Theoretische Konzepte der Rollenwahrnehmung
- 2.3 Aspekte der sozialen Rollen
- 2.3.1 Role efficacy
- 2.3.2 Rollenkonflikt
- 2.3.3 Rollenakzeptanz und Rollenzufriedenheit
- 2.4 Rollenklarheit
- 2.4.1 Definition
- 2.4.2 Theorie
- 2.4.3 Forschungslage
- 3. Zufriedenheit
- 3.1 Definition
- 3.2 Theorien
- 3.3 Forschungslage
- 4. Rollenklarheit und Zufriedenheit-Studie
- 5. Problemstellungen und Hypothesen
- 6. Methode
- 6.1 Teilnehmer
- 6.2 Messinstrument
- 6.3 Durchführung
- 6.4 Auswertung
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Deskriptive Ergebnisse
- 7.2 Hypothesenbezogenen Ergebnisse
- 8. Diskussion
- 9. Zusammenfassung
- 10. Englisches Abstract
- 11. Literatur
- 12. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Rollenklarheit auf die Zufriedenheit im Mannschaftssport. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen der Klarheit der Rollenverteilung innerhalb eines Teams und der individuellen Zufriedenheit der Sportler zu analysieren. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Rollentheorien und Zufriedenheitsmodelle.
- Der Einfluss von Rollenklarheit auf die Teamleistung
- Zusammenhang zwischen Rollenklarheit und individueller Zufriedenheit
- Rollenkonflikte und deren Auswirkungen auf die Zufriedenheit
- Theoretische Grundlagen der Rollentheorie und Zufriedenheit im Sportkontext
- Empirische Untersuchung der Zusammenhänge im Mannschaftssport
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Forschungsfeld der gruppendynamischen Prozesse und der sozialen Rollen ein, beginnend mit den frühen Arbeiten aus den 1930er Jahren bis hin zur aktuellen Forschungslage im Mannschaftssport. Sie hebt die Relevanz des Themas hervor und beschreibt die Bedeutung von Rollenklarheit für den Erfolg eines Teams. Die Arbeit betont die vergleichsweise junge, aber wachsende Forschungsrichtung der sozialen Rollen im Sport und die damit verbundenen Fragen nach deren Einfluss auf individuelle Sportler innerhalb eines Teams. Die Einleitung skizziert den Aufbau der gesamten Arbeit und bereitet den Leser auf die nachfolgenden Kapitel vor.
2. Einführung in die Rollentheorie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Rollentheorie, beginnend mit Definitionen von sozialen Rollen und der Darstellung verschiedener theoretischer Konzepte zur Rollenwahrnehmung. Es werden wichtige Aspekte sozialer Rollen wie Role Efficacy, Rollenkonflikte und die Rollenakzeptanz mit der Rollenzufriedenheit detailliert behandelt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Konzept der Rollenklarheit, ihrer Definition, der zugrundeliegenden Theorie und dem aktuellen Forschungsstand. Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die spätere empirische Untersuchung.
3. Zufriedenheit: Kapitel 3 befasst sich eingehend mit dem Thema Zufriedenheit. Es definiert den Begriff der Zufriedenheit im Kontext von Mannschaftssport und stellt verschiedene Theorien zur Zufriedenheit vor. Es wird ein Überblick über die bestehende Forschungslage gegeben, die den Zusammenhang zwischen verschiedenen Faktoren und der Zufriedenheit im Sport beleuchtet. Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der abhängigen Variable in der später durchgeführten Studie.
4. Rollenklarheit und Zufriedenheit-Studie: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Studie zum Thema Rollenklarheit und Zufriedenheit im Mannschaftssport. Hier wird die Methodik detailliert vorgestellt, sodass die Untersuchung nachvollziehbar und reproduzierbar ist. Es umfasst die Beschreibung des Studiendesigns, der verwendeten Stichprobe, der Messinstrumente, der Datenerhebung und der statistischen Auswertung.
5. Problemstellungen und Hypothesen: Das Kapitel formuliert die Forschungsfragen und die daraus abgeleiteten Hypothesen, die im Rahmen der Studie untersucht werden. Es präzisiert die erwarteten Beziehungen zwischen Rollenklarheit und Zufriedenheit und bietet eine strukturierte Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse im späteren Verlauf der Arbeit.
Schlüsselwörter
Rollenklarheit, Zufriedenheit, Mannschaftssport, Rollentheorie, Role Efficacy, Rollenkonflikt, Rollenakzeptanz, Empirische Studie, Hypothesenprüfung, Teamleistung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Rollenklarheit und Zufriedenheit im Mannschaftssport
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Rollenklarheit auf die Zufriedenheit im Mannschaftssport. Es wird der Zusammenhang zwischen klarer Rollenverteilung innerhalb eines Teams und der individuellen Zufriedenheit der Sportler analysiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Rollentheorien und Zufriedenheitsmodelle. Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die Rollentheorie, einschließlich Definitionen, theoretischer Konzepte der Rollenwahrnehmung (z.B. Role Efficacy), Rollenkonflikten, Rollenakzeptanz und Rollenzufriedenheit. Kapitel 3 behandelt verschiedene Theorien und die Forschungslage zur Zufriedenheit im Sportkontext.
Welche Aspekte der Rollenklarheit werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Konzept der Rollenklarheit, inklusive Definition, zugrundeliegender Theorie und aktuellem Forschungsstand. Es wird untersucht, wie die Klarheit der Rollenverteilung die individuelle Zufriedenheit und potenziell auch die Teamleistung beeinflusst.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Einführung in die Rollentheorie, Zufriedenheit, die empirische Studie, Problemstellungen und Hypothesen, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung, englisches Abstract, Literaturverzeichnis und Anhang. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Methode wurde in der empirischen Studie angewendet?
Kapitel 4 beschreibt die durchgeführte empirische Studie. Die Methodik, inklusive Studiendesign, Stichprobe, Messinstrumente, Datenerhebung und statistische Auswertung, wird detailliert dargestellt, um die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Untersuchung zu gewährleisten.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden untersucht?
Kapitel 5 formuliert die Forschungsfragen und die daraus abgeleiteten Hypothesen, die den Zusammenhang zwischen Rollenklarheit und Zufriedenheit untersuchen. Die erwarteten Beziehungen werden präzisiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Studie, sowohl deskriptive Ergebnisse als auch Ergebnisse im Bezug auf die formulierten Hypothesen. Eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse findet in Kapitel 8 statt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rollenklarheit, Zufriedenheit, Mannschaftssport, Rollentheorie, Role Efficacy, Rollenkonflikt, Rollenakzeptanz, Empirische Studie, Hypothesenprüfung, Teamleistung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis, zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine ausführliche Einleitung mit der Zielsetzung und den Themenschwerpunkten sind im HTML-Dokument enthalten.
Details
- Titel
- Rollenklarheit und Zufriedenheit. Neue Erkenntnisse der Sportpsychologie
- Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln (Psychologisches Institut)
- Note
- 1,1
- Autor
- Artur Sayenko (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V272836
- ISBN (Buch)
- 9783656652168
- ISBN (eBook)
- 9783656652205
- Dateigröße
- 1040 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- einfluss rollenklarheit zufriedenheit mannschaftssport
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Artur Sayenko (Autor:in), 2014, Rollenklarheit und Zufriedenheit. Neue Erkenntnisse der Sportpsychologie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/272836
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-