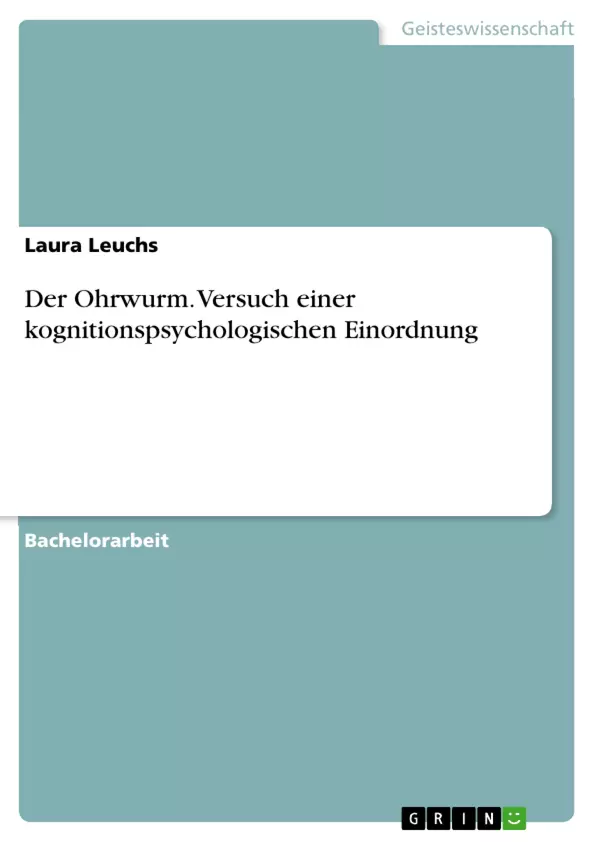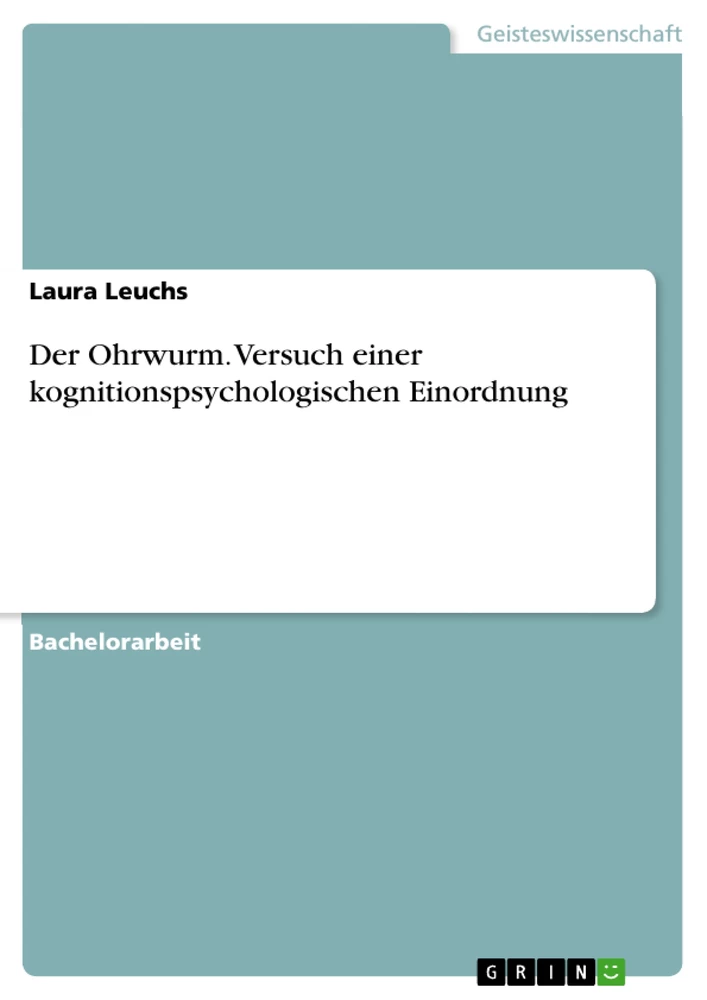
Der Ohrwurm. Versuch einer kognitionspsychologischen Einordnung
Bachelorarbeit, 2011
95 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der „Ohrwurm“ im Sprachgebrauch
- 1.2 Die Motive zur Erforschung des musikalischen „Ohrwurms“
- 1.3 Die Fragestellung dieser Arbeit
- 2. Die Geschichte der „Ohrwurmforschung“
- 2.1 Das Phänomen „Ohrwurm“ in der Literatur
- 2.2 Der „Ohrwurm“ in der Psychologie
- 2.3 Anmerkungen zur Forschungsmethodik
- 2.3.1 Retrospektive Befragung
- 2.3.2 Simultane Erfassung des Phänomens durch Tagebücher
- 2.3.3 Internet-Studien
- 3. Die Ergebnisse der „Ohrwurm“-Forschung
- 3.1 Die Forschungsergebnisse zu den Eigenschaften des „Ohrwurms“
- 3.1.1 Verbreitung und Häufigkeit des „Ohrwurm“-Phänomens
- 3.1.2 Dauer eines „Ohrwurms“
- 3.1.3 Eigenschaften der vorgestellten Musik
- 3.1.4 Die Wahrnehmungsqualität des „Ohrwurms“
- 3.1.5 Reaktionen auf den „Ohrwurm“
- 3.2 Forschungsergebnisse zu „Ohrwurm“-begünstigenden Faktoren
- 3.2.1 Faktor Person
- 3.2.2 Faktor Situation
- 3.2.3 Faktor Musik
- 4. Die kognitiven Grundlagen des „Ohrwurms“: Wahrnehmung, Gedächtnis und Vorstellung
- 4.1 Eine Definition von Musik
- 4.2 Musikwahrnehmung und beteiligte Gedächtnisstrukturen
- 4.2.1 Das menschliche Gehör
- 4.2.2 Das Ultrakurzzeitgedächtnis
- 4.2.3 Das Arbeitsgedächtnis
- 4.2.4 Das Langzeitgedächtnis
- 4.3 Die Vorstellung musikalischer Inhalte
- 4.3.1 Die Definition von musikalischen Vorstellungen
- 4.3.2 Der Ort auditiver Vorstellung
- 4.3.3 Die Eigenschaften von musikalischen Vorstellungen
- 4.3.4 Qualitätsunterschiede musikalischer Vorstellungen
- 4.3.5 Die unwillkürliche Generierung musikalischer Vorstellungen
- 5. Interpretation des „Ohrwurms“ und Versuch einer kognitionspsychologischen Einordnung
- 5.1 Betrachtung der bisherigen Ansätze
- 5.1.1 Psychoanalyse
- 5.1.2 James Kellaris: „Theory of Cognitive Itch“
- 5.1.3 Sean Bennett: „audio-eidetisches Gedächtnis“
- 5.2 Zusammenfassende kognitionspsychologische Einordnung des „Ohrwurms“
- 5.3 Die kognitionspsychologische Interpretation der Eigenschaften eines „Ohrwurms“
- 5.3.1 Häufigkeit und Dauer
- 5.3.2 Die Qualität der musikalischen Vorstellung
- 5.4 Die kognitionspsychologische Interpretation der „Ohrwurm“-begünstigenden Faktoren
- 5.4.1 Interpretation des Faktors Person
- 5.4.2 Interpretation des Faktors Situation
- 5.4.3 Interpretation des Faktors Musik
- 6. Versuch einer funktionalen Einordnung und Ausblick
- 6.1 Versuch einer funktionalen Einordnung: der „Ohrwurm“ als möglicher Gedächtniskonsolidierungsprozess für Musik
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit hat zum Ziel, das kognitive Phänomen des „Ohrwurms“ aus kognitionspsychologischer Sicht zu untersuchen und einzuordnen. Es werden bestehende Forschungsergebnisse zusammengefasst und interpretiert, um ein umfassenderes Verständnis des Phänomens zu entwickeln.
- Definition und Beschreibung des „Ohrwurm“-Phänomens
- Analyse der bisherigen Forschungsergebnisse zu den Eigenschaften von „Ohrwürmern“
- Untersuchung der Faktoren, die das Auftreten von „Ohrwürmern“ begünstigen
- Kognitionspsychologische Interpretation des „Ohrwurms“ im Kontext von Wahrnehmung, Gedächtnis und Vorstellung
- Mögliche funktionale Einordnung des „Ohrwurms“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema „Ohrwurm“ ein und beschreibt das Phänomen im alltäglichen Sprachgebrauch. Es werden verschiedene Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen vorgestellt und die Motivationen für die Erforschung des „Ohrwurms“ beleuchtet, darunter wirtschaftliche Interessen, die Abgrenzung von pathologischen Symptomen und der Erkenntnisgewinn über kognitive Funktionen. Die zentrale Fragestellung der Arbeit wird formuliert, welche die kognitiven Prozesse hinter dem „Ohrwurm“-Phänomen klären will.
2. Die Geschichte der „Ohrwurmforschung“: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zum „Ohrwurm“-Phänomen. Es werden verschiedene Forschungsmethoden betrachtet, wie retrospektive Befragungen, Tagebücher und Internetstudien, und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses des Phänomens in der Literatur und der Psychologie.
3. Die Ergebnisse der „Ohrwurm“-Forschung: Hier werden die Ergebnisse bisheriger Studien zum „Ohrwurm“ präsentiert und systematisch zusammengefasst. Die Eigenschaften des „Ohrwurms“, wie Verbreitung, Häufigkeit und Dauer, werden ebenso behandelt wie die Eigenschaften der betroffenen Musikstücke und die Reaktionen der Betroffenen. Die Kapitel analysiert außerdem Faktoren, die das Auftreten eines „Ohrwurms“ begünstigen, und unterteilt diese in personenspezifische, situative und musikbezogene Faktoren.
4. Die kognitiven Grundlagen des „Ohrwurms“: Wahrnehmung, Gedächtnis und Vorstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit den kognitiven Prozessen, die dem „Ohrwurm“-Phänomen zugrunde liegen. Es werden die Rolle der Musikwahrnehmung, verschiedene Gedächtnisstrukturen (Ultrakurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis) und die Bedeutung musikalischer Vorstellungen ausführlich diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erklärung, wie diese kognitiven Mechanismen zur Entstehung und Persistenz des „Ohrwurms“ beitragen.
5. Interpretation des „Ohrwurms“ und Versuch einer kognitionspsychologischen Einordnung: Dieses Kapitel interpretiert die bisherigen Forschungsergebnisse aus kognitionspsychologischer Perspektive. Es werden verschiedene existierende Theorien zum „Ohrwurm“ vorgestellt und kritisch bewertet. Die Arbeit versucht, eine umfassende kognitionspsychologische Erklärung für die Entstehung und Eigenschaften des „Ohrwurms“ zu liefern, indem sie die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammenführt und interpretiert.
6. Versuch einer funktionalen Einordnung und Ausblick: Dieses Kapitel versucht, eine funktionale Einordnung des „Ohrwurm“-Phänomens vorzunehmen. Es wird die Hypothese diskutiert, ob der „Ohrwurm“ als möglicher Gedächtniskonsolidierungsprozess für Musik interpretiert werden kann. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und -ansätze.
Schlüsselwörter
Ohrwurm, musikalische Vorstellung, kognitive Psychologie, Gedächtnis, Wahrnehmung, Musikwahrnehmung, Gedächtniskonsolidierung, Forschungsmethodik, auditive Vorstellung, unwillkürliche Erinnerung, eingängige Musik.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Das Phänomen des „Ohrwurms“
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das kognitive Phänomen des „Ohrwurms“ aus kognitionspsychologischer Perspektive. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse zu entwickeln, indem bestehende Forschungsergebnisse zusammengefasst, interpretiert und in einen kognitionspsychologischen Rahmen eingeordnet werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Beschreibung des „Ohrwurms“, Analyse bisheriger Forschungsergebnisse (inkl. verschiedener Forschungsmethoden), Untersuchung von Faktoren, die das Auftreten von „Ohrwürmern“ begünstigen (personenspezifisch, situativ und musikbezogen), kognitionspsychologische Interpretation im Kontext von Wahrnehmung, Gedächtnis und Vorstellung, sowie ein Versuch einer funktionalen Einordnung des Phänomens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Definition und Forschungsmotivation. Kapitel 2 (Geschichte der „Ohrwurmforschung“): Überblick über bisherige Forschung und Methoden. Kapitel 3 (Ergebnisse der „Ohrwurm“-Forschung): Zusammenfassung und Systematisierung bisheriger Forschungsergebnisse zu Eigenschaften und begünstigenden Faktoren. Kapitel 4 (Kognitive Grundlagen): Detaillierte Betrachtung der kognitiven Prozesse (Wahrnehmung, Gedächtnis, Vorstellung). Kapitel 5 (Interpretation und kognitionspsychologische Einordnung): Bewertung existierender Theorien und kognitionspsychologische Erklärung des Phänomens. Kapitel 6 (Funktionale Einordnung und Ausblick): Hypothese zur Gedächtniskonsolidierung und Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Forschungsmethoden werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Forschungsmethoden, die in der „Ohrwurm“-Forschung eingesetzt werden, inklusive retrospektiver Befragungen, Tagebücher und Internetstudien. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden werden kritisch betrachtet.
Welche kognitiven Prozesse spielen beim „Ohrwurm“ eine Rolle?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Musikwahrnehmung, verschiedenen Gedächtnisstrukturen (Ultrakurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis) und der Bedeutung musikalischer Vorstellungen bei der Entstehung und Persistenz des „Ohrwurms“.
Welche Theorien zum „Ohrwurm“ werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit präsentiert und bewertet kritisch verschiedene Theorien, darunter Ansätze aus der Psychoanalyse, die „Theory of Cognitive Itch“ von James Kellaris und das Konzept des „audio-eidetischen Gedächtnisses“ von Sean Bennett.
Welche Faktoren begünstigen das Auftreten eines „Ohrwurms“?
Die Arbeit unterscheidet personenspezifische, situative und musikbezogene Faktoren, die das Auftreten eines „Ohrwurms“ begünstigen. Diese Faktoren werden detailliert analysiert und kognitionspsychologisch interpretiert.
Wie wird der „Ohrwurm“ funktional eingeordnet?
Die Arbeit diskutiert die Hypothese, dass der „Ohrwurm“ als möglicher Prozess der Gedächtniskonsolidierung für Musik interpretiert werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ohrwurm, musikalische Vorstellung, kognitive Psychologie, Gedächtnis, Wahrnehmung, Musikwahrnehmung, Gedächtniskonsolidierung, Forschungsmethodik, auditive Vorstellung, unwillkürliche Erinnerung, eingängige Musik.
Details
- Titel
- Der Ohrwurm. Versuch einer kognitionspsychologischen Einordnung
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät 11, Department Allgemeine Psychologie 1)
- Note
- 1,0
- Autor
- Laura Leuchs (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 95
- Katalognummer
- V275032
- ISBN (eBook)
- 9783656672357
- ISBN (Buch)
- 9783656672364
- Dateigröße
- 898 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Ohrwurm Gedächtnis Musik Kognition
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Laura Leuchs (Autor:in), 2011, Der Ohrwurm. Versuch einer kognitionspsychologischen Einordnung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/275032
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-