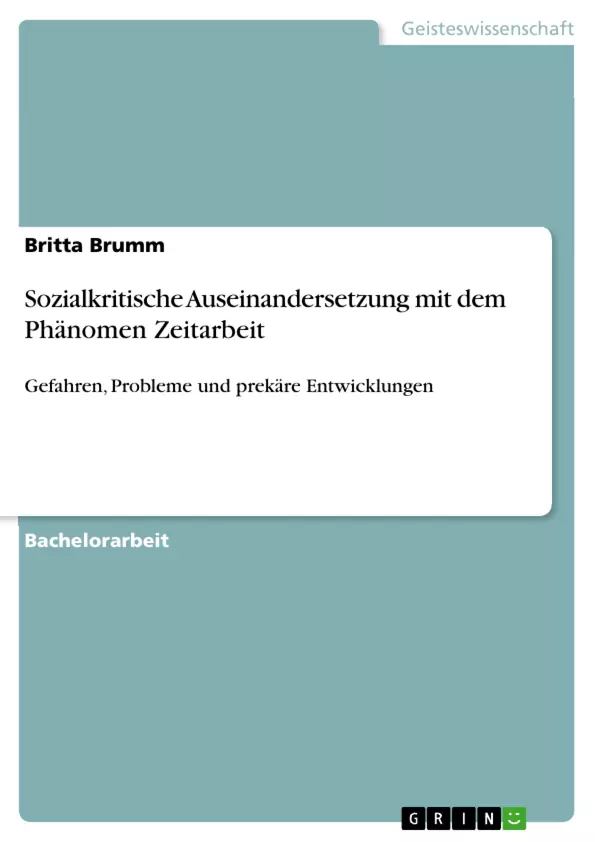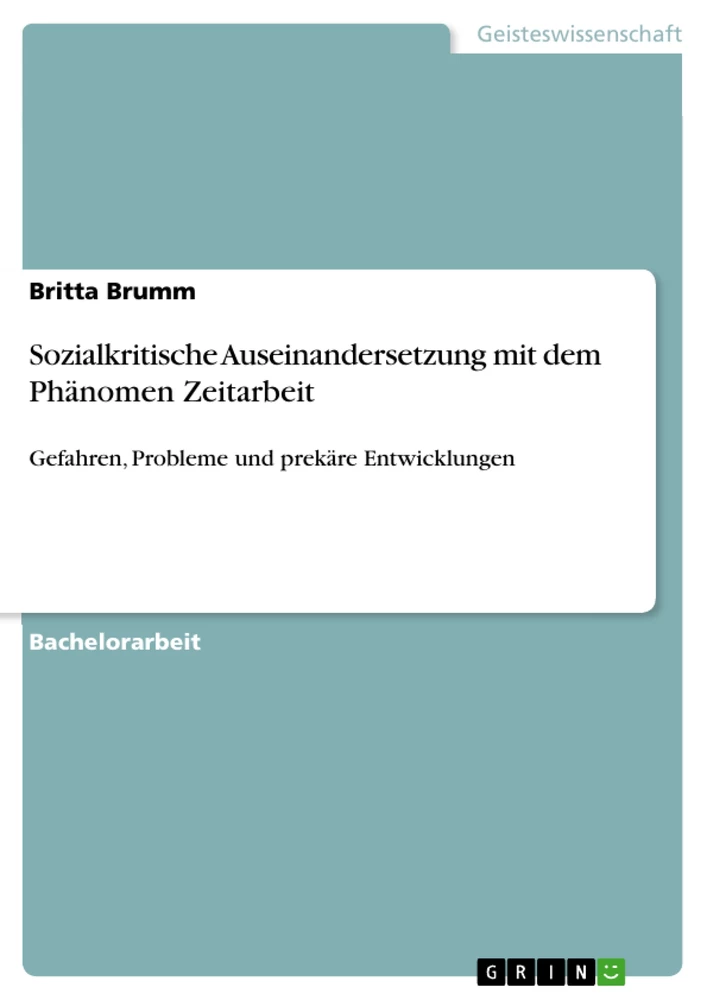
Sozialkritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeitarbeit
Bachelorarbeit, 2014
46 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Arbeitsmodell „Zeitarbeit“ in Deutschland
- 2.1 Die historische Entwicklung der Zeitarbeit in Deutschland
- 2.2 Prozesse und rechtliche Grundlagen der Zeitarbeit
- 2.2.1 Rahmenbedingungen des AÜG und Umsetzung durch die Agentur für Arbeit
- 2.2.2 Vertragliche Bedingungen zwischen Leiher, Entleiher und Arbeitnehmer
- 2.2.3 Equal Treatment/Equal Pay und Tarifverträge innerhalb der Zeitarbeitsbranche
- 2.3 Trends und zukünftige Perspektiven der Zeitarbeit
- 3. Sozialkritische Folgeerscheinungen am Arbeitsplatz „Zeitarbeit“
- 3.1 Komplexe Herrschaftsbeziehungen
- 3.2 Bindung zum Arbeitsplatz
- 3.2.1 Schwache Bindung an den Verleiher
- 3.2.2 Schwankende Bindung zur Arbeitsstelle beim Entleiher
- 3.3 Integrationsdefizite im Arbeitsumfeld
- 3.3.1 Zeitarbeitnehmer als Arbeitsplatzbedrohung für die Stammbelegschaft
- 3.3.2 Zeitarbeitnehmer als „Kündigungspuffer“ für die Stammbelegschaft
- 3.3.3 Diskriminierung und feindseliges Verhalten durch die Stammbelegschaft
- 3.4 Beweggründe für Zeitarbeit
- 3.4.1 Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch eine Beschäftigung in der Zeitarbeit
- 3.4.2 Zeitarbeit als „Sprungbrett“ in die Erwerbstätigkeit
- 3.4.3 Zeitarbeit als bevorzugte Beschäftigungsform
- 3.5 Arbeitszufriedenheit in der Zeitarbeit
- 3.6 Zeitarbeit und Gesundheit
- 3.6.1 Erhöhtes Unfallrisiko in der Zeitarbeit
- 3.6.2 Psychische Belastungen durch Zeitarbeit
- 3.6.2.1 Überarbeitung wegen der Hoffnung auf Übernahme
- 3.6.2.2 Ständige berufliche Unsicherheit
- 4. Armut und Zeitarbeit
- 4.1 Zeitarbeit als prekäre Beschäftigung
- 4.2 Niedriglohnsektor und Zeitarbeit
- 4.3 Zeitarbeitnehmer als moderne „Grenzgänger“
- 4.3.1 Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt hinsichtlich der Existenzsicherung
- 4.3.2 Konkurrenzkampf und soziale Isolierung durch Zeitarbeit
- 4.4 Prekäre Arbeitsverhältnisse als Alternative zur Arbeitslosigkeit
- 4.4.1 Zeitarbeit und Arbeitslosigkeit
- 4.4.2 Prekäre Arbeitsverhältnisse als Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit
- 4.4.2.1 Staatliche Maßnahmen
- 4.4.2.2 Stigmatisierung von Arbeitslosen
- 5. Zeitarbeit in der Sozialen Arbeit
- 5.1 Zeitarbeitsähnliche Entwicklungen in der Sozialen Arbeit
- 5.1.1 Befristete Arbeitsverträge in der Sozialen Arbeit
- 5.1.2 Teilzeitstellen in der Sozialen Arbeit
- 5.2 Zeitarbeit innerhalb der Sozialen Arbeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht aus sozialkritischer Perspektive das Phänomen der Zeitarbeit in Deutschland. Ziel ist es, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Beschäftigungsform zu beleuchten und kritisch zu analysieren.
- Historische Entwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen der Zeitarbeit
- Soziale Folgeerscheinungen am Arbeitsplatz (z.B. prekäre Arbeitsverhältnisse, Diskriminierung)
- Zusammenhang zwischen Zeitarbeit und Armut/Arbeitslosigkeit
- Auswirkungen der Zeitarbeit auf die Soziale Arbeit
- Arbeitszufriedenheit und gesundheitliche Aspekte der Zeitarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Zeitarbeit ein und erläutert die persönliche Motivation der Autorin für die Bearbeitung dieser Thematik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Ausblick auf die behandelten Aspekte, von der historischen Entwicklung und rechtlichen Grundlagen bis hin zu den sozialen und gesundheitlichen Folgen der Zeitarbeit. Die persönliche Erfahrung der Autorin und ihres Vaters mit Zeitarbeit wird als einleitender Punkt genutzt, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen.
2. Das Arbeitsmodell „Zeitarbeit“ in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt das Arbeitsmodell Zeitarbeit, klärt die verschiedenen Begrifflichkeiten (Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassung etc.) und beleuchtet die historische Entwicklung in Deutschland, einschließlich der Rolle des Arbeitsnachweisgesetzes und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die vertraglichen Beziehungen zwischen Leiher, Entleiher und Arbeitnehmer, sowie Tarifverträge und Lohnregelungen. Schließlich wird ein Ausblick auf zukünftige Trends der Zeitarbeit gegeben, wobei die Komplexität der Prognose aufgrund vieler Einflussfaktoren hervorgehoben wird.
3. Sozialkritische Folgeerscheinungen am Arbeitsplatz „Zeitarbeit“: Dieses Kapitel analysiert die sozialen Folgen der Zeitarbeit für die Arbeitnehmer. Es untersucht die komplexen Herrschaftsverhältnisse zwischen Zeitarbeitnehmern, Verleihern und Entleihern und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Verantwortungs- und Kompetenzverteilung. Es beleuchtet die mangelnde Bindung an Verleiher und Entleiher, die Integrationsdefizite im Arbeitsumfeld (Arbeitsplatzbedrohung, Diskriminierung), sowie die Beweggründe für die Annahme von Zeitarbeitsplätzen (z.B. Vermeidung von Arbeitslosigkeit). Abschließend werden Arbeitszufriedenheit und gesundheitliche Risiken (Unfallgefahr, psychische Belastung) im Kontext der Zeitarbeit untersucht.
4. Armut und Zeitarbeit: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Zeitarbeit und Armut. Es beleuchtet Zeitarbeit als eine Form prekärer Beschäftigung, insbesondere im Niedriglohnsektor, und beschreibt die Situation von Zeitarbeitnehmern als „moderne Grenzgänger“ im Arbeitsmarkt, mit ihrer Abhängigkeit von der Arbeitsmarktsituation und der damit verbundenen sozialen Isolierung und dem Konkurrenzkampf. Der Abschnitt befasst sich auch mit der Frage, inwieweit Zeitarbeit eine Alternative zur Arbeitslosigkeit darstellt und die Rolle des Staates und die Stigmatisierung von Arbeitslosen.
5. Zeitarbeit in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel fokussiert auf die Auswirkungen der Zeitarbeit im Kontext der Sozialen Arbeit. Es untersucht zeitarbeitsähnliche Entwicklungen, wie befristete Arbeitsverträge und Teilzeitstellen, sowie den Einsatz von Zeitarbeit innerhalb der Sozialen Arbeit und die Vorgehensweise sozialer Träger bei der Inanspruchnahme von Zeitarbeit.
Schlüsselwörter
Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, AÜG, prekäre Beschäftigung, Niedriglohnsektor, Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Folgen, Integration, Diskriminierung, Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sozialkritische Analyse der Zeitarbeit in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert sozialkritisch die Zeitarbeit in Deutschland. Sie untersucht die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Beschäftigungsform und beleuchtet kritisch verschiedene Aspekte, von der historischen Entwicklung und den rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu den gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung der Zeitarbeit in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen (insbesondere das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), die vertraglichen Beziehungen zwischen Zeitarbeitnehmern, Verleihern und Entleihern, soziale Folgeerscheinungen am Arbeitsplatz (z.B. prekäre Arbeitsverhältnisse, Diskriminierung, mangelnde Integration), den Zusammenhang zwischen Zeitarbeit und Armut/Arbeitslosigkeit, Arbeitszufriedenheit, gesundheitliche Risiken (Unfallgefahr, psychische Belastung) und schließlich die Auswirkungen der Zeitarbeit auf die Soziale Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Das Arbeitsmodell „Zeitarbeit“ in Deutschland (mit Unterkapiteln zur historischen Entwicklung, rechtlichen Grundlagen und zukünftigen Perspektiven), Sozialkritische Folgeerscheinungen am Arbeitsplatz „Zeitarbeit“ (mit Fokus auf Herrschaftsverhältnisse, Bindung zum Arbeitsplatz, Integrationsdefizite, Beweggründe für Zeitarbeit, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit), Armut und Zeitarbeit, Zeitarbeit in der Sozialen Arbeit und schließlich ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche konkreten sozialen Folgeerscheinungen der Zeitarbeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht komplexe Herrschaftsbeziehungen zwischen den Beteiligten, die schwache Bindung der Zeitarbeitnehmer an Verleiher und Entleiher, Integrationsdefizite im Arbeitsumfeld (z.B. Arbeitsplatzbedrohung für Stammbelegschaft, Diskriminierung), die Beweggründe für die Annahme von Zeitarbeit (z.B. Arbeitslosigkeitsvermeidung), die Arbeitszufriedenheit und die gesundheitlichen Risiken (erhöhtes Unfallrisiko und psychische Belastungen wie Überarbeitung und ständige berufliche Unsicherheit).
Welchen Zusammenhang stellt die Arbeit zwischen Zeitarbeit und Armut her?
Die Arbeit zeigt den Zusammenhang zwischen Zeitarbeit und Armut auf, indem sie Zeitarbeit als eine Form prekärer Beschäftigung, insbesondere im Niedriglohnsektor, darstellt. Sie beschreibt die Situation von Zeitarbeitnehmern als „moderne Grenzgänger“, ihre Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt und die damit verbundene soziale Isolierung und den Konkurrenzkampf. Die Rolle des Staates bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Kontext prekärer Arbeitsverhältnisse wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Zeitarbeit im Kontext der Sozialen Arbeit betrachtet?
Das Kapitel zur Sozialen Arbeit untersucht zeitarbeitsähnliche Entwicklungen wie befristete Verträge und Teilzeitstellen in diesem Bereich und analysiert den Einsatz von Zeitarbeit innerhalb sozialer Einrichtungen und die Vorgehensweise der Träger bei der Inanspruchnahme von Zeitarbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in der Zusammenfassung der Kapitel nicht detailliert wiedergegeben.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, AÜG, prekäre Beschäftigung, Niedriglohnsektor, Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Folgen, Integration, Diskriminierung, Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, Soziale Arbeit.
Details
- Titel
- Sozialkritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeitarbeit
- Untertitel
- Gefahren, Probleme und prekäre Entwicklungen
- Hochschule
- Universität Münster
- Note
- 1,7
- Autor
- Britta Brumm (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V275684
- ISBN (eBook)
- 9783656696490
- ISBN (Buch)
- 9783656700371
- Dateigröße
- 674 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- sozialkritische auseinandersetzung phänomen zeitarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Britta Brumm (Autor:in), 2014, Sozialkritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeitarbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/275684
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-