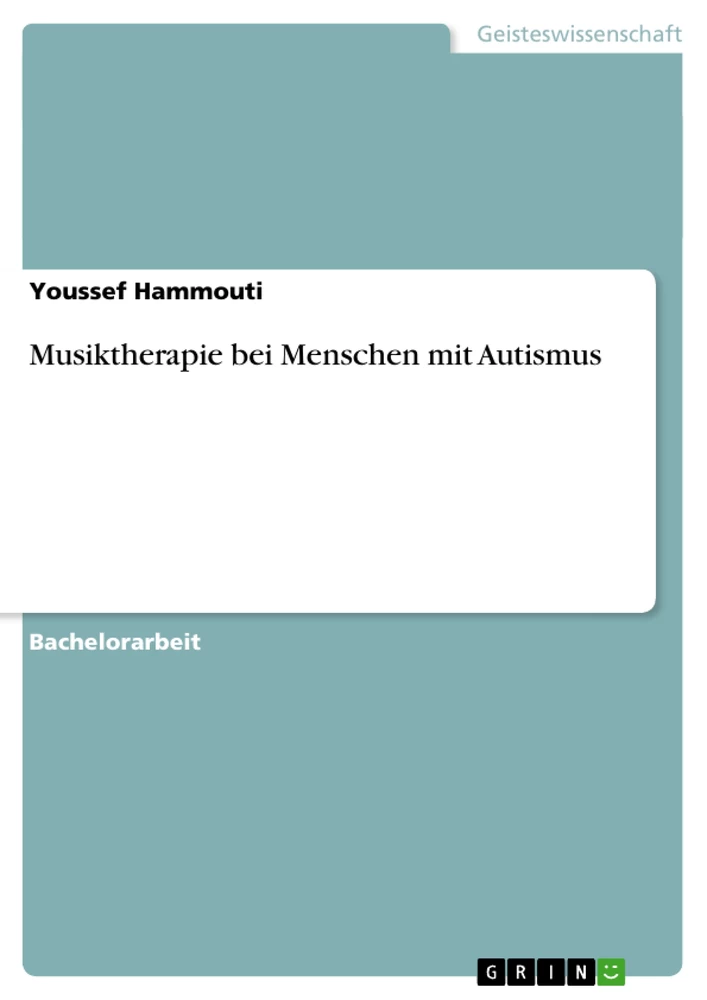
Musiktherapie bei Menschen mit Autismus
Bachelorarbeit, 2014
45 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autismus im Überblick
- Begriff, Terminologie und Geschichte
- Charakteristische Merkmale (Symptomatik)
- Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion
- Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation
- Eingeschränkte Interessen und stereotypes Verhalten
- Spektrum autistischer Störungen
- Häufigkeit autistischer Störung
- Frühkindlicher Autismus
- Asperger-Syndrom
- Ursachenforschung zu autistischen Störungen
- Therapie Möglichkeiten
- Musiktherapie
- Zum Begriff der Musiktherapie
- Methodik der Musiktherapie
- Das Setting
- Rezeptive Musiktherapie
- Aktive Musiktherapie
- Einzel- und Gruppentherapie
- Verlauf der Therapie
- Systematik der Musiktherapie
- Konfliktzentrierte Musiktherapie
- Erlebniszentrierte Musiktherapie
- Übungszentrierte Musiktherapie
- Therapeutisches Musizieren
- Anwendungsbereiche (Möglichkeiten) der Musiktherapie
- Bedeutung von Musik für Autisten
- Die Therapiekonzept der Musiktherapie mit autistischen Kindern
- Musiktherapie nach Karin Schumacher
- Die Therapieform (Kontakt- Begegnung- Beziehung)
- Der Kontakt
- Der Blick-Kontakt
- Die Begegnung
- Die Beziehung
- Stereotypie nach Karin Schumacher
- Das Finden einer Spielform
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Musiktherapie bei Menschen mit Autismus. Das Ziel ist es, die Wirksamkeit und die Anwendungsmöglichkeiten der Musiktherapie in diesem Kontext zu untersuchen.
- Die verschiedenen Formen von Autismus und deren Symptome
- Die Grundlagen und Methoden der Musiktherapie
- Die Anwendungsmöglichkeiten der Musiktherapie bei Menschen mit Autismus
- Das Therapiekonzept von Karin Schumacher und seine Anwendung in der Praxis
- Die Rolle der Musik im Umgang mit stereotypen Verhaltensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der Arbeit und erläutert die Relevanz der Musiktherapie für Menschen mit Autismus. Kapitel 2 beschäftigt sich mit Autismus im Überblick, wobei die Definition, die Geschichte und die wichtigsten Symptome beleuchtet werden. Des Weiteren wird das Spektrum autistischer Störungen, die Ursachenforschung und die verschiedenen Therapieansätze vorgestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Musiktherapie selbst. Hier werden die Definition, die Methodik und die Systematik der Musiktherapie erklärt. Das Kapitel 4 behandelt die verschiedenen Anwendungsbereiche der Musiktherapie in der Praxis, während Kapitel 5 sich auf die spezifische Anwendung der Musiktherapie bei autistischen Kindern konzentriert.
Die Arbeit untersucht insbesondere das Therapiekonzept von Karin Schumacher und die Bedeutung der Musik im Umgang mit stereotypen Verhaltensweisen bei autistischen Kindern.
Schlüsselwörter
Autismus, Musiktherapie, Stereotypie, Karin Schumacher, Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Soziale Interaktion, Soziale Kommunikation, Therapiemethoden, Anwendungsbereiche.
Details
- Titel
- Musiktherapie bei Menschen mit Autismus
- Hochschule
- Hochschule Fulda
- Autor
- Youssef Hammouti (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V276645
- ISBN (eBook)
- 9783656763505
- ISBN (Buch)
- 9783656763543
- Dateigröße
- 707 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- musiktherapie menschen autismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Youssef Hammouti (Autor:in), 2014, Musiktherapie bei Menschen mit Autismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/276645
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-



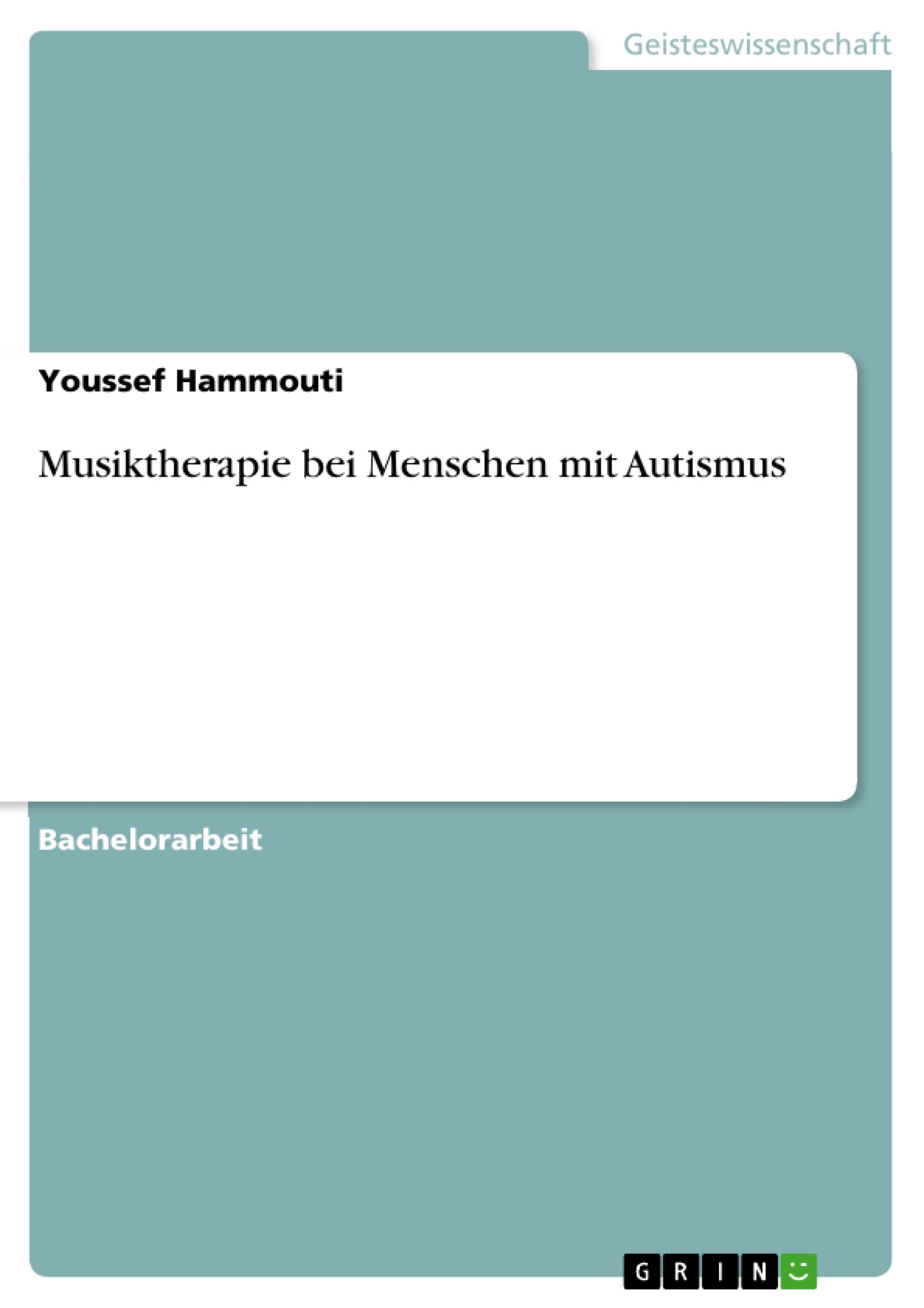






Kommentare