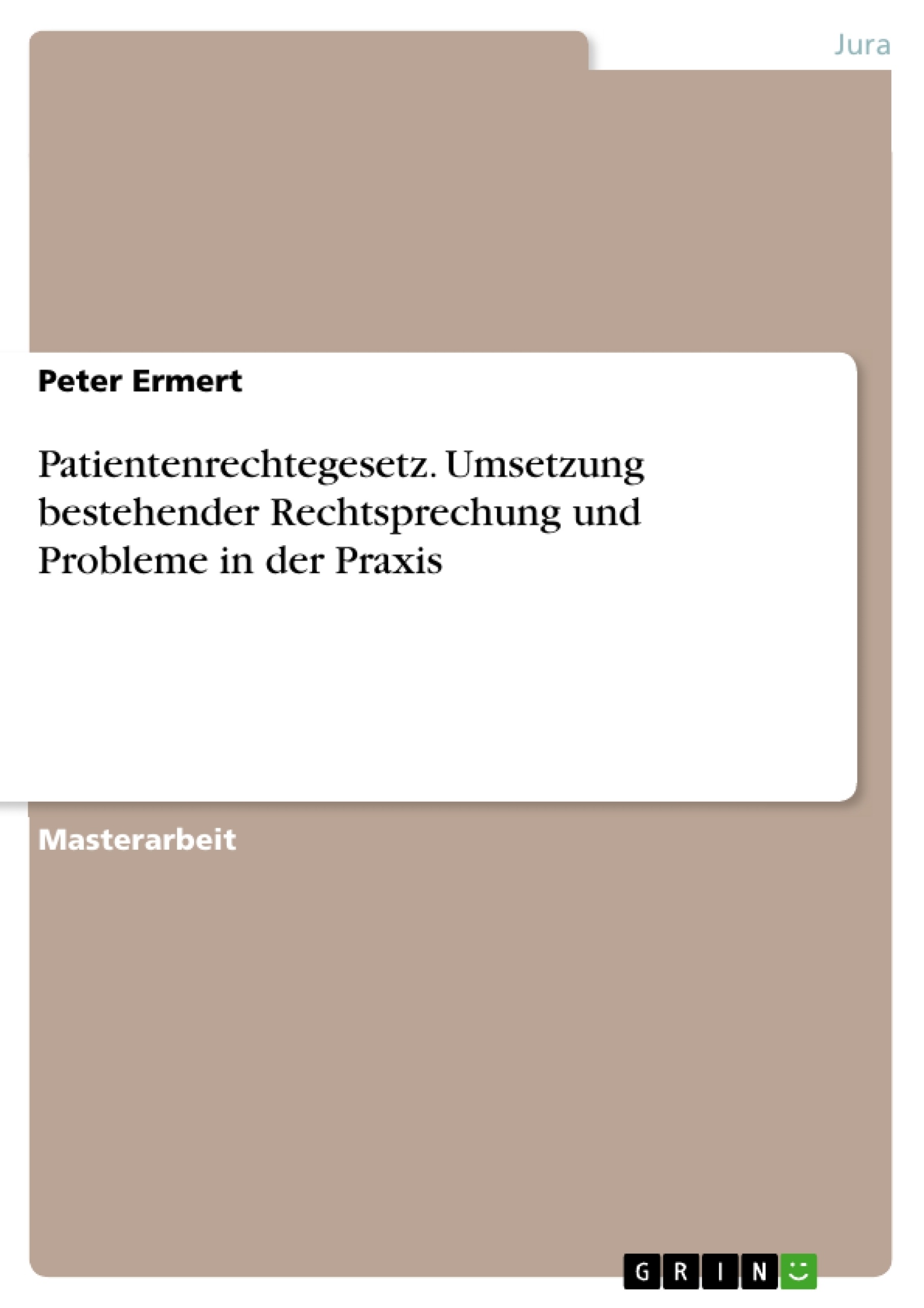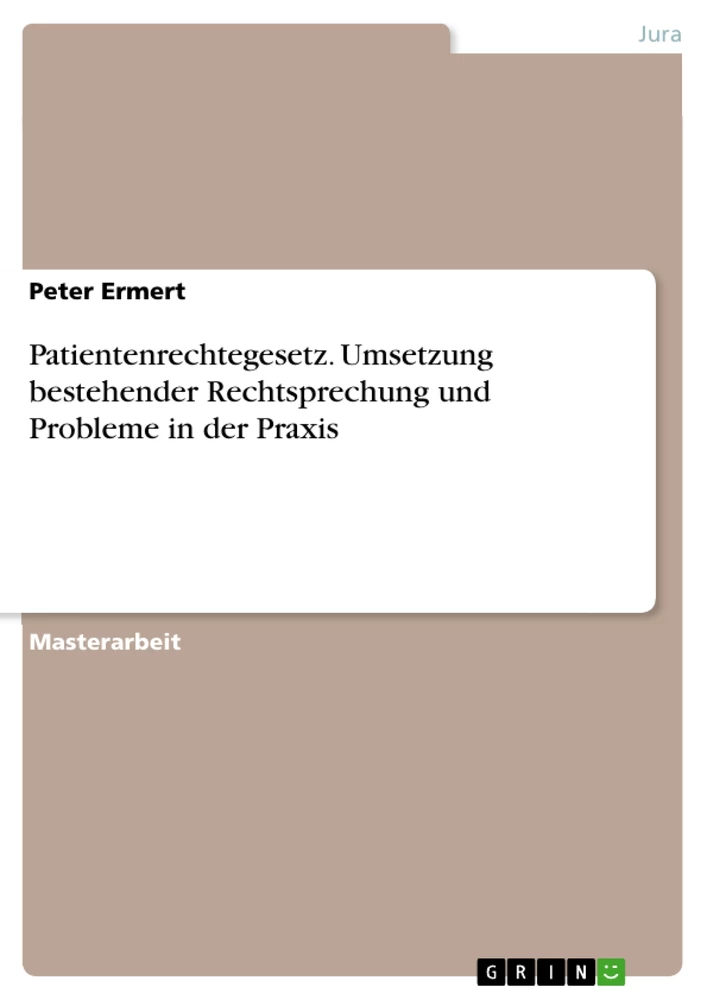
Patientenrechtegesetz. Umsetzung bestehender Rechtsprechung und Probleme in der Praxis
Masterarbeit, 2014
60 Seiten, Note: 1,3
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Methodik
- Bestimmung von Patientenrechten
- Grundlage
- Definition
- Individuelle Patientenrechte
- Autonomierechte
- Qualitätsrechte und Patientensicherheit
- Kollektive Patienten- bzw. Bürgerrechte
- Historie der Patientenrechte in Deutschland
- Gesetzliche Regelung
- Gesetzeshistorie
- Patientenrechtegesetz
- Ziele
- Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag, § 630a BGB
- Anwendbare Vorschriften, § 630b
- Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten, § 630c BGB
- Einwilligung, § 630d BGB
- Aufklärungspflicht, § 630e BGB
- Dokumentation, § 630f BGB
- Einsichtnahme, § 630g BGB
- Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler, § 630h BGB
- Änderung im Sozialgesetzbuch V
- Patientenbeteiligungsverordnung
- Änderung in der Bundesärzteordnung (BÄO)
- Änderung im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- Vergleich zwischen Rechtsprechung und gesetzlicher Regelung
- Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Patientenrechtegesetz, seine Umsetzung bestehender Rechtsprechung und die Herausforderungen in der praktischen Anwendung. Sie analysiert die Definition von Patientenrechten, ihre historische Entwicklung in Deutschland und den Vergleich zwischen der gesetzlichen Regelung und der bisherigen Rechtsprechung. Die Arbeit fokussiert auf die Effektivität des Gesetzes und mögliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis.
- Definition und Abgrenzung von individuellen und kollektiven Patientenrechten
- Historische Entwicklung des Patientenschutzes in Deutschland
- Analyse der zentralen Bestimmungen des Patientenrechtegesetzes (§§ 630a - 630h BGB)
- Vergleich zwischen der Rechtsprechung vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes
- Bewertung der Zielerreichung des Patientenrechtegesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Methodik: Diese Arbeit befasst sich mit dem 2013 in Kraft getretenen Patientenrechtegesetz und dessen Auswirkungen auf die Praxis. Die Einführung beleuchtet die kontroverse Diskussion um die Notwendigkeit des Gesetzes, da die bestehende Rechtsprechung bereits umfassenden Patientenschutz gewährleistet haben soll. Die Arbeit verfolgt den Ansatz, die Patientenrechte zu definieren, ihre historische Entwicklung nachzuzeichnen, die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes zu analysieren und schließlich Rechtsprechung und Gesetzgebung zu vergleichen, um die Zielerreichung des Gesetzes zu bewerten.
Bestimmung von Patientenrechten: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die weitere Analyse, indem es Patientenrechte definiert und systematisiert. Es differenziert zwischen individuellen Rechten (z.B. Autonomie- und Informationsrechte) und kollektiven Rechten (z.B. Qualitätssicherung). Die Kapitel erläutert die juristischen Grundlagen und liefert eine differenzierte Darstellung der verschiedenen Arten von Patientenrechten, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind. Der Fokus liegt auf der systematischen Einordnung und der begrifflichen Klärung.
Historie der Patientenrechte in Deutschland: Dieser Abschnitt verfolgt die Entwicklung des Patientenschutzes in Deutschland von seinen Anfängen bis zum Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes. Es werden wichtige Meilensteine und gerichtliche Entscheidungen dargestellt, die zur heutigen Rechtslage geführt haben. Dieser historische Überblick dient dazu, den Kontext des Patientenrechtegesetzes zu verstehen und die Notwendigkeit bzw. die Kontroverse um seine Einführung besser einzuordnen.
Gesetzliche Regelung: Der Kern der Arbeit besteht in der detaillierten Analyse des Patientenrechtegesetzes, insbesondere der §§ 630a-630h BGB. Jedes Paragraphen wird einzeln erläutert, wobei der jeweilige Gesetzestext zitiert und kommentiert wird. Die Analyse beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen der einzelnen Bestimmungen und ihre Bedeutung für die Praxis. Besonderes Augenmerk wird auf die Themen Aufklärungspflicht, Einwilligung, Dokumentation und Beweislast gelegt. Die Kapitel untersucht detailliert die verschiedenen Aspekte des neuen Gesetzes und deren Bedeutung für die Beziehung zwischen Arzt und Patient.
Vergleich zwischen Rechtsprechung und gesetzlicher Regelung: Das Kapitel vergleicht die Rechtsprechung vor Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes mit den neuen gesetzlichen Regelungen. Es werden Übereinstimmungen und Abweichungen herausgearbeitet und analysiert, um zu beurteilen, ob das Gesetz bestehende Rechtsprechung kodifiziert oder neue Rechtsgrundlagen schafft. Die Analyse zielt darauf ab, die praktische Relevanz des Gesetzes zu ermitteln und mögliche Auswirkungen auf die Praxis aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Patientenrechtegesetz, Behandlungsvertrag, Arzt-Patienten-Verhältnis, Aufklärungspflicht, Einwilligung, Dokumentation, Beweislast, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Patientenschutz, §§ 630a-630h BGB, Qualitätssicherung.
Häufig gestellte Fragen zum Patientenrechtegesetz
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Patientenrechtegesetz?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Patientenrechtegesetz (PatientenRG), einschließlich Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Sie analysiert die Definition von Patientenrechten, deren historische Entwicklung in Deutschland und den Vergleich zwischen gesetzlicher Regelung und Rechtsprechung. Der Fokus liegt auf der Effektivität des Gesetzes und möglichen Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung individueller und kollektiver Patientenrechte, historische Entwicklung des Patientenschutzes in Deutschland, Analyse der zentralen Bestimmungen des Patientenrechtegesetzes (§§ 630a-630h BGB), Vergleich der Rechtsprechung vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes und Bewertung der Zielerreichung des Patientenrechtegesetzes. Die Methodik beinhaltet die Definition von Patientenrechten, die Nachzeichnung der historischen Entwicklung, die Analyse der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes und den Vergleich von Rechtsprechung und Gesetzgebung zur Bewertung der Zielerreichung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung und Methodik, Bestimmung von Patientenrechten (inkl. Autonomierechten und Qualitätsrechten), Historie der Patientenrechte in Deutschland, Gesetzliche Regelung (detaillierte Analyse der §§ 630a-630h BGB, inklusive Aufklärungspflicht, Einwilligung, Dokumentation und Beweislast), Vergleich zwischen Rechtsprechung und gesetzlicher Regelung und abschließender Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Erläuterung der jeweiligen Aspekte.
Welche Aspekte des Patientenrechtegesetzes werden besonders hervorgehoben?
Besonderes Augenmerk wird auf die §§ 630a-630h BGB gelegt, die im Detail analysiert werden. Die Aufklärungspflicht, die Einwilligung des Patienten, die Dokumentationspflichten und die Beweislast bei Behandlungs- und Aufklärungsfehlern werden ausführlich behandelt. Der Vergleich zwischen der Rechtsprechung vor und nach dem Inkrafttreten des Gesetzes spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung des Patientenrechtegesetzes, seiner Umsetzung in der bestehenden Rechtsprechung und der Herausforderungen in der praktischen Anwendung. Es soll die Effektivität des Gesetzes bewertet und mögliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis aufgezeigt werden. Die Arbeit zielt auf eine umfassende Analyse der Definition, der historischen Entwicklung und der praktischen Relevanz des Patientenrechtegesetzes ab.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Patientenrechtegesetz, Behandlungsvertrag, Arzt-Patienten-Verhältnis, Aufklärungspflicht, Einwilligung, Dokumentation, Beweislast, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Patientenschutz, §§ 630a-630h BGB und Qualitätssicherung.
Wie wird die historische Entwicklung der Patientenrechte dargestellt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Patientenschutzes in Deutschland von seinen Anfängen bis zum Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes. Wichtige Meilensteine und gerichtliche Entscheidungen werden dargestellt, um den Kontext des Gesetzes zu verstehen und die Kontroverse um seine Einführung einzuordnen.
Wie wird der Vergleich zwischen Rechtsprechung und gesetzlicher Regelung durchgeführt?
Das Kapitel zum Vergleich analysiert die Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen der Rechtsprechung vor Inkrafttreten des Gesetzes und den neuen gesetzlichen Regelungen. Ziel ist es zu beurteilen, ob das Gesetz bestehende Rechtsprechung kodifiziert oder neue Rechtsgrundlagen schafft, und die praktische Relevanz des Gesetzes zu ermitteln.
Details
- Titel
- Patientenrechtegesetz. Umsetzung bestehender Rechtsprechung und Probleme in der Praxis
- Hochschule
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Distance & Independent Studies Center (DISC))
- Note
- 1,3
- Autor
- Peter Ermert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V277624
- ISBN (eBook)
- 9783656705420
- ISBN (Buch)
- 9783656706564
- Dateigröße
- 647 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Erstgutachter Verf. liefert eine deutlich überdurchschnittliche Arbeit, die lediglich leichteste Mängel aufweist. Das Gutachten überzeugt durch eine sauber strukturierte Gliederung... Der Leser hat den Eindruck, sehr gut durch die Fragestellung geführt zu werden, was für eine Master-Arbeit sehr wichtig ist. Lobenswert ist die klare und problem- und beispielsorientierte Darstellung der Rechtslage im neuen § 630c BGB... Zweitgutachter Die Arbeit ist logisch und strukturiert aufgebaut. Der viel zitierte rote Faden ist durchgängig erkennbar und führt den Leser ...
- Schlagworte
- Patientenrechtegesetz BGB Schuldrecht; Wirtschaftsrecht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Peter Ermert (Autor:in), 2014, Patientenrechtegesetz. Umsetzung bestehender Rechtsprechung und Probleme in der Praxis, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/277624
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-