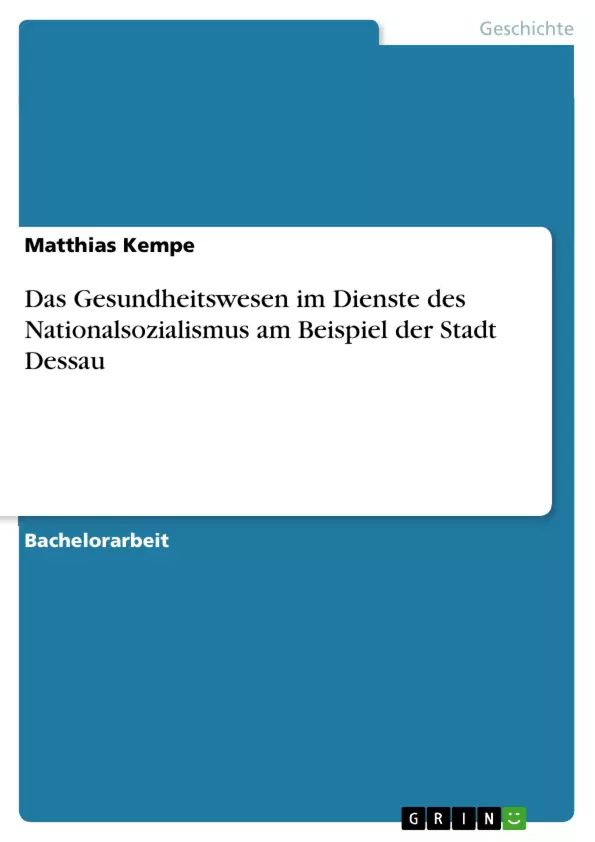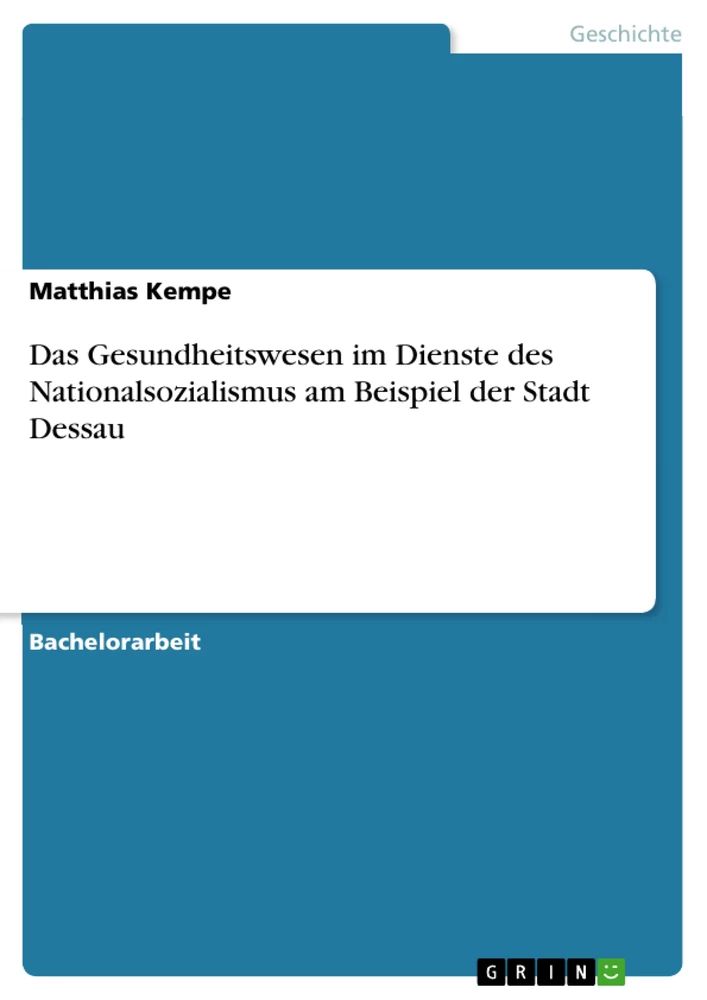
Das Gesundheitswesen im Dienste des Nationalsozialismus am Beispiel der Stadt Dessau
Bachelorarbeit, 2013
42 Seiten, Note: 1,8
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ideologische Voraussetzungen für die Gesundheitspolitik im „Dritten Reich“
- Der polykratische Staat Adolf Hitlers
- Die Verwaltung der Stadt Dessau in der Zeit des Nationalsozialismus
- Das Gesundheitswesen im Nationalsozialismus am Beispiel der Stadt Dessau
- Die Umformung des Gesundheitswesens in der Zeit von 1933 bis 1945
- Parteiliches vs. staatliches Gesundheitswesen – der Konflikt zwischen Dr. Gerhard Wagner und Dr. med. Arthur Gütt bis 1939
- Der Einfluss des Zweiten Weltkrieges ab 1939
- Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und die Anpassung von Justiz und Ärzteschaft
- Die,,Freigabe zur Vernichtung lebensunwerten Lebens“ – die „Euthanasie" in der Anstalt Bernburg
- Die Umformung des Gesundheitswesens in der Zeit von 1933 bis 1945
- Schlussbetrachtungen
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Wandel des deutschen Gesundheitswesens während der NS-Zeit am Beispiel der Stadt Dessau. Sie analysiert die ideologische Grundlage der NS-Gesundheitspolitik, die Machtstrukturen des NS-Staates und die konkrete Umsetzung der NS-Gesundheitspolitik in Dessau.
- Die ideologische Grundlage der NS-Gesundheitspolitik, insbesondere die Rolle von Rassenhygiene und Sozialdarwinismus
- Die Machtstrukturen des NS-Staates und die Rolle der NSDAP in der Verwaltung
- Die Umformung des Gesundheitswesens in Dessau von 1933 bis 1945, einschließlich des Konflikts zwischen Dr. Gerhard Wagner und Dr. med. Arthur Gütt
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf das Gesundheitswesen in Dessau
- Die Umsetzung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und die „Euthanasie“ in der Anstalt Bernburg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Forschungsmethodik. Sie beschreibt die Quellenbasis und die wichtigsten Forschungsliteratur.
Kapitel 2 beleuchtet die ideologischen Voraussetzungen für die NS-Gesundheitspolitik. Es werden die Einflüsse von Sozialdarwinismus und Rassenhygiene auf die nationalsozialistische Ideologie und die Entwicklung der Erbgesundheitspolitik dargestellt.
Kapitel 3 analysiert die Machtstrukturen des NS-Staates und die Verwaltung der Stadt Dessau. Es wird der Einfluss der NSDAP auf die Verwaltung und die wichtigsten Personen der Dessauer Politik beleuchtet.
Kapitel 4 beschreibt die Umformung des Gesundheitswesens in Dessau von 1933 bis 1945. Es wird der Konflikt zwischen Dr. Gerhard Wagner und Dr. med. Arthur Gütt um die Gestaltung des Gesundheitswesens dargestellt. Außerdem werden die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf das Gesundheitswesen in Dessau beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Gesundheitswesen im Nationalsozialismus, die Stadt Dessau, die NS-Gesundheitspolitik, Rassenhygiene, Sozialdarwinismus, Erbgesundheitspolitik, „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, „Euthanasie“, Anstalt Bernburg, Dr. Gerhard Wagner, Dr. med. Arthur Gütt, Machtstrukturen, Verwaltung, Zweiter Weltkrieg.
Details
- Titel
- Das Gesundheitswesen im Dienste des Nationalsozialismus am Beispiel der Stadt Dessau
- Hochschule
- Universität Leipzig
- Note
- 1,8
- Autor
- Matthias Kempe (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V278536
- ISBN (Buch)
- 9783656732358
- ISBN (eBook)
- 9783656732365
- Dateigröße
- 590 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gesundheitswesen dienste nationalsozialismus beispiel stadt dessau
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Matthias Kempe (Autor:in), 2013, Das Gesundheitswesen im Dienste des Nationalsozialismus am Beispiel der Stadt Dessau, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/278536
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-