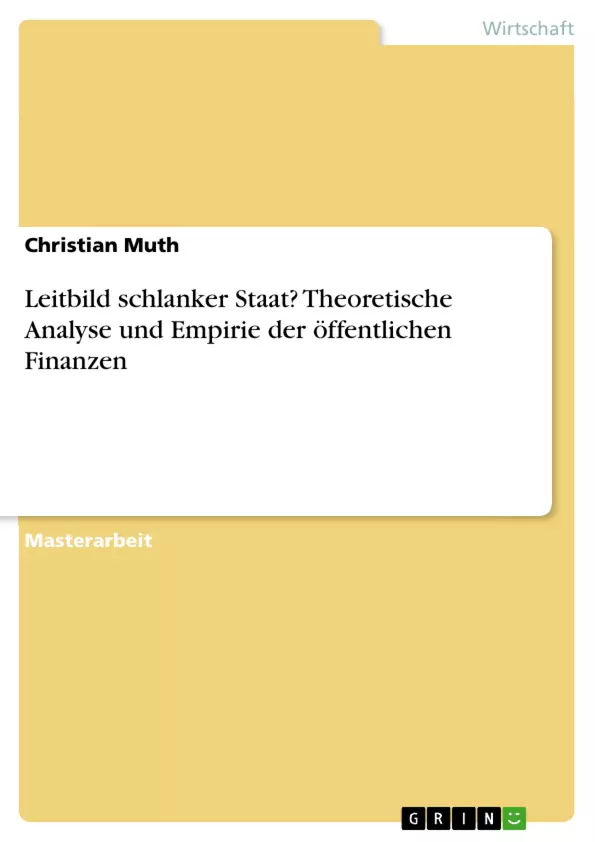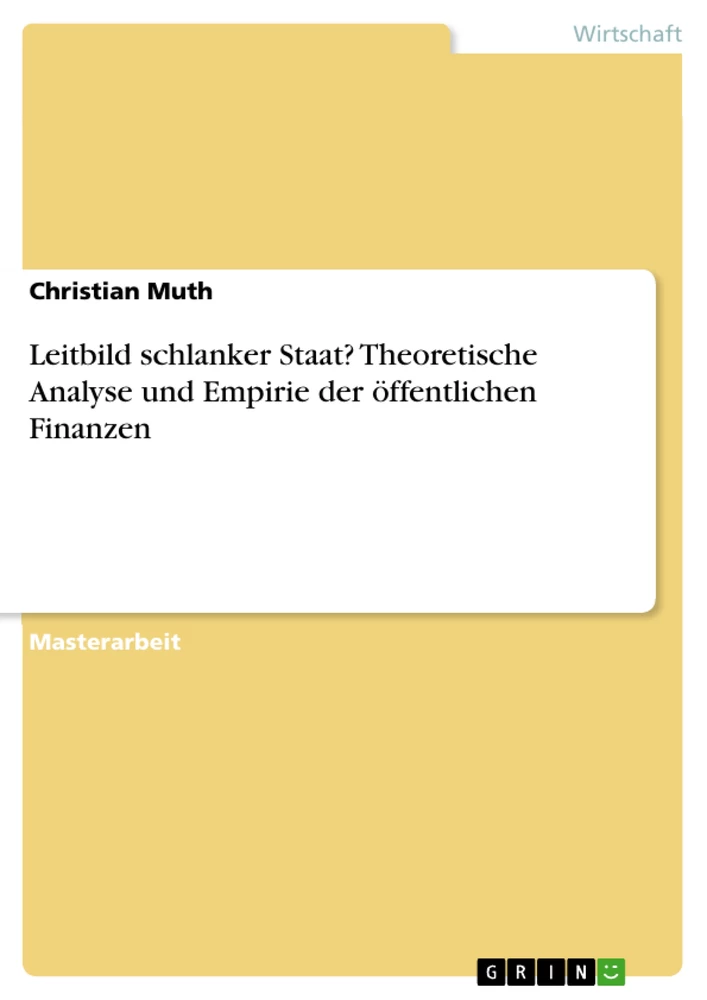
Leitbild schlanker Staat? Theoretische Analyse und Empirie der öffentlichen Finanzen
Masterarbeit, 2013
45 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Staatsaktivität im Wandel
- Entwicklung der Staatsaufgaben
- Dynamik der Staatsausgabenquote
- Trend der Schuldenlast
- Internationale Vorgehensweisen zur Ausgabenbegrenzung
- Stabilitätskriterien der Europäische Union
- Defizitbeschränkungen der Vereinigte Staaten von Amerika
- Schweizer Schuldenbremse und Finanzreferenden
- Die deutsche Schuldenbremse
- Entwicklung der Staatsaufgaben
- Wachstumstheorie des Öffentlichen Sektors
- Wagnersches Gesetz
- Baumolsche Kostenkrankheit
- Niveauverschiebungseffekt
- Ansätze zur Disziplinierung staatlichen Handelns
- Fiskalregeln
- Schuldenregeln
- Anreizkompatible Zielvereinbarung
- Kommission für Kostenbewusstsein und Transparenz
- Finanzreferenden
- Fiskalregeln
- Empirie und politische Implikationen
- Empirische Evidenz der Wachstumstheorie
- Evidenzwirkung institutioneller Regelungen
- Staatliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Staatliche Kernaufgaben
- Schlanker Staat
- Fazit und Ausblick
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der staatlichen Aufgaben und die Herausforderungen der öffentlichen Finanzen im Kontext des wachsenden Staatsbedarfs. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des Wachstums des öffentlichen Sektors und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Disziplinierung staatlichen Handelns. Die Arbeit befasst sich mit der empirischen Evidenz der Wachstumstheorie und analysiert die Effizienzverbesserungsmöglichkeiten staatlichen Handelns.
- Entwicklung der Staatsausgabenquote und Schuldenlast
- Internationale Ansätze zur Ausgabenbegrenzung
- Theoretische Grundlagen des Wachstums des öffentlichen Sektors
- Ansätze zur Disziplinierung staatlichen Handelns
- Empirische Evidenz und politische Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Leitbilds "Schlanker Staat" ein und beleuchtet die Relevanz der öffentlichen Finanzen im Kontext von Haushaltsdefiziten und Staatspleiten. Es wird die Bedeutung der staatlichen Handlungsfähigkeit im Hinblick auf zentrale gesellschaftliche Aufgaben und die Herausforderungen des demographischen Wandels hervorgehoben.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklung der staatlichen Aufgabenstruktur und die Verschiebung von gesellschaftlichen Prioritäten. Es werden die Dynamik der Staatsausgabenquote und der Trend der Schuldenlast im internationalen Vergleich betrachtet. Zudem werden verschiedene internationale Vorgehensweisen zur Ausgabenbegrenzung, wie z.B. Stabilitätskriterien der Europäischen Union, Defizitbeschränkungen der Vereinigten Staaten von Amerika, die Schweizer Schuldenbremse und die deutsche Schuldenbremse, vorgestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der theoretischen Grundlage des Wachstums des öffentlichen Sektors. Es werden das Wagnersche Gesetz, die Baumolsche Kostenkrankheit und der Niveauverschiebungseffekt erläutert.
Kapitel 4 präsentiert verschiedene Ansätze zur Disziplinierung staatlichen Handelns. Es werden Fiskalregeln, wie z.B. Schuldenregeln und anreizkompatible Zielvereinbarungen, sowie die Kommission für Kostenbewusstsein und Transparenz und Finanzreferenden diskutiert.
Kapitel 5 untersucht die empirische Evidenz der theoretischen Grundlagen und analysiert die Effizienzverbesserungsmöglichkeiten staatlichen Handelns. Es werden die empirischen Ergebnisse der Wachstumstheorie und die Evidenzwirkung institutioneller Regelungen betrachtet. Zudem werden staatliche Entwicklungsmöglichkeiten, wie z.B. die Definition staatlicher Kernaufgaben und das Konzept des "Schlanken Staates", diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die öffentlichen Finanzen, Staatsausgaben, Schuldenlast, Wachstumstheorie des öffentlichen Sektors, Fiskalregeln, staatliche Handlungsfähigkeit, Effizienz, "Schlanker Staat", internationale Vergleichsstudien, empirische Evidenz und politische Implikationen.
Details
- Titel
- Leitbild schlanker Staat? Theoretische Analyse und Empirie der öffentlichen Finanzen
- Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Note
- 2,3
- Autor
- Christian Muth (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V278898
- ISBN (eBook)
- 9783656764014
- ISBN (Buch)
- 9783656764069
- Dateigröße
- 654 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- leitbild staat theoretische analyse empirie finanzen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Christian Muth (Autor:in), 2013, Leitbild schlanker Staat? Theoretische Analyse und Empirie der öffentlichen Finanzen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/278898
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-