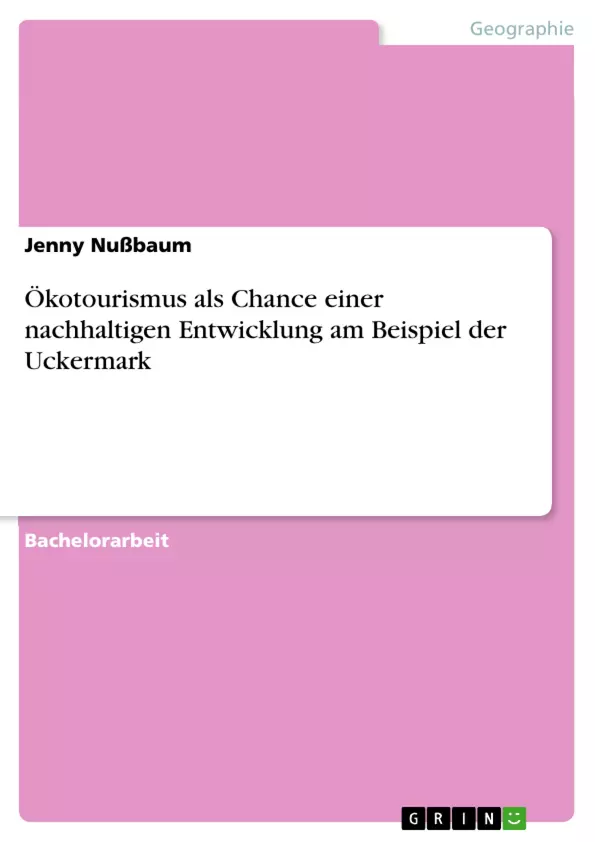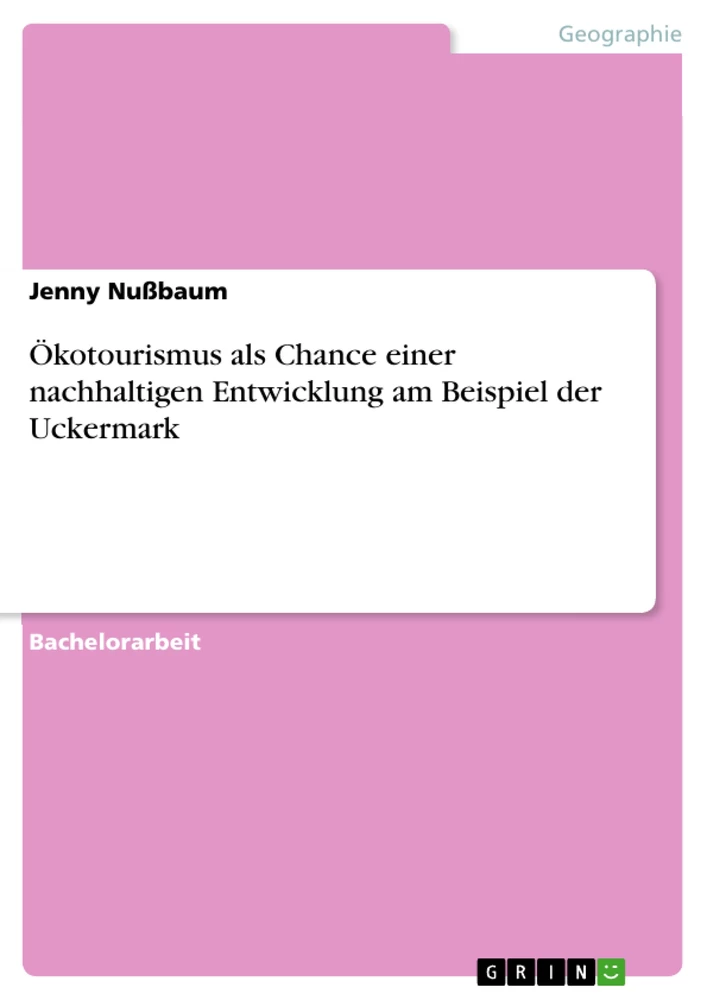
Ökotourismus als Chance einer nachhaltigen Entwicklung am Beispiel der Uckermark
Bachelorarbeit, 2014
58 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ökotourismus
- 2.1 Definition
- 2.3 Akteure im Ökotourismus
- 2.4 Interessen der Akteure
- 2.5 Allgemeine Rahmenbedingungen
- 2.6 Raumtheoretischer Hintergrund
- 3 Die Uckermark
- 3.1 Abgrenzung der Untersuchungsgebiete
- 3.2 Tourismus in Großschutzgebieten
- 3.3 Touristisches Potenzial
- 3.3.1 Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusregionen 2012/13
- 4 Methodik
- 5 Empirische Ergebnisse
- 5.1 Ökotourismus in der Uckermark
- 5.1.1 Ökotouristische Angebote
- 5.1.2 Förderung
- 5.1.3 Annahme bei Konsumenten
- 5.1.4 Bedeutung für die regionale Entwicklung
- 5.1.5 Ökotouristische Kooperationen
- 5.1.6 Probleme und Konfliktpotenzial
- 5.1.7 Zukunftsaussichten
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik des Ökotourismus, insbesondere im Kontext der Uckermark. Ziel ist es, die Chancen und Herausforderungen des Ökotourismus für eine nachhaltige Entwicklung der Region zu analysieren.
- Definition und Charakteristika des Ökotourismus
- Akteure im Ökotourismus und ihre Interessen
- Touristisches Potenzial der Uckermark
- Empirische Ergebnisse zur Ökotourismus-Situation in der Uckermark
- Bedeutung des Ökotourismus für die regionale Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas Ökotourismus in der Uckermark beleuchtet. Kapitel 2 definiert den Ökotourismus und stellt die verschiedenen Akteure und ihre Interessen im Ökotourismus vor. Es werden zudem allgemeine Rahmenbedingungen und ein raumtheoretischer Hintergrund des Ökotourismus erläutert. Kapitel 3 widmet sich der Uckermark als Untersuchungsgebiet, grenzt die Untersuchungsgebiete ab und analysiert den Tourismus in Großschutzgebieten. Zudem werden das touristische Potenzial der Uckermark und die Rolle des Bundeswettbewerbs Nachhaltige Tourismusregionen 2012/13 beleuchtet. Kapitel 4 erläutert die Methodik der Arbeit, während Kapitel 5 die empirischen Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Die Ergebnisse umfassen eine Analyse der ökotouristischen Angebote, die Förderung des Ökotourismus, die Akzeptanz bei Konsumenten, die Bedeutung für die regionale Entwicklung, ökotouristische Kooperationen, Probleme und Konfliktpotenzial sowie Zukunftsaussichten. Das abschließende Kapitel 6 fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und formuliert ein Fazit.
Schlüsselwörter
Ökotourismus, nachhaltige Entwicklung, Uckermark, Tourismusregionen, Akteure, Interessen, Potenzial, regionale Entwicklung, Probleme, Konfliktpotenzial, Zukunftsaussichten
Details
- Titel
- Ökotourismus als Chance einer nachhaltigen Entwicklung am Beispiel der Uckermark
- Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Note
- 1,3
- Autor
- Jenny Nußbaum (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V279856
- ISBN (Buch)
- 9783656731047
- ISBN (eBook)
- 9783656731054
- Dateigröße
- 1230 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ökotourismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Jenny Nußbaum (Autor:in), 2014, Ökotourismus als Chance einer nachhaltigen Entwicklung am Beispiel der Uckermark, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/279856
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-