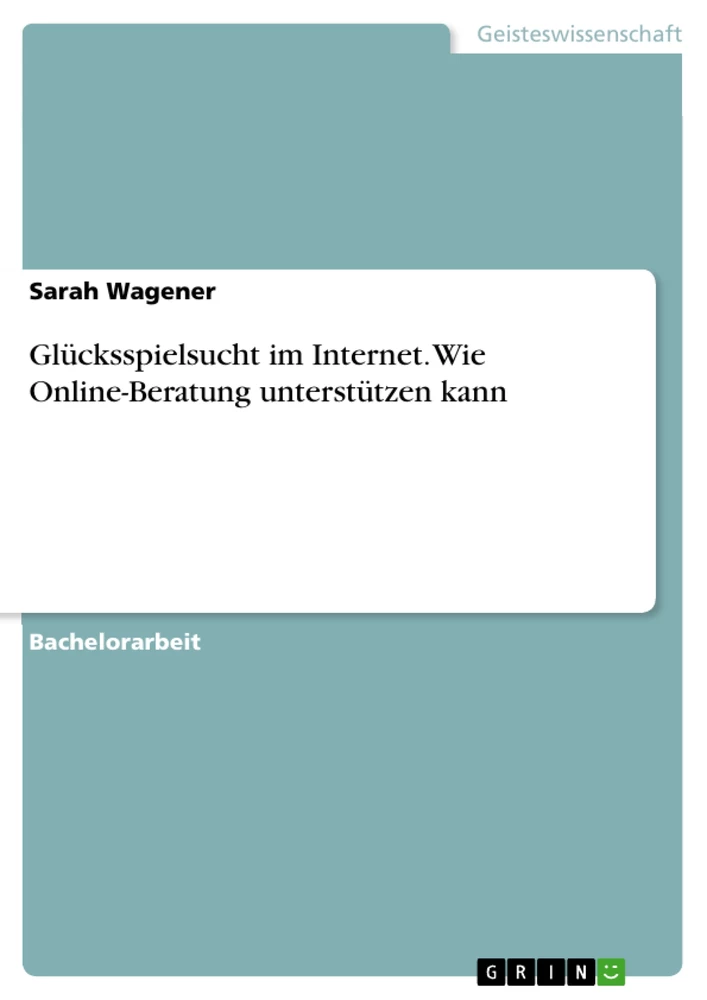
Glücksspielsucht im Internet. Wie Online-Beratung unterstützen kann
Bachelorarbeit, 2014
42 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definition Glücksspiel und Online-Glücksspiel
- Definition und Symptomatik der (Online-) Glücksspielsucht
- Diagnostik
- Erklärungsansätze für die Entstehung von pathologischem Glücksspielverhalten
- Online-Glücksspiel - Eine Einführung
- Gefährdungspotenzial von Glücksspielen im Internet
- Online-Glücksspielsucht und Computerspielsucht/Internetsucht
- Online-Beratung: Möglichkeiten und Grenzen
- Der Beratungsprozess
- Online-Beratung bei Online-Glücksspielsucht
- Ausgewählte Online-Beratungsangebote für Online-Glücksspieler
- ,,Check dein Spiel“
- Internetforen
- Fazit
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Arbeit befasst sich mit der Beratung und Therapie bei Online-Glücksspielsucht. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Online-Beratung für Menschen mit einer Online-Glücksspielproblematik zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Definition und Symptomatik der Online-Glücksspielsucht, beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung des pathologischen Spielverhaltens und geht auf das Gefährdungspotenzial von Glücksspielen im Internet ein.
- Definition und Symptomatik der Online-Glücksspielsucht
- Erklärungsansätze für die Entstehung von pathologischem Glücksspielverhalten
- Gefährdungspotenzial von Glücksspielen im Internet
- Möglichkeiten und Grenzen der Online-Beratung bei Online-Glücksspielsucht
- Ausgewählte Online-Beratungsangebote für Online-Glücksspieler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Online-Glücksspielsucht ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die Gedanken eines pathologischen Glücksspielers und verdeutlicht die Gefahr, die Glücksspiele mit sich bringen. Die Einleitung stellt die Frage, ob die moderne Form der Glücksspielsucht auch neuzeitliche Beratungsangebote fordert.
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" definiert die Begriffe "Glücksspiel" und "Online-Glücksspiel" und geht auf die Definition und Symptomatik der (Online-) Glücksspielsucht ein. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von pathologischem Glücksspielverhalten vorgestellt, darunter psychoanalytische und integrative Ansätze. Das Kapitel bietet einen Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Online-Glücksspiele und beleuchtet das Gefährdungspotenzial dieser Spielform. Außerdem werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen pathologischer Internet- und Computerspielnutzung und Online-Glücksspielsucht herausgearbeitet.
Das Kapitel "Online-Beratung: Möglichkeiten und Grenzen" befasst sich mit dem Bereich der Online-Beratung und beschreibt den Prozess dieser Beratungsform. Es werden Vergleiche mit klassischer Face-to-Face Beratung gezogen und die Chancen und Grenzen der Online-Beratung bei Online-Glücksspielsucht erörtert. Der Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung der Online-Beratung mit dem Störungsbild der Online-Glücksspielsucht. Im letzten Unterpunkt werden spezifische Beratungsangebote im Internet vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Online-Glücksspielsucht, Online-Beratung, Glücksspiel, pathologisches Spielverhalten, Gefährdungspotenzial, Internet, Computerspielsucht, Internetsucht, Beratungsprozess, Chancen und Grenzen der Online-Beratung, spezifische Online-Beratungsangebote.
Details
- Titel
- Glücksspielsucht im Internet. Wie Online-Beratung unterstützen kann
- Hochschule
- Universität Kassel (Sozialwesen)
- Note
- 1,3
- Autor
- Sarah Wagener (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V280852
- ISBN (eBook)
- 9783656767848
- ISBN (Buch)
- 9783656767862
- Dateigröße
- 991 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- beratung therapie online-glücksspielsucht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Wagener (Autor:in), 2014, Glücksspielsucht im Internet. Wie Online-Beratung unterstützen kann, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/280852
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









